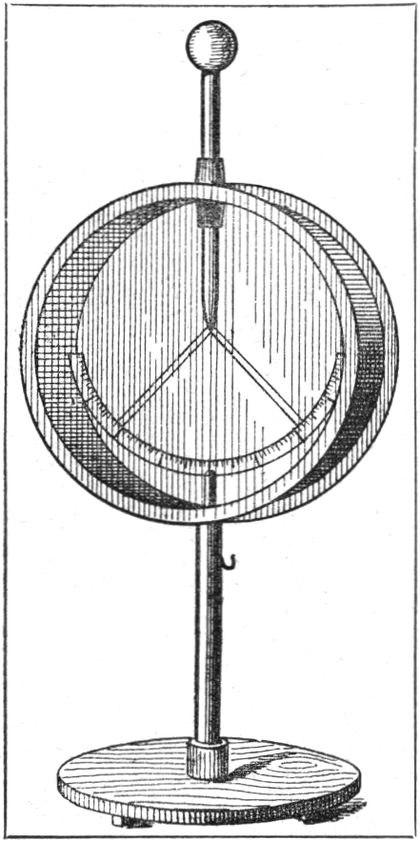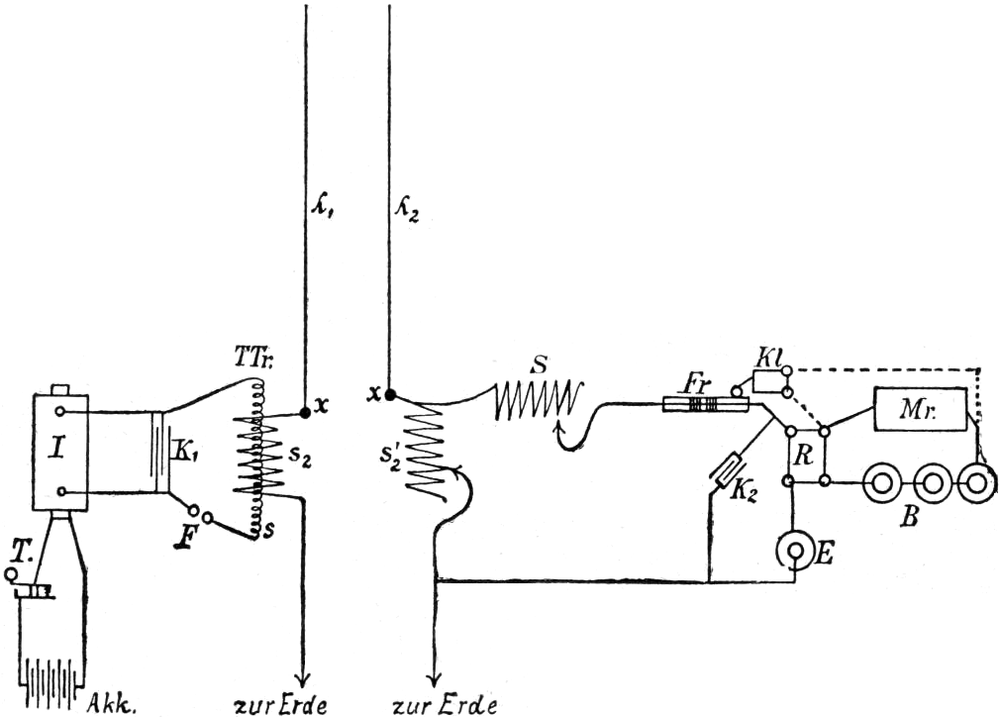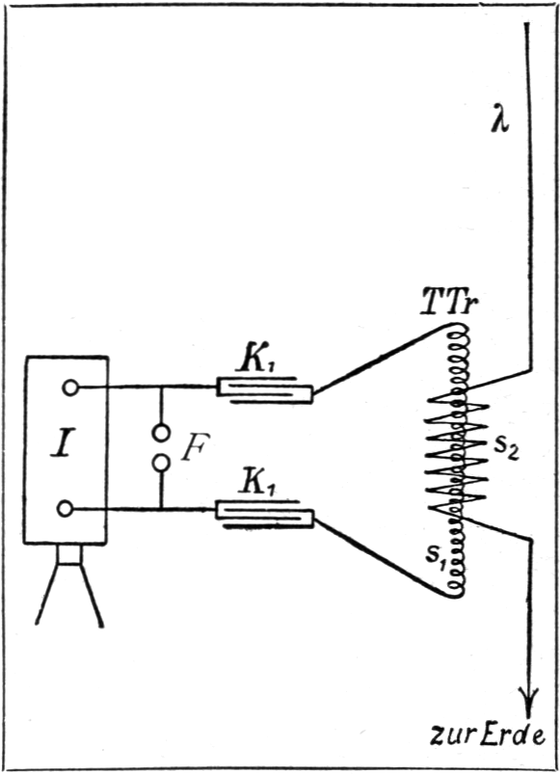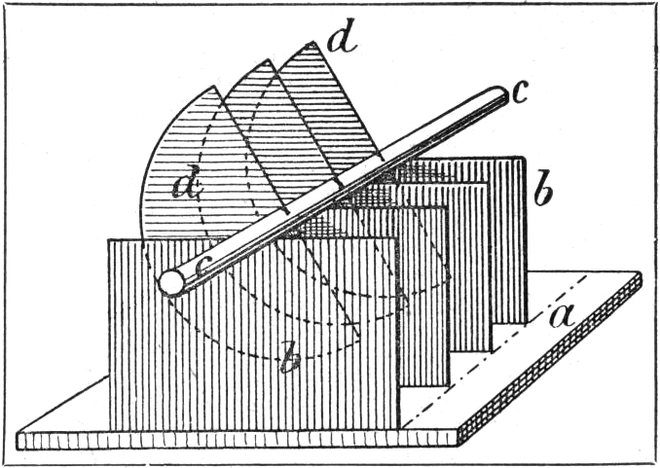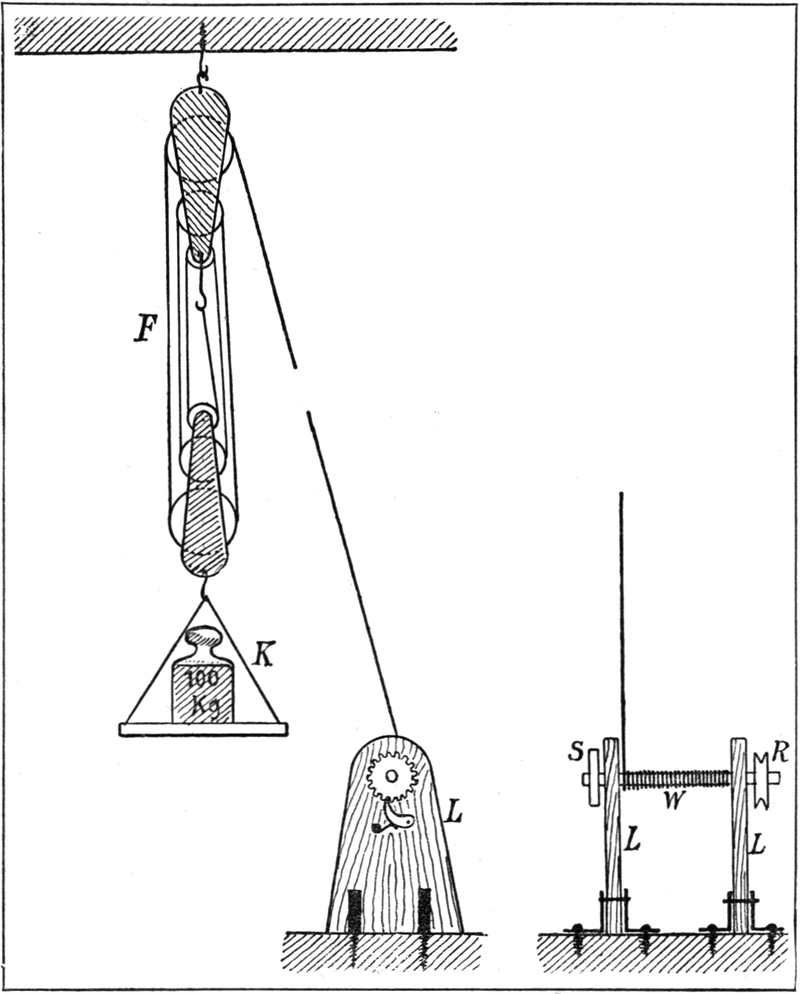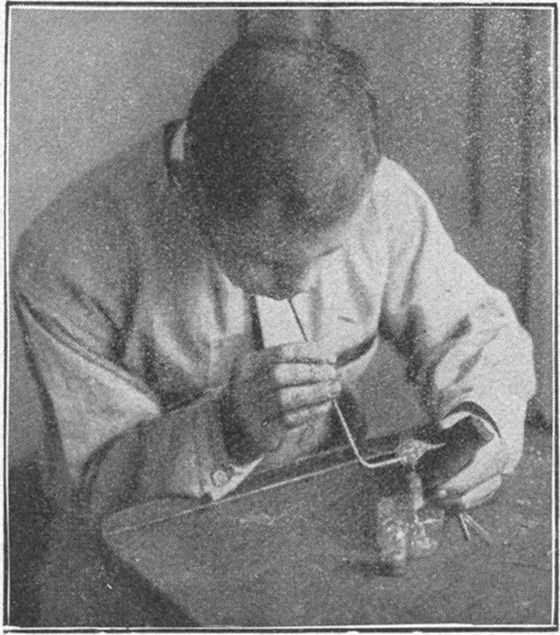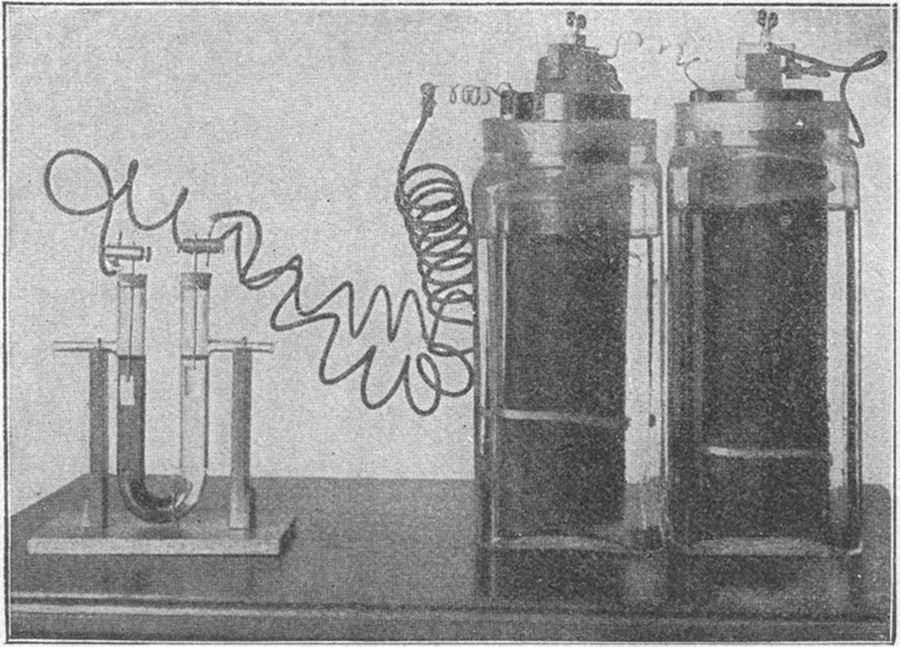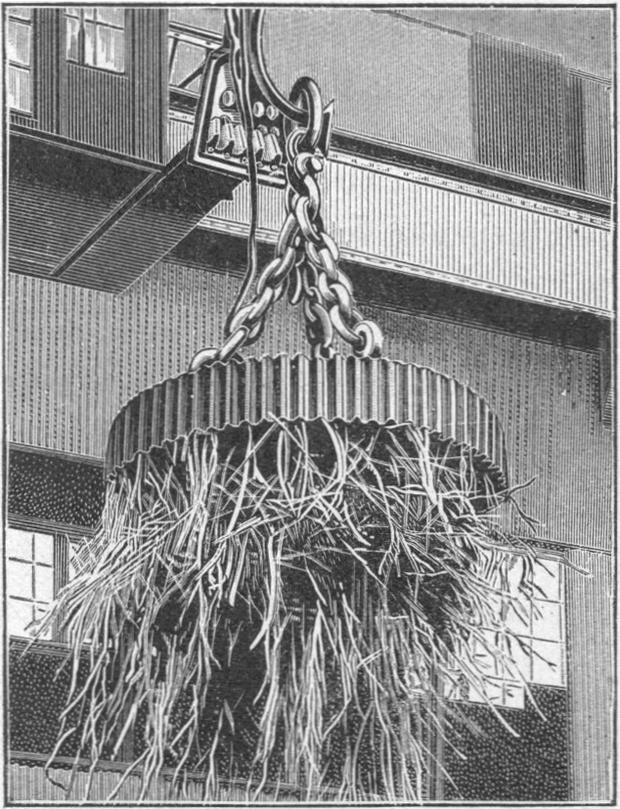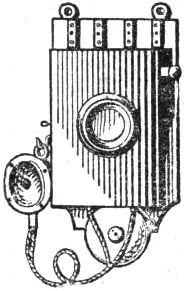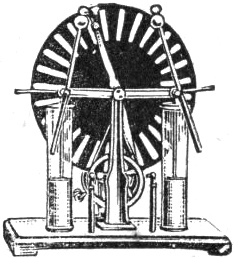The Project Gutenberg eBook of Elektrotechnisches Experimentierbuch, by Eberhard Schnetzler
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms
of the Project Gutenberg License included with this eBook or online
at
www.gutenberg.org. If you
are not located in the United States, you will have to check the laws of the
country where you are located before using this eBook.
Title: Elektrotechnisches Experimentierbuch
Eine Anleitung zur Ausführung elektrotechnischer Experimente unter Verwendung einfachster, meist selbst herzustellender Hilfsmittel
Author: Eberhard Schnetzler
Release Date: December 11, 2022 [eBook #69522]
Language: German
Produced by: the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net
*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ELEKTROTECHNISCHES EXPERIMENTIERBUCH ***
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von
1909 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische
Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute
nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original
unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.
Die Fußnoten wurden an das Ende des jeweiligen Kapitels
verschoben. Als Multiplikationszeichen wurde im Original ein Punkt
auf der Grundlinine (.) eingesetzt; in der vorliegenden Version
wird für dieses Zeichen der mittig gesetzte Punkt (·) verwendet, um
Verwechslungen mit einem Punkt am Satzende vorzubeugen.
Das Original wurde in Frakturschrift gesetzt; Passagen
in Antiquaschrift werden kursiv dargestellt.
Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät
installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in
serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt
erscheinen.
Elektrotechnisches
Experimentierbuch
Eine Anleitung zur Ausführung elektrotechnischer
Experimente unter Verwendung einfachster, meist
selbst herzustellender Hilfsmittel.
Von Eberhard Schnetzler.
Mit 250 Abbildungen.
Einundzwanzigste neubearbeitete Auflage.
Stuttgart, Berlin, Leipzig.
Union Deutsche Verlagsgesellschaft.
Alle Rechte,
insbesondere das der Übersetzung wie der sämtlichen
im Werke mitgeteilten Original-Konstruktionen vorbehalten.
Druck und Copyright 1909 der Union Deutsche
Verlagsgesellschaft in Stuttgart.
Bei der Ausarbeitung vorliegenden Buches war ich erstens bestrebt,
eine klare Anleitung zur Ausführung von Experimenten zu geben;
zweitens sollten die physikalischen Vorgänge soweit wissenschaftlich
erklärt werden, als es dem Zwecke des für die Jugend bestimmten
Buches entsprechen konnte; drittens habe ich dem Umstande Rechnung
getragen, daß unsere jungen Physiker sich oft mit sehr geringen Mitteln
begnügen müssen; ich habe deshalb bei jedem Kapitel eine eingehende
Beschreibung der Selbstherstellung der nötigen Apparate gegeben
und auch hierbei wieder keine zu großen Anforderungen an den Besitz
von Werkzeugen oder gar Werkzeugmaschinen gestellt. Diese Anleitungen
sind die Ergebnisse praktischer Erfahrungen; nach Möglichkeit
habe ich ungeprüfte Ideen vermieden, da sie fast nie einer wirklichen
Ausführung entsprechen.
Um den drei Teilen: Anfertigung der Apparate, Ausführung der
Experimente und theoretische Erklärung derselben durch das ganze
Buch hindurch einen inneren Zusammenhang zu geben, erkläre ich in
erzählender Form, wie sich ein Knabe, Rudi, Apparate herstellt für
Experimentalvorträge, die er vor einem Auditorium von Verwandten hält,
wie er in diesen Vorträgen die Experimente ausführt, und wie er die
Vorgänge erklärt. Was sich in diese Form nicht einpassen ließ, aber
dennoch nicht fehlen durfte, ist in einem Anhange nachgetragen.
Ich kann dem jungen Leser nichts näher ans Herz legen, als durch
Abhalten kleiner Vorträge sich selbst in[S. iv] seiner Liebhaberwissenschaft
zu prüfen; denn: docendo discimus. Ein zweiter Vorteil ist hierbei
auch der Umstand, daß man gezwungen ist, auf ein bestimmtes Ziel
hinzuarbeiten; das Experimentieren des jungen Physikers verliert dann
den Charakter der gedankenlosen Spielerei, den es sonst so oft trägt,
und macht seine Arbeit zu einer angenehmen, unterhaltenden, aber
dennoch ernsten und Nutzen bringenden.
Da die ersten Auflagen des Buches bei den jungen Physikern so großen
Anklang gefunden haben, sah ich mich veranlaßt, das Buch einer erneuten
Durchsicht zu unterziehen. Nur weniges, das sich als überflüssig
zeigte, konnte gestrichen werden, dafür mußte Neues, Wichtigeres an die
Stelle treten. Auch mußten manche älteren Versuchsanordnungen durch
neuere ersetzt werden, entsprechend den Fortschritten der Physik und
Elektrotechnik. Auch wurde der Bau einiger Apparate neu beschrieben.
Eberhard Schnetzler.
Inhalt.
|
|
Seite
|
|
1. Vortrag
|
Reibungs- und Influenzelektrizität
|
|
|
2. Vortrag
|
Der galvanische Strom
|
|
|
3. Vortrag
|
Die praktische Anwendung des elektrischen
Gleichstroms
|
|
|
4. Vortrag
|
Induktions- und Wechselströme
|
|
|
5. Vortrag
|
Von der Geissler- zur Röntgenröhre
|
|
|
6. Vortrag
|
Elektrische Schwingungen
|
|
|
|
Anhang
|
|
|
|
Telephonanlage
|
|
|
|
Rheostate
|
|
|
|
Taschenakkumulator
|
|
|
|
Universal-Volt-Ampere-Meter
|
|
|
|
Elektroskop
|
|
|
|
Anlage für Funkentelegraphie
|
|
|
|
Kraftmaschine mit Gewicht
|
|
|
|
Alphabetisches Sachregister
|
|
|
|
Verzeichnis der Abbildungen
|
|

Es war ein schwüler, heißer Sonntagnachmittag, als unser Rudi in seinem
Dachkämmerchen, das er sich zur Werkstätte eingerichtet hatte, unwillig
die Werkzeuge beiseite legte: „Heute ist es da oben zu heiß,“ seufzte
er und ging hinunter in die Wohnung, um zu sehen, was denn seine
Geschwister machten. Er hatte noch zwei ältere Schwestern und einen
jüngeren Bruder; er fand sie alle drei beisammensitzen und sich eifrig
damit beschäftigen, eine Siegellackstange zu reiben und dann damit
kleine Papierschnitzelchen anzuziehen. Mit einiger Selbstgefälligkeit
fragte er, ob sie denn überhaupt wüßten, was sie da machten, und woher
das käme, daß diese Papierschnitzel von dem geriebenen Siegellack
angezogen würden. „Ja, der Siegellack wird elektrisch, und die
Elektrizität zieht an,“ meinte eine der Schwestern. Ob dieser naiven
Erklärung lachte Rudi seine Schwester aus, die ihm nun erwiderte: „Wenn
du alles Elektrische so gut verstehst, so könntest du uns auch ab und
zu etwas davon erklären; aber du sitzest den ganzen Tag in deiner
Dachkammer und läßt uns nichts wissen und nichts sehen von deinen
Experimenten.“ — „Und wenn man einmal hinaufkommt,“ meinte die jüngere
Schwester, „dann sieht man überall mit großen Buchstaben geschrieben:
‚Berühren gefährlich‘, oder ‚Vorsicht, geladen‘, oder ‚Gift‘; man
traut sich kaum, etwas anzusehen.“ — „Ja, das ist gar nicht schön
von dir,“ fiel der kleine Karl ein, und nun entspann sich ein kleiner
Streit zwischen den Kindern, in dem Rudi angeschuldigt wurde, daß
er seine Geschwister vernachlässige. Da kam zur rechten Zeit die
Mutter dazwischen und schlichtete den Streit. Sie machte nun Rudi den
Vorschlag, er solle in einer Reihe von kleinen Experimentalvorträgen[S. 2]
sie über die Geheimnisse seiner Spezialwissenschaft belehren.
Das war für Rudi ein neuer Gedanke, der ihn nun ganz fesselte. Er ging
gleich auf seine „Bude“, wie er sein Zimmer nannte, setzte sich in
den bequemsten Stuhl und besann sich nun, über was er seinen ersten
Experimentalvortrag halten und wen er dazu einladen sollte.
Da er ein kluger und ruhig überlegender Kopf war, so hielt er es
für das beste, mit dem Einfachsten anzufangen. „Reibungs- und
Influenzelektrizität,“ meinte er, „das wird wohl reichen für einen
Vortrag.“ Nun kam ihm aber ein Bedenken: er hatte ja gar nicht genug
Apparate für einen solchen Vortrag; aber auch das war schließlich kein
Hinderungsgrund für einen Jungen, der dem Grundsatz huldigte: „Hat man
keines, so macht man eines.“ Er stellte sich also zusammen, was er an
Apparaten schon habe, und was er sich noch machen müsse.
Eine Reibungselektrisiermaschine, ein Elektrophor, ein Elektroskop und
zwei Leidener Flaschen hatte er sich schon hergestellt; es fehlten ihm
nur noch eine Influenzelektrisiermaschine und einige zur Demonstration
besonders geeignete Apparate. So brauchte er zwei genügend große
Gestelle zum Aufhängen von elektrischen Pendeln und einen sogenannten
Konduktor, um die elektrische Verteilung zeigen zu können, ferner einen
Apparat zum Nachweis der ausschließlich oberflächlichen Verteilung
der Elektrizität auf Leitern. Außerdem wollte er auch zeigen, daß die
Elektrizität Wärme erzeugen könne; auch hierzu mußte er sich einen
geeigneten Apparat machen, und die Franklinsche Tafel durfte natürlich
nicht fehlen.
Wir wollen nun zunächst sehen, wie Rudi sich die
Reibungselektrisiermaschine und die Leidener Flaschen hergestellt hat
und wie man sich die übrigen Apparate mit einfachen Mitteln ohne große
Kosten herrichten kann.
Glas, Hartgummi, Holundermark.
Eine rote Siegellackstange, einen Hartgummistab, der aber auch durch
einen Hartgummikamm oder -federhalter ersetzt werden kann, sowie einen
Glasstab und einige Holundermarkkügelchen muß man sich kaufen.[S. 3] Glas
und Hartgummigegenstände beschafft man sich am besten und sichersten
bei einem Mechaniker. Das Holundermark kann man auch selbst gewinnen:
Im Winter sammelt man einige starke einjährige Triebe und macht das
Mark durch Abspalten des Holzes frei. Mit einem scharfen Messer werden
die Kügelchen roh geschnitzt und schließlich durch Rollen zwischen den
Händen schön rund gemacht.
Seide.
Außerdem brauchen wir eine Anzahl guter Seidenfäden. Nicht alle
Sorten sind gleich gut, da sehr oft das zum Färben verwandte Pigment
metallhaltig ist. Die äußere Seidenumspinnung der elektrischen
Leitungsschnüre (meist grün) ist ziemlich zuverlässig; man wickelt
davon einen Strang, etwa 30 bis 40 cm, ab und auf ein Stückchen
Karton auf.
Elektrisches Pendel.
Zwei Gestelle für die elektrischen Pendel werden folgendermaßen
hergestellt: Man richtet sich ein kreisrundes Brettchen von 10
cm Durchmesser und 1 cm Dicke, rundet die Kanten mit
Feile und Glaspapier ab und klebt auf die Unterseite an drei Stellen
nahe dem Rande je ein 3 bis 4 mm starkes Korkscheibchen fest.
Aus 2 mm starkem Eisen- oder besser Messingdraht biegen wir nun
einen Bügel, dessen Maße, Form und Befestigungsart wohl zur Genüge aus
Abb. 1 hervorgehen.
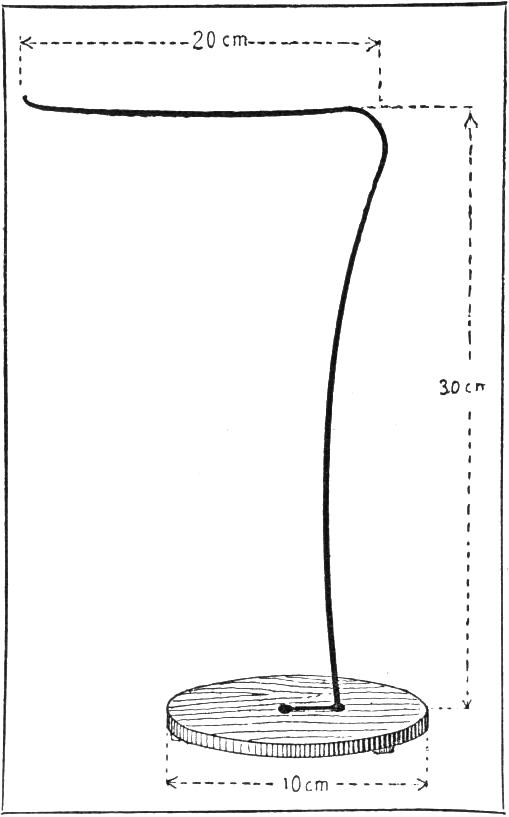
Abb. 1. Gestell zum elektrischen Pendel.
Verwendung von Messing.
Es sei an dieser Stelle gleich noch einiges über die Verwendung von
Messing gesagt. Messing ist nicht gerade billig und kann wohl meistens
durch Eisen ersetzt werden. Da es sich aber viel[S. 4] leichter bearbeiten
läßt als Eisen und nicht rostet, so wird man es in den meisten
Fällen diesem vorziehen. Außerdem sind die blanken Messingteile an
physikalischen Apparaten viel schöner; sie sind leicht zu reinigen und
machen dann durch ihren Glanz einen erfreulichen, sauberen Eindruck.
Eisen darf oft wegen seiner magnetischen Eigenschaften gar nicht
verwendet werden.
Elektrophor.
Elektrophore können auf sehr verschiedene Arten hergestellt werden;
es sei hier nur eine angegeben; die Anfertigung erfordert einige
Aufmerksamkeit, sichert aber schließlich ein zweifellos gutes Resultat.
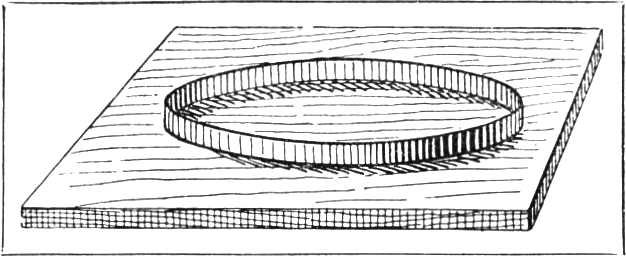
Abb. 2. Form zum Elektrophor.
Wir machen uns aus starkem Papier, etwa Packpapier, einen
kuchenblechförmigen Behälter, 20 bis 30 cm im Durchmesser, 1
bis 1,5 cm hoch. Während der Boden nur eine Lage stark zu sein
braucht, muß das Papier für den Rand mindestens fünffach genommen
werden. Zum Gießen muß die Form auf eine ebene Unterlage gestellt
werden, und der Boden darf keine Falten werfen. — Eine bessere Form
erhält man, wenn man auf ein völlig ebenes und glattes Brett ein
kreisrundes, ziemlich starkes und völlig glattes Stanniolblatt legt und
darum herum einen Papierrand wie oben aufklebt (Abb. 2).
Die Herstellung der Masse erfordert nun einige Sorgfalt: Wir wägen 5
Teile (ca. 250 g) ungebleichten Schellack, 1 Teil Terpentin
und 1 Teil Wachs ab. In einer reinen Pfanne werden zuerst über
mäßigem Feuer das Wachs und das Terpentin zusammengeschmolzen; dann
wird bei stärkerer Hitze und unter ständigem Umrühren mit einem
Glasstabe der Schellack ganz langsam in kleinen Portionen zugegeben;
man warte mit der folgenden Portion jeweils so lange, bis die
vorausgegangene völlig vergangen ist. Ist so aller Schellack
zusammengeschmolzen, so nimmt man das Gefäß vom Feuer und läßt es ein
paar Minuten ruhig stehen. Zum Gusse muß die Form ein wenig angewärmt[S. 5]
und völlig eben gestellt worden sein. Nun wird die Masse langsam
eingegossen und die etwa entstehenden größeren Luftblasen werden mit
dem Glasstabe beseitigt. Ist alle Masse eingelaufen und gleichmäßig
verteilt, so darf sie vor dem völligen Erkalten nicht mehr berührt
werden. Am sichersten ist es, man läßt sie 5 bis 6 Stunden stehen; nun
wird der Papierrand abgerissen, und etwa zurückbleibende Papierreste
werden mit kaltem Wasser abgewaschen. Der Stanniolbelag auf dem
Boden wird sorgfältig abgezogen, und die Kanten rundet man mit Messer
und Feile säuberlich ab. Zum Gebrauche nehme man die Seite nach
oben, welche beim Gusse unten war.
Den Deckel für das Elektrophor kann man auf verschiedene Arten
herstellen. Er soll etwa 3 cm kleiner sein als der Kuchen
und kann aus Messing-, Kupfer- oder Zinkblech gefertigt werden: man
schneidet eine kreisrunde Scheibe und wölbt durch Hämmern den Rand
etwas nach oben, doch achte man sehr darauf, daß die Scheibe selbst
völlig eben bleibe. In der Mitte der Scheibe wird ein Stückchen
Messingrohr mit etwa 1 cm lichter Weite aufgelötet und in dieses
ein Glasstab eingekittet.
Schellackkitt.
Als Kitt kann gewöhnlicher roter Siegellack verwendet werden; besser,
aber etwas schwieriger herzustellen ist der Schellackkitt: Man gibt
in einen großen Blechlöffel oder in ein kleines Pfännchen etwa drei
Teelöffel Schellacklösung — Schellack wird in Weingeist gelöst — und
stellt das Gefäß auf einem großen Eisenblech, welches das Entzünden der
Masse verhindern soll, über die Flamme eines Bunsenbrenners.
Sobald die Lösung heiß geworden ist, wird ungelöster Schellack
beigegeben, und zwar so viel, bis eine dickflüssige Masse entstanden
ist. Nun gießt man noch einige Tropfen Spiritus zu, rührt mit einem
Glasstab um, zündet die Masse an, bringt sie brennend an die
zusammenzukittenden Teile, die schon vorher etwas angewärmt werden
mußten, und bläst dann sofort die Flamme aus; man hat nun noch Zeit,
die einzelnen Teile in die richtige Stellung zueinander zu bringen;
war das Verhältnis von geschmolzenem und gelöstem Schellack richtig,
so ist der Kitt nach 12 bis[S. 6] 24 Stunden trocken und ohne spröde zu
sein derartig fest, daß an ein Trennen der zusammengekitteten Teile
nicht mehr zu denken ist. Dieser Kitt erträgt sogar eine ziemlich hohe
Temperatur, ohne weich zu werden.
Prüfung der Isolierfähigkeit des Glases.
Zum Griff läßt sich nicht jedes Glas gleichgut verwenden, da manche
Sorten schlecht isolieren. Um die Isolierfähigkeit von Glas zu prüfen,
verfährt man folgendermaßen: Man hängt an zwei leinenen
Fäden je ein Holundermarkkügelchen auf und befestigt die Fäden an
der Glasstange. Das Glas muß vorher gründlich gereinigt, dann mit
destilliertem Wasser und endlich mit Weingeist abgewaschen werden.
Ladet man nun die beiden Kügelchen durch Berühren mit einer geriebenen
Siegellackstange negativ elektrisch, so stoßen sie sich ab und dürfen
bei trockenem Wetter während der ersten 20 Minuten sich nur wenig
nähern, wenn das Glas als ein hinreichend guter Isolator gelten soll.
Zuverlässiger ist die Prüfung mit dem Elektroskop, das auf Seite 9
beschrieben ist. Man ladet das Elektroskop und beobachtet, wie weit
die Blättchen in einer bestimmten Zeit zusammengehen; dann ladet man
wieder bis zum gleichen Ausschlag und berührt mit dem Glasstab, den man
fest in der Hand hält, den Knopf des Elektroskopes; gehen jetzt die
Blättchen merklich rascher zusammen, als das erste Mal, so ist das Glas
kein guter Isolator.
Wir können uns auch noch auf eine etwas einfachere Art einen
Elektrophordeckel herstellen: Wir überziehen eine Scheibe aus starker
Pappe sorgfältig mit Stanniol, das wir mit dem Eiweiß eines ungekochten
Eies aufleimen. Als Griff verwenden wir hierbei drei Seidenfäden, die
wir am einen Ende zusammenknüpfen; die drei freien Enden werden an der
Pappescheibe befestigt.
Konduktor.
Abb. 3 zeigt den Konduktor; er besteht aus einem viereckigen Brettchen
(a), das an den Ecken mit Korkstollen versehen ist, aus dem
Glasfuß (b), der mit Siegellack in ein entsprechendes Loch des
Grundbrettes eingekittet ist, und dem oberen, metallenen Teil; diesen
stellen wir uns aus einer etwa 3 cm weiten und 15 cm
langen Messingröhre her (c). Nun beschaffen wir[S. 7] uns zwei
messingene Herdkugeln (d, d), deren Durchmesser etwa
5 mm größer ist als der der Röhre, und welche so in diese
eingelötet werden, daß die Ansätze der Kugeln nach innen kommen. An
der Mitte wird nun noch ein etwa 2 cm langes Messingröhrchen
(e) angelötet, in welches das obere Ende des Glasstabes
eingekittet wird. Statt Messing zu verwenden, kann man sich auch den
oberen Teil des Konduktors bei einem Drechsler von Holz drehen lassen;
dieser Teil wird dann sorgfältig mit Stanniol überklebt, oder mit
Graphitstaub eingepinselt und dann galvanisch verkupfert.
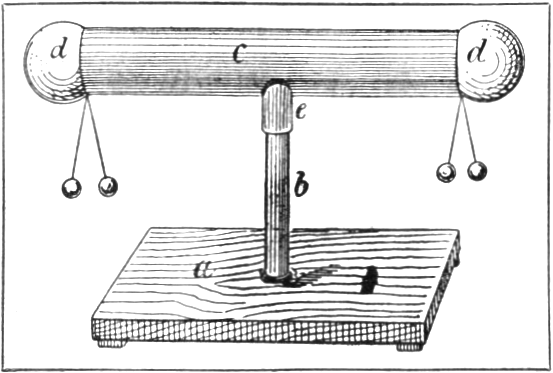
Abb. 3. Konduktor.
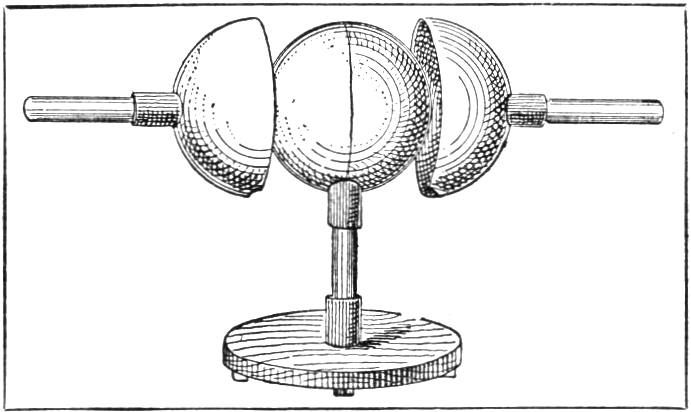
Abb. 4. Messingkugeln für den Konduktor.
Grosse Messingkugeln.
Nun sollten wir noch eine Messingkugel von etwa 7 cm Durchmesser
haben; diese sind oft sehr schwer zu beschaffen, aber wir können uns
auch hier mit einer mit Stanniol zu überziehenden Holzkugel begnügen.
Man kann sich aber auch anders helfen: In jedem Metallwaren- oder
Küchengerätegeschäft kann man sich zwei gleichgroße, halbkugelförmige
Messingschöpflöffel kaufen, von denen man die meist angenieteten
Stiele entfernt, die Nietlöcher zu- und die beiden Halbkugeln
aufeinander lötet. Gleichzeitig kauft man sich noch zwei etwas größere
Schöpflöffel, die zusammengelegt einen genügenden Hohlraum bilden,
um die eben erwähnte Kugel völlig zu umhüllen. Auch hier werden die
Stiele entfernt. Die geschlossene Kugel erhält nun noch einen Ansatz
von Messingrohr, in den man den Glasfuß einkittet, der wie[S. 8] bei dem
Konduktor auf einem Holzbrettchen befestigt wird. Die beiden größeren
Halbkugeln erhalten, wie das aus der Abb. 4 zu ersehen ist, je einen
Glasgriff, der in der üblichen Weise befestigt wird. Da man mit ihnen
die Kugel soll völlig umschließen können, so müssen sie da, wo sie den
Fuß der Kugel umfassen sollen, je einen halbkreisförmigen Ausschnitt
von entsprechender Weite erhalten.
Franklinsche Tafel.
Die Franklinsche Tafel: Eine auf ihre Isolierfähigkeit geprüfte
Glastafel 30 : 30 cm groß, bekleben wir beiderseits je mit einem
15 : 15 cm großen Blatt Stanniol, so daß ringsherum ein 7½
cm breiter Rand frei bleibt. Auf ein ovales Brett, 30 cm lang,
12 cm breit, nageln wir zwei 2 cm hohe Leistchen auf,
die um etwa 2 mm mehr, als die Glasdicke beträgt, voneinander
entfernt sind, und kitten die Scheibe in den so erhaltenen Spalt. Nun
wird noch der freie Glasrand mit dünner Schellacklösung bestrichen.
(Über Schellackbezug siehe bei der Influenzelektrisiermaschine, Seite
20.)
Leidener Flasche.
Die Leidener Flasche: Bevor wir uns eine solche herstellen, wollen
wir sehen, wie wir die guten Glassorten schon äußerlich, soweit
als das überhaupt möglich ist, von den schlechten unterscheiden
können. Betrachten wir ungefärbte Gläser im durchfallenden Lichte,
so erscheinen sie uns meist alle farblos; betrachten wir sie dagegen
auf der Schnittfläche, so scheinen die einen grün, die anderen
blau, seltener rot oder farblos. Gläser, die auf der Schnitt- oder
Bruchfläche bläulich oder rötlich erscheinen, sind von vornherein
für elektrische Zwecke unbrauchbar. Grünliches Glas, gewöhnliches
Fensterglas, ist oft recht gut; am sichersten geht man mit farblosem;
doch unterlasse man auch hier nicht, die zu verwendenden Gläser erst
auf ihre Isolierfähigkeit nach der oben angegebenen Methode zu prüfen.
Für Leidener Flaschen, an die keine allzugroßen Anforderungen gestellt
werden, kann man gewöhnliche Einmachgläser gut verwenden. Diese werden
gründlich gereinigt und zuletzt mit etwas Weingeist abgewaschen. Nun
wird das Stanniol zuerst innen, dann außen möglichst blasen- und
faltenlos mit Eiweiß aufgeklebt. Wer nicht sehr[S. 9] gewandt ist,
wird gut daran tun, den Belag nicht in einem Stück aufzukleben, sondern
in etwa 5 bis 10 cm breiten Streifen. Die Höhe des Belags
soll bei kleinen Flaschen ¾, bei großen ⅔ der Gesamthöhe der Flasche
betragen. Der oben frei gebliebene Glasrand wird mit einem dünnen
Schellacküberzug versehen. Ähnlich wie es nachher beim Elektroskope
beschrieben ist, wird hier eine mit einer Messingkugel versehene
Metallstange in der Flasche befestigt. Um das untere Ende dieser Stange
wird ein aus mehreren Stanniolstreifen bestehendes Büschel herumgelegt
und mit Bindfaden befestigt; die freien Enden dieser Streifen sollen
auf dem Boden der Flasche aufliegen.
Wir können uns auch aus großen Reagenzgläsern eine große Anzahl kleiner
Leidener Flaschen machen und sie zu einer Batterie zusammenstellen,
indem wir alle inneren Beläge miteinander verbinden und ebenso alle
äußeren.
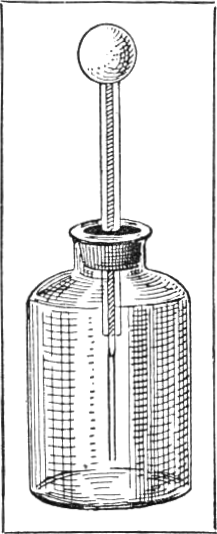
Abb. 5. Elektroskop.
Elektroskop.
Zur Herstellung eines Elektroskopes brauchen wir eine etwa 10 cm
hohe, 7 cm breite, sehr gut isolierende Flasche mit nicht zu
engem Hals. Ein etwa 5 mm starkes Messingstängchen wird an
einem Ende meißelartig zugefeilt und an das andere Ende wird eine
Messingkugel oder ein Blechscheibchen, dessen Rand abgerundet ist,
aufgelötet. Nun wird diese Messingstange in ein Glasrohr gesteckt,
in das sie aber nur knapp hineingehen soll, und das so lang sein
muß, daß nur das zugeschärfte Ende frei bleibt. Ein Kork, der gut
auf die Flasche paßt, erhält ein Loch, durch das die Glasröhre mit
der Messingstange so weit hindurchgesteckt wird, daß das untere Ende
der Stange etwa 7 cm vom Boden der Flasche entfernt ist. Aus
ganz dünnem Stanniol, oder besser aus unechtem Blattgold schneiden
wir uns zwei 4 mm breite, 5 cm lange Streifen, die man
übrigens auch von einem Goldschläger vorrätig beziehen kann, und kleben
sie mit einer möglichst geringen Spur von Eiweiß so auf den beiden
zugeschärften Seiten der Messingstange an, daß sie dicht nebeneinander[S. 10]
und parallel zueinander herunterhängen. Die Arbeit des Aufhängens
der Blättchen erfordert vollkommen ruhige Luft; man halte womöglich
auch den Atem an. Die Abb. 5 zeigt das fertige Elektroskop. (Über die
Herstellung eines feineren Instrumentes siehe im Anhang.)
Reibungselektrisiermaschine.
Nun wollen wir sehen, wie sich Rudi seine Reibungselektrisiermaschine
mit verhältnismäßig wenig Mitteln hergestellt hat. — Zuerst sah
er sich nach einer geeigneten Scheibe um. Sich eine solche bei dem
Mechaniker zu kaufen, war ihm zu teuer. Da er einmal einen alten, schon
mehrfach gesprungenen Spiegel in der Gerätekammer gesehen hatte, so
fragte er seine Mutter, ob er diesen für seine Zwecke verwenden dürfte,
und er erhielt die Erlaubnis. Ein ziemlich großes Stück des Glases war
noch unbeschädigt; dies trug er zum Glaser und ließ es sich zu einer
runden Scheibe schneiden, die einen Durchmesser von 30 cm bekam.
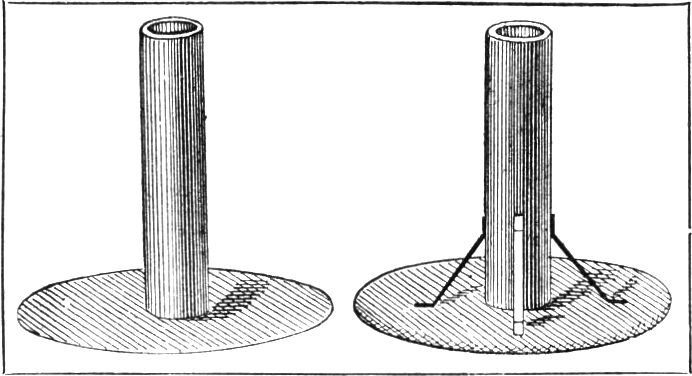
Abb. 6. Angelötete Scheibe.
Abb. 7. Die Stützen des Rohrs.
Befestigung der Achsen an Glasscheiben.
Nun schabte er mit einem alten Messer den Quecksilberbelag ab und ging
mit der Scheibe zu einem Glasgraveur, um sich ein Loch in die Mitte der
Platte bohren zu lassen. Da der Graveur aber keine Garantie für die
Platte übernehmen wollte und sagte, bei dem Bohren springe jede dritte
Platte, so besann sich Rudi, wie er diesem Übel abhelfen könnte. Mit
Flußsäure ätzen, das wäre ihm bei dem dicken Glase zu langsam gegangen;
aber er hatte eine andere Idee: ließe sich denn nicht die Notwendigkeit
eines Loches umgehen? Gewiß, und zwar ganz leicht. Triumphierend über
den guten Einfall ging nun Rudi mit seiner Scheibe wieder nach Hause.
Hier suchte er zuerst nach einer geeigneten Metallstange oder Röhre
für die Achse und fand dann auch ein 20 cm langes und 1,5
cm dickes Stück eines Gasrohres, das er in zwei gleiche Teile
auseinandersägte, worauf er die Schnittränder völlig eben feilte. Nun
schnitt sich Rudi aus 1 bis 2 mm starkem Messingblech zwei 6
cm große Scheiben aus und lötete sie so auf die eben gefeilte
Schnittfläche, wie es Abb. 6 zeigt; dabei mußte er besonders[S. 11] darauf
achten, daß die Längsachse des Rohres völlig senkrecht auf der Ebene
der Blechscheibe stand; um einem Verbiegen der Blechscheibe gegen die
Achse vorzubeugen, lötete er vier 3 mm breite Blechstreifen
so an die Scheibe einerseits und an dem Rohr anderseits an, wie dies
in Abb. 7 zu erkennen ist. Den Rand der Blechscheibe krümmte er mit
einer Flachzange etwas von der Achse weg um, wie dies ebenfalls aus
der Abb. 7 hervorgeht. Nachdem nun so zwei völlig gleiche Achsenstücke
hergestellt waren, bezeichnete Rudi den Mittelpunkt der Scheibe mit
einem kleinen Tintenpunkt; er hatte die Mitte mit Hilfe der beiden
Mittelsenkrechten zweier Sehnen gefunden. Nun bereitete er sich einen
Schellackkitt, wie dies Seite 5 schon beschrieben wurde, goß davon in
genügender Menge um den Mittelpunkt der Scheibe herum und drückte die
Blechscheibe mit der angelöteten Achse darauf; dann bemühte er sich,
diese noch möglichst senkrecht zur Glasscheibe zu stellen. Allein sein
Bemühen war vergebens, denn der Kitt war zu rasch hart geworden. Nun
hieß es, die Achse nochmals von der Scheibe los zu bekommen; Erwärmen
hätte nicht viel geholfen und zudem die Glasscheibe gefährdet; den
Schellack mit Spiritus aufzulösen ging auch nicht, da er zum größten
Teil unter der Blechscheibe lag. Rudi versuchte nun mit einem spitzen
Instrument zwischen Glas- und Blechscheibe einzudringen; dies brachte
ihm schließlich Erfolg. Er befreite beide Scheiben von dem alten
Schellack und begann die Arbeit von neuem. Was für Fehler trugen nun
an dem Mißerfolge die Schuld? Erstens hatte er den Schellackkitt beim
Auftragen zu lange brennen lassen; dadurch war nicht nur zu viel
Spiritus verbrannt, sondern der geschmolzene Schellack war überhitzt
worden, was ihn in eine fast unschmelzbare[S. 12] harte Masse verwandelte.
Zweitens hätten beide Gegenstände, Glas- und Messingscheibe, etwas
vorgewärmt werden müssen; doch daß er letzteres vergessen hatte, war
sein Glück, denn sonst wäre es ihm wohl kaum noch gelungen, die beiden
Teile unbeschädigt wieder zu trennen. Beim zweiten Versuch gelang
ihm nun das Zusammenkitten zu voller Zufriedenheit. Er hatte sich
diesmal auch einer recht praktischen Hilfseinrichtung zum raschen
Senkrechtstellen der Achse bedient: Er machte sich aus starker Pappe
ein Winkelscheit, dessen Form aus Abb. 8 hervorgeht; der Ausschnitt
im Scheitel des rechten Winkels dient dazu, daß das Winkelscheit,
ohne durch die Messingscheibe behindert zu werden, sowohl auf der
Glasplatte, als auch an der Achse angelegt werden kann; sobald er die
Achse auf den Schellack aufgedrückt hatte, überzeugte er sich mittels
dieses Winkelscheites von ihrer richtigen Stellung. In der gleichen
Weise befestigte Rudi die andere Achse, genau in der Verlängerung der
ersten.
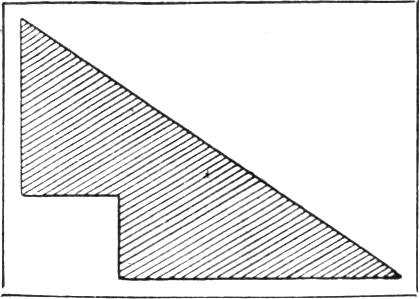
Abb. 8. Winkelscheit.
Glasätzen mit Flusssäure.
Für solche, die es vorziehen, das Loch durch die Platte mit Flußsäure
zu ätzen, sei erwähnt, daß mit Flußsäure sehr vorsichtig
umgegangen werden muß, schon weil ihre Dämpfe den Schleimhäuten des
Mundes und der Nase äußerst gefährlich sind, und weil sie, auf die
Haut gebracht, sehr bösartige Wunden verursacht. Sie wird in Gummi-
oder Bleigefäßen aufbewahrt und ist in jedem Geschäft, das Chemikalien
führt, zu haben. Es ist sehr zu empfehlen, beim Hantieren mit dieser
Säure ein Fläschchen mit konzentriertem Ammoniak bereitzustellen; ist
von der Säure etwas an einen unrichtigen Platz gekommen, so gießt man
reichlich Ammoniak zu, wodurch ein Schaden sicher verhindert wird.
Um ein Loch in die Platte zu ätzen, muß man erst die ganze
Platte auf beiden Seiten mit einer Wachsschicht überziehen und dann an
der Stelle und in der Größe des[S. 13] erwünschten Loches das Wachs abschaben
und den Wachsrand noch bis zu 5 mm wallartig erhöhen. In das
dadurch entstandene Näpfchen wird nun Flußsäure gegossen und mit einem
Papierhütchen wird es zugedeckt. So bleibt dann die Platte etwa 2
Stunden liegen, nach welcher Zeit das angeätzte Glas mit einem Nagel
oder sonst einem spitzen Gegenstand aufgeschabt wird; dies wird alle 2
bis 3 Stunden wiederholt. Über Nacht läßt man stehen; am nächsten Tag
wird mit Fließpapier die noch vorhandene Flüssigkeit aufgesaugt und
durch frische Flußsäure ersetzt. Dies setzt man fort, bis ungefähr die
Hälfte der Glasdicke durchgeätzt ist, und beginnt dann mit dem gleichen
Verfahren von der anderen Seite.
Hat man also eine durchbohrte Scheibe, so kann man die Achse aus einem
Stück machen. Etwas mehr als halbe Glasdicke neben der Mitte der Achse
wird auf diese eine Messingscheibe aufgeschoben und angelötet, und
daran wird nun die Glasscheibe mit Schellack angekittet. Dann wird eine
zweite Messingscheibe auf die Achse geschoben und auf der Glasplatte
festgekittet; diese auch noch an der Achse anzulöten ist unnötig.
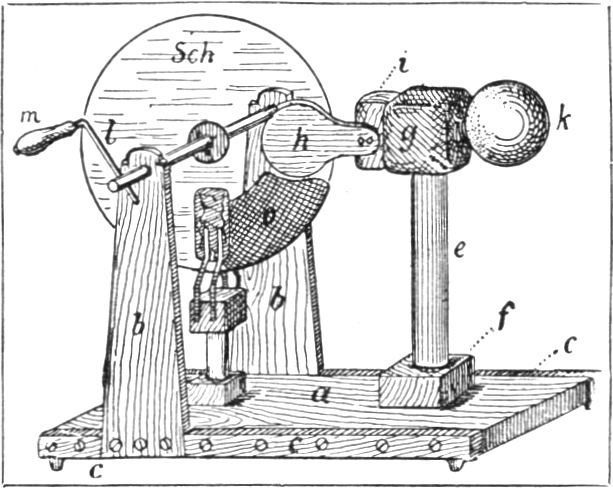
Abb. 9. Reibungselektrisiermaschine.
Nachdem nun Rudi die Achsen in der erwähnten Weise an der Scheibe
angebracht hatte, schritt er zur Anfertigung des Gestelles. Abb. 9
zeigt die fertige Maschine. (Da die einzelnen Maße von der Größe der
Scheibe abhängen, geben wir keine Zahlen an, sondern verweisen nur auf
die aus der Abbildung hervorgehenden Größenverhältnisse.) a
ist ein starkes Brett aus hartem Holz; Rudi hatte zuerst Tannenholz
verwendet; doch da dieses sich nach gar nicht langer Zeit warf,
so mußte er es durch Nußbaumholz ersetzen. Wer dennoch Tannenholz
verwenden[S. 14] will, muß auf der Unterseite mindestens drei Leisten aus
hartem Holz quer zu den Fasern des Brettes aufleimen und anschrauben
(Leimen oder Schrauben allein genügt nicht!); b, b sind
die beiden Lagerträger, die aus Tannenholz gefertigt sein dürfen; sie
werden an die Seiten des Brettes a angeschraubt. Um ihnen noch
mehr Halt zu geben, schraubte Rudi in der Art Leisten an den Rand des
Brettes, daß die Träger gewissermaßen in einer Vertiefung festsaßen.
Die Lager selbst machte er folgendermaßen: er wickelte um die Achse
einen 2 mm starken Kupferdraht, Windung hart an Windung, bis er
auf diese Weise ein 6 cm langes Stück umwunden hatte, das er
von der Achse abstreifte, mit Lötwasser bestrich, mit einem Plättchen
dünn gehämmerten Lotes umgab und so lange in eine Bunsenflamme hielt,
bis alles Lot sich schön zwischen den Windungen verteilt hatte. Es
war so ein Röhrchen entstanden, das er nun in zwei gleiche Teile
zersägte, welche die Achsenlager bilden sollten; als er sie jedoch
wieder auf die Achse schieben wollte, paßten sie nicht mehr darauf,
denn es war etwas zu viel Lot in das Innere gelaufen; dies entfernte
er mit der Rundfeile, bis sie sich ohne zu großen Spielraum aber doch
leicht auf der Achse hin und her schieben ließen. Nun bohrte Rudi in
die oberen Enden der Lagerträger je ein Loch, das so groß war, daß ein
Lagerröhrchen gerade noch hindurchgesteckt werden konnte, und sägte,
die Mitte dieses Loches kreuzend, den oberen Teil des Lagerträgers
ab (siehe Abb. 10). Mit zwei Holzschrauben konnte er diesen wieder
aufschrauben und so das Lagerröhrchen fest einklemmen.
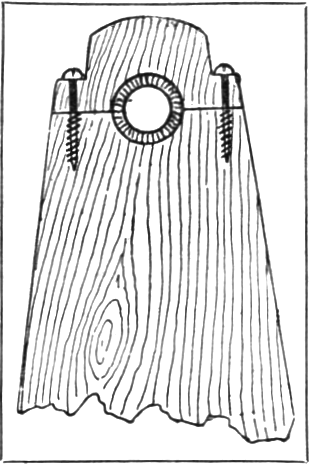
Abb. 10. Lagerträger.
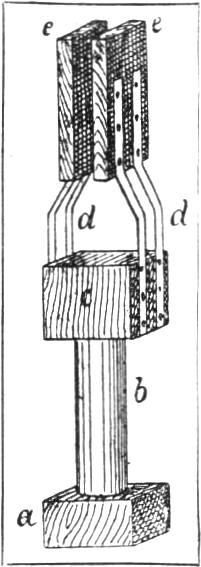
Abb. 11. Gestell des Reibzeugs.
Für die Kurbel benutzte Rudi eine 4 mm starke Eisenstange
(l in Abb. 9), die er rechtwinkelig umbog, worauf er über das
eine Ende einen hohlen Griff (m) stülpte und[S. 15] das andere in das
an dem einen Ende der Achse angebrachte Loch einnietete.
Abb. 11 zeigt das Gestell des Reibzeuges. Hierbei bediente sich Rudi
eines starken massiven Glasstabes (b), den er in den Holzklotz
a fest einkittete; den Holzklotz c machte er etwas höher
und bohrte ein Loch ein, in das der Glasstab nur knapp hineinging; hier
kittete er ihn nicht ein. Nun sägte er sich aus starkem (3 bis
4 mm) Zigarrenkistenholz zwei gleiche rechteckige Brettchen,
deren Länge etwa ⅔ des Scheibendurchmessers betrugen und die halb so
breit als lang waren. Diese Brettchen beklebte er je auf einer Seite
mit einer nicht zu dicken Lage von gewöhnlicher Watte. Dann richtete er
sich aus 1 bis 2 mm starkem Messingblech vier etwa 5 mm
breite Streifen (d in Abb. 11), die er einerseits an dem
Brettchen e, anderseits an c festschraubte und derart
zusammenbog, daß sich die gepolsterten Seiten der Brettchen e,
die nach innen gerichtet waren, berührten.
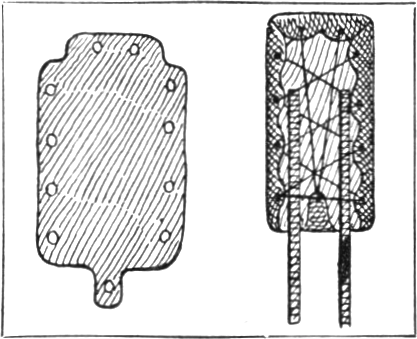
Abb. 12.
Abb. 13.
Reibfläche.
Aus Kalbleder fertigte Rudi die Reibfläche: er schnitt sich zwei
Stücke, deren Form aus Abb. 12 hervorgeht; die Löcher am Rande
dienten dazu, um das Leder auf die in Abb. 13 angegebene Art über
das Reibzeugbrettchen zusammenzuschnüren; er hatte dabei auch nicht
vergessen, daß die Fleischseite des Leders das Glas berühren muß.
Amalgamieren.
Obgleich Rudi die Amalgamierung der Reibkissen erst zuletzt vornahm,
so sei dies doch schon hier beschrieben. Er holte sich das Amalgam bei
einem Mechaniker, hätte es sich aber auch selbst bereiten können: man
schmilzt in einem Tontiegel zuerst 1 Gewichtsteil Zinn, und wenn alles
geschmolzen ist, gibt man in kleinen Stücken 1 Gewichtsteil Zink zu;
hat sich auch dieses alles verflüssigt, so wird der Tiegel vom Feuer
genommen, und es werden unter Umrühren 2 Gewichtsteile Quecksilber,
das vorher etwas angewärmt wurde, zugeschüttet; das Ganze wird nun
unter ständigem, tüchtigem Umrühren[S. 16] — man kann dazu den Stiel einer
Tonpfeife verwenden — in Wasser gegossen. Die dabei entstandenen
Amalgamkörnchen werden zwischen Filtrierpapier getrocknet und in einem
Reibschälchen zu Pulver verrieben. — Mit solchem Amalgam rieb er die
Fleischseite der beiden Lederlappen tüchtig ein und spannte sie dann
wieder auf die Reibzeugbrettchen.
An dem Holzklotze c (Abb. 11) kann man nun entweder eine große
Herdkugel oder eine mit Kugelenden versehene Messingröhre anbringen,
ähnlich der in Abb. 3 dargestellten, aber kürzer als diese; dieser Teil
der Maschine ist in den Abbildungen nicht gezeichnet; Rudi ließ ihn
auch anfangs weg, brachte ihn aber später doch noch an.
Spitzenkamm.
Wir wollen nun noch sehen, wie der Spitzenkamm hergestellt und an der
Maschine angebracht wird. Rudi verwendete als Träger wieder einen
starken Glasstab, doch es genügt hier auch eine starke Glasröhre. Den
Stab kittete er wie bei dem Reibzeug in die Ausbohrung des Klötzchens
f (Abb. 9). Auf ihn setzte er das etwas größere Holz g
und kittete auch dieses, nachdem er das Brettchen i und die
Kugel k daran befestigt und alle seine Kanten und Ecken wohl
abgerundet hatte, fest; k soll möglichst groß sein und kann wie
die in Abb. 4 ersichtliche Kugel des Konduktors hergestellt werden.
Das Brettchen i hatte Rudi nur angeleimt; da es ihm aber später
einmal wegbrach, so ist es ratsam, es mit einer Schwalbenschwanzfuge in
g einzulassen.
Für den Spitzenkamm sägte sich Rudi zwei handspiegelförmige Brettchen
aus Zigarrenkistenholz und schnitt sich zwei gleichgeformte
Pappscheiben; letztere beklebte er beiderseits mit starkem
Stanniolpapier und steckte in je drei konzentrischen Kreisen eine große
Anzahl kurzer Stecknadeln hindurch. Diese stacheligen Pappescheiben
klebte er nun mit der Seite, auf welcher die Köpfe der Stecknadeln
waren, auf dem Holzbrettchen fest, das er an das Brettchen i
anschraubte. Dabei zeigte sich aber, daß sich jetzt die Spitzen so
nahe gegenüberstanden, daß sich die Glasscheibe nicht zwischen ihnen
hätte drehen können, ohne verkratzt zu werden oder die Nadelspitzen
umzubiegen;[S. 17] er legte deshalb zwei kleine Pappestückchen zwischen
i und die Spitzenkämme h, wodurch diese, nachdem sie
wieder befestigt waren, den richtigen Abstand erhielten. Die Kugel
k mußte nun noch mit den Nadeln in leitende Verbindung gebracht
werden; Rudi bohrte durch g in Abb. 9 ein Loch, das hart neben
dem Ansatz von k begann und neben dem Brettchen i bei
dem Ansatz des einen Spitzenkammes endete. Durch dieses Loch führte
er einen Kupferdraht, den er einerseits mit dem Stanniolbelag des
Spitzenkammes in innige Berührung brachte, anderseits an den Ansatz der
Kugel k anlötete.
Nun mußte Rudi noch den Reibzeug- und den Spitzenkammträger auf dem
Grundbrett a befestigen, was er dadurch erreichte, daß er beide
mit je vier Schrauben von unten her an a festschraubte. Das
Reibzeug ließ sich trotzdem noch leicht abnehmen, da ja das Klötzchen
c (Abb. 11) nicht auf b aufgekittet, sondern nur
darübergeschoben war. An diesem Reibzeug befestigte Rudi nachträglich
zwei Flügel aus Seide (man kann auch Wachstaffet verwenden), die sich
beiderseits an die Scheibe anlegen sollten und die an ihrem äußeren
Rande zusammengenäht waren; ihre Form ist aus Abb. 9, o zu
ersehen. Sie sollen verhindern, daß auf dem Wege vom Reibzeuge zum
Spitzenkamme die Glasscheibe von ihrer Elektrizität verlöre.
Zuletzt überzog Rudi alle Holzteile und die beiden Glassäulen mit
Schellackfirnis.
Um diese Maschine vor dem für viele elektrische Apparate sehr
schädlichen Verstauben zu bewahren, fertigte er sich als Schutz aus
starkem Packpapier eine große Hülle, die er, wenn die Maschine nicht
gebraucht wurde, käseglockenartig darüber stülpte.
Elektrisches Flugrad.
Das elektrische Flugrad ist sehr einfach herzustellen: man schneidet
sich aus gewöhnlichem Weiß- oder Messingblech ein rundes Scheibchen,
das man genau in der Mitte mit einem Körnerpunkt versieht; auf dieses
Scheibchen lötet man nach den vier verschiedenen Seiten radial nach
außen gerichtet vier lange Stecknadeln, deren Spitzen dann alle[S. 18]
rechtwinkelig nach der gleichen Seite umgebogen werden. Ein 20
cm langes und 4 bis 5 mm starkes Glasröhrchen wird in ein
Fußbrettchen eingekittet, und mit Siegellack wird eine lange Stecknadel
im oberen Ende befestigt. Das Flugrädchen wird nun mit dem Körnerpunkt
auf die Stecknadelspitze aufgesetzt und muß in horizontaler Lage im
Gleichgewichte schweben; sollte dies nicht zutreffen, so kann man durch
Auftropfen von etwas Siegellack auf die Unterseite des Scheibchens das
Flugrädchen ausbalancieren.
Lanesche Massflasche.
Es sei nun noch die elektrische Maßflasche von Lane erwähnt: auf
einem mit Stanniol überzogenen Grundbrettchen wird eine kleine
Leidener Flasche aufgeleimt oder festgekittet, jedoch so, daß der
äußere Flaschenbelag in leitender Verbindung bleibt mit dem Belag des
Brettchens; 5 cm neben der Flasche wird ein Messingstab in dem
Brette befestigt, der oben in Höhe der Kugel der Leidener Flasche ein
2 bis 3 mm weites Loch erhält, in welchem sich ein entsprechend
starker etwa 10 cm langer Messing- oder Kupferdraht leicht hin
und her schieben läßt; diesen Draht versieht man an dem einen Ende mit
einer Kugel, am anderen biegt man ihn zu einer kleinen Schleife.
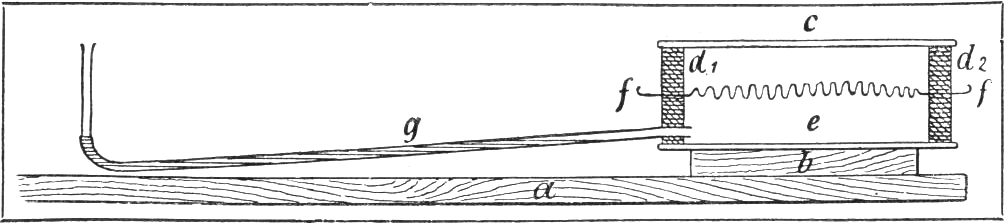
Abb. 14. Luftthermometer.
Luftthermometer.
Nun können wir uns noch einen einfachen Apparat herstellen, mit dem
wir die Erwärmung von Leitern beim Durchgang von Elektrizität durch
sie nachweisen können. Abb. 14 zeigt diesen Apparat im Schnitt:
auf dem Grundbrett a wird ein kleineres Brettchen b
befestigt; darauf wird ein Glaszylinder c aufgekittet. Für
diesen Glaszylinder kann man den Lampenzylinder eines Auerlichtes
verwenden, von dem man sich ein entsprechendes Stück absprengen läßt.
d₁ und d₂ sind zwei in Paraffin gekochte Korke,[S. 19]
durch welche ein innen und außen zu Häkchen f umgebogener Draht
führt; in d₁ ist außerdem noch eine Öffnung, in die die
Glasröhre g einmündet, deren Form aus der Figur hervorgeht;
e ist eine aus dünnem Eisendraht gewundene Spirale. Wer einem
gelegentlichen Durchschmelzen dieser Spirale vorbeugen will, muß
Platindraht verwenden. Die Spirale wird auf folgendem Wege in den
Zylinder gebracht. Sie wird mit ihrem einen Ende in den Haken des
Korkes d₁ eingehakt, worauf dieser, die Spirale voran, in
den Zylinder geschoben wird; nun zieht man von der anderen Seite das
noch freie Ende der Spirale vorsichtig aus dem Zylinder heraus, hakt
es in den Haken von d₂ und drückt darauf d₂ in den
Zylinder. Darauf bringt man in die Glasröhre g etwas gefärbtes
Wasser und steckt sie, wie aus der Abbildung ersichtlich, in die
Öffnung von d₁.
Die Influenzelektrisiermaschine.
Rudi brauchte nun zu seinem Vortrag noch eine
Influenzelektrisiermaschine; diese lieh er sich einstweilen bei
einem Schulkameraden, weil er die Anfertigung dieser Maschine für
später aufschieben mußte. Da es jedoch für manchen jungen Bastler
von Interesse sein wird, zu erfahren, wie man die verschiedenen
Schwierigkeiten, die sich der Selbstanfertigung einer Influenzmaschine
entgegenstellen, leicht umgehen kann, so wollen wir schon jetzt davon
eine Beschreibung geben.
Glasscheiben.
Wir beginnen zunächst mit den Glasscheiben; die Scheiben, die für
Reibungselektrisiermaschinen gut verwendet werden können, sind für
Influenzmaschinen nicht immer die geeignetsten; die Hauptsache ist,
daß das Glas gut isoliert. Wir suchen zuerst, ob wir in unserem
Glasvorrat etwas Geeignetes finden[1]; wenn nicht, dann suchen wir
bei einem Glaser die beste Glassorte aus, wobei auch darauf zu achten
ist, daß die Glastafeln möglichst eben sind. Wir lassen uns nun
zwei kreisrunde Scheiben schneiden, deren Durchmesser womöglich 60
cm, keinesfalls aber weniger als 30 cm betragen darf. Wer
ganz sicher[S. 20] gehen will und größere Auslagen nicht scheut, besorgt sich
die Glasscheiben bei einem Mechaniker oder von Warbrunn, Quilitz u.
Co. zu Berlin, welche Firma auch ausgezeichnete Gläser für Leidener
Flaschen liefert.
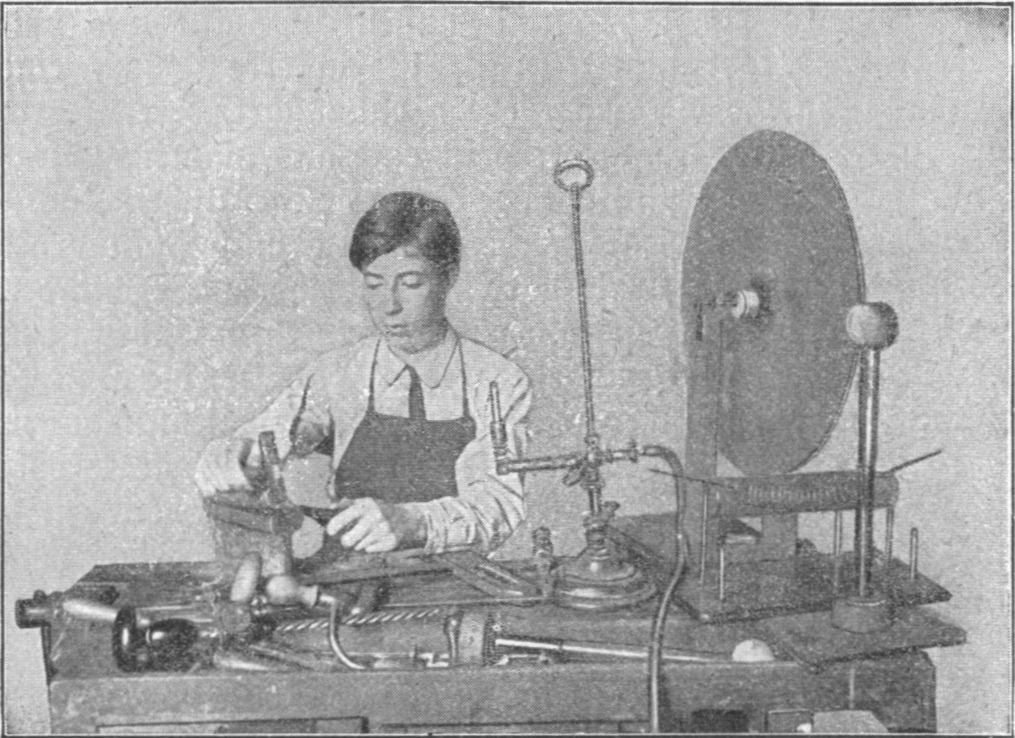
Abb. 15. Rudi bei der Anfertigung einer
Influenzelektrisiermaschine.
Der Schellacküberzug.
Durch die Mittelsenkrechten zweier Sehnen finden wir die Mitten der
Scheiben und bezeichnen sie je mit einem Tuschepünktchen; ist die
Tusche fest aufgetrocknet, so werden die Scheiben zuerst mit Seifen-,
dann mit reinem, gewöhnlichem, endlich mit destilliertem Wasser und
zuletzt mit Weingeist abgewaschen; der Weingeist muß selbst rein sein
und darf nur mit einem ganz reinen Schwämmchen aufgetragen werden.
Die zweite Aufgabe ist, beide Scheiben mit einem feinen Überzug von
Schellackfirnis zu versehen. Wir lassen 30 g Schellack in ¼
Liter Spiritus sich vollständig lösen und gießen kurz vor dem Gebrauch
noch 100 ccm reinen Spiritus zu und schütteln kräftig; die
Lösung wird noch filtriert und ist dann gebrauchsfertig; soll sie
längere Zeit aufbewahrt werden, so lege man, um die Feuchtigkeit
zu binden, ein paar Gelatinestreifen hinein und halte die Flasche
stets gut geschlossen. Das Auftragen der Lösung[S. 21] geschieht mit einem
großen, weichen Pinsel, der vor dem Gebrauch durch Klopfen und
Waschen von allem Staub befreit werden muß. Es ist ziemlich wichtig,
einen schönen gleichmäßigen Schellacküberzug zu erzielen, und es dürfte
wohl manchem nicht auf das erste Mal gelingen. Die Scheibe wird auf
eine Zigarrenkiste oder besser auf eine runde Pappschachtel gelegt,
deren Durchmesser etwa handbreit kleiner ist, als der der Scheibe.
Die Schellacklösung wird in ein offenes Gefäß gegossen. Doch bevor
wir mit dem Überstreichen beginnen, muß die Scheibe angewärmt werden;
ist es Sommer, so können wir sie einfach etwa eine halbe Stunde den
Sonnenstrahlen aussetzen, andernfalls muß die Erwärmung künstlich
geschehen (am besten über einer Dampf- oder Warmwasserheizung).
Die Scheibe darf so warm sein, daß wir sie gerade noch mit der
Hand anfassen können. Nun wird sie auf die oben erwähnte Unterlage
gelegt, so daß der äußere Rand auf der Unterseite frei bleibt. Das
Überstreichen muß recht gewandt ausgeführt werden; mit großen Strichen
überfahren wir die Fläche und achten darauf, daß keine Stelle frei
bleibt, aber auch keine zweimal überstrichen wird, damit wir einen
möglichst gleichförmigen Überzug erhalten. Wir streichen mit der
rechten Hand, in der linken haben wir ein in Spiritus getauchtes
Läppchen, mit welchem wir alles, was von der Lösung am Rand auf die
Unterseite der Scheibe gelangt, sofort abwischen. Hat man keinen
gleichmäßigen Überzug erzielt, so tut man am besten, die ganze Scheibe
mit Spiritus abzuwaschen und von vorn zu beginnen. Ist der Anstrich bei
beiden Seiten gelungen, so läßt man sie an einem staubfreien Orte, etwa
in einer großen Tischschublade, einen Tag liegen. Die anderen Seiten
der Scheiben werden genau so behandelt, nur dürfen sie diesmal nicht
so stark erwärmt werden und es muß ein Überlaufen von Schellackfirnis
unbedingt vermieden werden. Man bezeichne sich die zuerst
bestrichenen Seiten der Scheiben. Diesmal lassen wir sie nur 5 bis
6 Stunden in der Schublade liegen und stellen sie dann senkrecht
an einem staubfreien Orte so auf, daß sie außer an den Kanten nirgends
anliegen; so lassen wir sie 2 Tage unberührt stehen.
[S. 22]
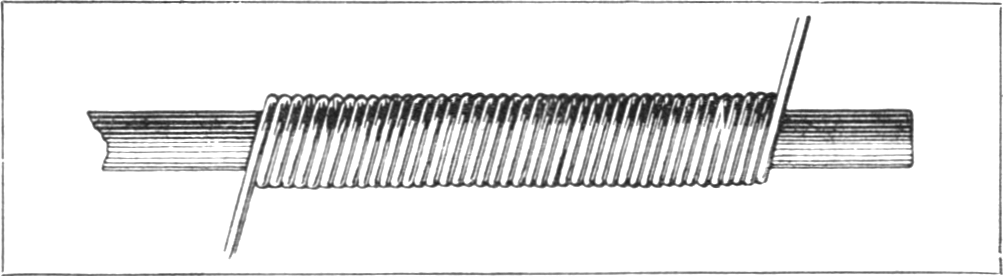
Abb. 16. Anfertigung der Achsenrohre.
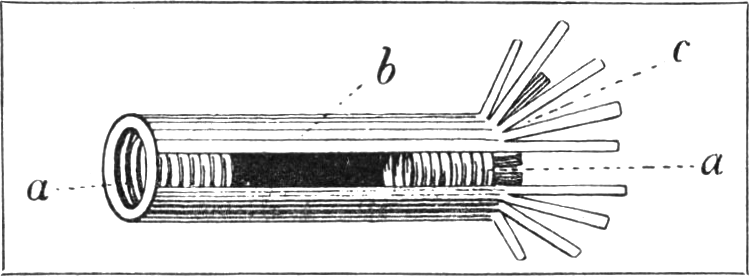
Abb. 17. Achsenrohr.
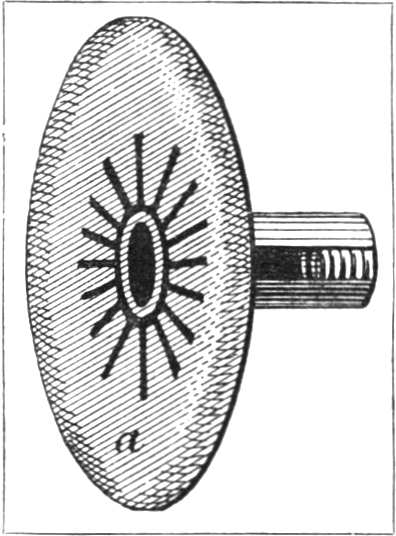
Abb. 18. Aufgelötete Messingscheibe.
Die Achsenansätze.
Unterdessen fertigen wir die beiden Achsen an. Dazu brauchen wir
zunächst zwei Messingstäbe, je 15 cm lang und 5 bis 7 mm
dick, ferner 50 cm blanken, geglühten, 2 mm starken
Kupferdraht. Den Draht reiben wir mit Glas- oder Schmirgelpapier sauber
und wickeln ihn dann in dicht nebeneinanderliegenden Windungen zu
einer 3 cm langen Spirale auf einen der Messingstäbe auf (Abb.
16); ein Stück Lötzinn wird zu einem feinen Plättchen ausgehämmert
und um die mit Lötwasser bestrichene Spirale herumgebogen, aus der
wir den Messingstab herausziehen und sie dann in die Flamme eines
Spiritus- oder Bunsenbrenners halten, bis sich das Lot gleichmäßig
zwischen den Windungen verteilt hat. Nachdem sich dies so entstandene
Rohr abgekühlt hat, sägen wir es mit einer in den Laubsägebogen
eingespannten Metallsäge in vier gleiche Teile. Diese vier Ringe
sollen sich immer noch bequem über die Messingstange schieben
lassen; sollte dies Schwierigkeiten machen, weil vielleicht etwas zu
viel Lot in das Innere gedrungen ist, so entferne man dies mit der
Rundfeile. Nun schneide man aus Messingblech zwei Rechtecke von je
30 × 65 mm. Bei jedem machen wir an dem einen Ende mit einer
Blechschere 10 bis 12 Einschnitte von je 2 cm Länge parallel
zu den Längskanten, so daß also 45 mm uneingeschnitten übrig
bleiben. Auf jedes Blech legen wir zwei von den vier Ringen, den
einen am inneren Ende der Einschnitte nach innen zu, den anderen am
entgegengesetzten nicht eingeschnittenen Rande, so daß zwischen ihnen
etwa 3 cm Raum bleibt; dann rollen wir das Blech fest um die
Ringe. Es wird keinen vollständig geschlossenen[S. 23] Zylinder bilden,
vielmehr wird ein etwa 4 mm breiter Zwischenraum frei bleiben.
Wir umwickeln nun diesen Blechzylinder fest mit Draht und löten ihn
mit den Kupferringen zusammen. Nach dem Abkühlen entfernt man den
Draht. Eines der so erhaltenen Achsenrohre zeigt Abb. 17: a
sind die Kupferdrahtringe, b ist der Blechzylinder mit den
durch Einschneiden entstandenen Streifen c. Um nachher diese
beiden Achsenrohre an den Glasscheiben ankitten zu können, schneiden
wir uns aus Messingblech zwei Scheiben von je 6 cm Durchmesser
und sägen bei jeder genau in der Mitte ein Loch, durch welches das
in Abb. 17 dargestellte Achsenrohr sich gerade noch hindurchschieben
läßt; nachdem wir das getan haben, biegen wir die Blechstreifen um
und löten sie an der Messingscheibe fest (Abb. 18). Nunmehr wird die
ebene Blechscheibe a mit einer Flachzange am ganzen Rande, von
der Achse weg ein wenig krumm gebogen, wie das in der Abb. 19 deutlich
zu sehen ist; aus dieser Zeichnung geht auch hervor, wie dieser in
der Abb. 18 abgebildete Teil auf der Glasscheibe aufzukitten ist:
G ist die Glasscheibe, S der Schellackkitt, B die
Messingscheibe, R die Kupferringe und H die Messinghülse.
Das Aufkitten mit Schellack erfolgt genau in der schon bei der
Reibungselektrisiermaschine angegebenen Weise; nur müssen wir, um das
Achsenrohr mit dem schon erwähnten Winkelmaß (Abb. 8) genau senkrecht
zu stellen, eine der beiden Messingstangen in das Rohr stecken und dann
wie[S. 24] oben beschrieben verfahren (siehe auch Abb. 20). Diese Achsenrohre
müssen bei beiden Scheiben auf die zuerst bestrichenen Seiten
aufgekittet werden. Sollte sich nach dem Auftrocknen des Kittes
herausstellen, daß die Achsenrohre doch nicht genau senkrecht stehen,
was man am deutlichsten erkennt, wenn man die Scheiben auf ihren Achsen
rotieren läßt, so kann man noch folgende Vorkehrung treffen: Wir löten,
wie aus Abb. 21 hervorgeht, eine Messingscheibe M, ähnlich der
Scheibe B, nur etwas kleiner, aber dicker als diese mit ein paar
Millimeter Abstand an. (Mit dem Lötkolben rasch anlöten, damit sich das
Glas nicht zu sehr erwärmt!) Am sichersten geht man, wenn man diese
Vorrichtung gleich von vornherein, also schon vor dem Aufkitten, an dem
Achsenrohr anbringt. Vorher haben wir schon nahe dem Rande in gleichen
Abständen[S. 25] drei Löcher gebohrt und über jedes Loch eine Schraubenmutter
(R) gelötet. (Wir können auch das Muttergewinde in die Scheibe
M selbst bohren.) Mit drei Metallschrauben, die wir durch diese
Muttern eindrehen und verschieden stark anziehen, können wir nun mit
Leichtigkeit die senkrechte Stellung der Achsenrohre erreichen. Nun
müssen wir noch auf die Innenseite der einen Scheibe genau in der
Mitte, also dem Achsenrohr gegenüber, mit einem Tropfen Schellack ein
Zweipfennigstück aufkleben.
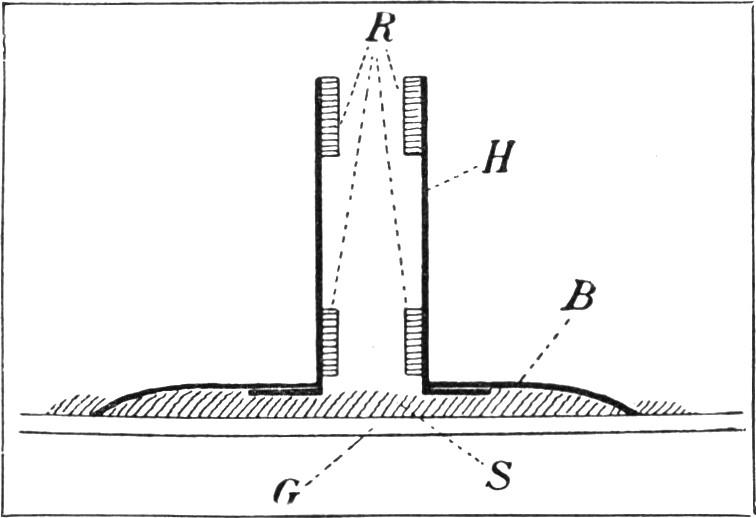
Abb. 19. Aufkitten auf die Glasscheibe.
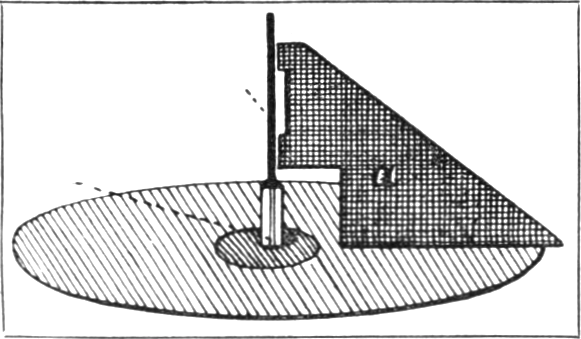
Abb. 20. Anlegen des Winkelmaßes.
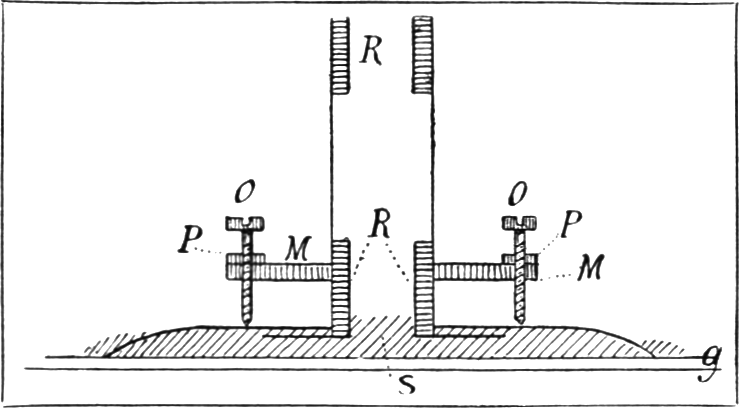
Abb. 21. Vorrichtung zur Erzielung der senkrechten
Achsenstellung.
Während der übrigen Arbeit sollen die Scheiben unberührt liegen
bleiben. Wir richten uns deshalb zwei Holzklötzchen her, die wir je mit
einem Loch versehen, in das die Achsenrohre eingesteckt werden, so daß
die Scheiben in horizontaler Lage aufbewahrt werden können, ohne daß
das Glas selbst irgendwo aufliegt. An einem staubfreien abgeschlossenen
Platze werden die Scheiben bis auf weiteres aufbewahrt.
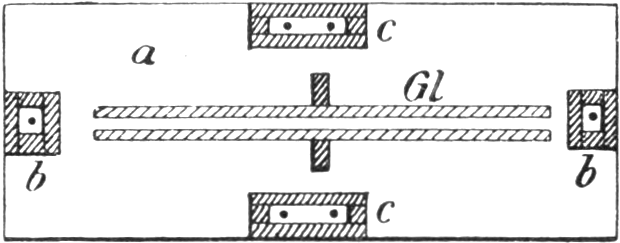
Abb. 22. Maschinengestell.
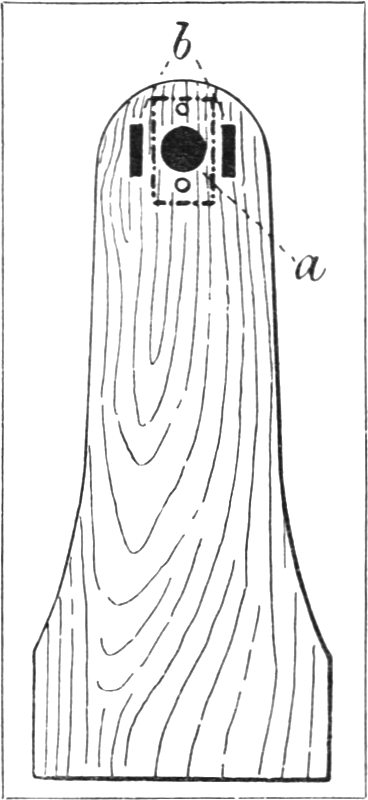
Abb. 23. Achsenträger.
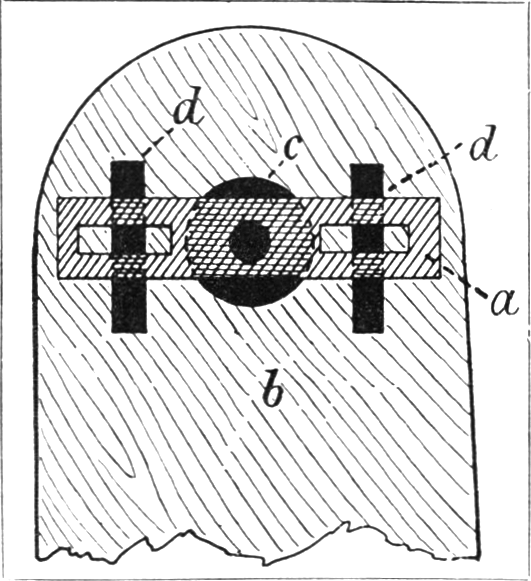
Abb. 24. Außenseite eines Achsenträgers.
Das Maschinengestell.
Die Achsenträger.
Wir wenden uns nun zu dem Maschinengestell. Zuerst schneiden wir uns
eine Pappscheibe, genau so groß wie die Glasplatten, und stecken
durch sie eine Messingstange, 30 cm lang und genau so stark
(5 bis 7 mm), wie die schon erwähnten Achsen. Abb. 22 zeigt
das Gestell im Grundrisse; Gl sollen die später einzusetzenden
Glasscheiben sein. Entsprechend ihrer Größe wählen wir nach Anleitung
des Grundrisses ein starkes Grundbrett a von ausreichender
Länge und Breite. c in Abb. 22 zeigt die Befestigungsstelle der
Achsenträger (Abb. 23). Man fertige sie beide aus Holzstücken, deren
Länge je um 7 cm mehr als der Scheibenradius beträgt und mache
sie unten 10, oben 6 cm breit. Oben ist ein etwa 15 mm
weites Loch a zu bohren, und daneben sägen wir zu beiden
Seiten einen Schlitz b von 20 mm Länge und 5 mm
Breite. Auf der Innenseite des Achsenhalters befestigen wir mit vier
Holzschrauben eine Eisen-[S. 26] oder Messingplatte (in Abb. 23 durch die
punktierte Linie und mit b bezeichnet), die das Loch a,
nicht aber die seitlichen Schlitze verdeckt. Die Platte muß ziemlich
stark sein (3 mm) und kann nötigenfalls durch Aufeinanderlöten
von zwei oder drei Blechscheiben hergestellt werden. Ehe diese Platte
aufgeschraubt wird, ist sie mit einer mittleren Durchbohrung zu
versehen, weit genug (5 bis 7 mm), daß die Scheibenachse gerade
noch hindurchgesteckt werden kann. Die Platte ist so aufzuschrauben,
daß ihre Durchbohrung mit dem Loche a konzentrisch wird. Abb. 24
zeigt in etwas größerer Darstellung die Außenseite eines Achsenträgers
und eine daraufliegende Metallplatte a von etwa 5 × 1 cm
Größe, die das Loch c und die beiden Schlitze d bedeckt
und drei Durchbohrungen hat: eine runde in der Mitte (5 bis 7 mm
weit) und zwei viereckige, die Schlitze d rechtwinkelig
kreuzend. Diese Metallplatte wird jedoch folgendermaßen befestigt: man
steckt durch die einander kreuzenden Schlitze je eine Metallschraube
von 5 mm Dicke, deren Kopf man durch Überschieben eines
breiten flachen Metallringes vergrößert, und schraubt eine passende
Schraubenmutter auf das Gewinde. Die Platte a in Abb. 24 wird
dadurch festgehalten und kann nach Lüftung der beiden Muttern nach
oben, unten und der Seite verschoben[S. 27] werden; denselben Teil zeigt Abb.
25 im Schnitt, a ist die verstellbare Metallplatte, b der
hölzerne Achsenträger, c das runde Loch darin und d die
Achse.
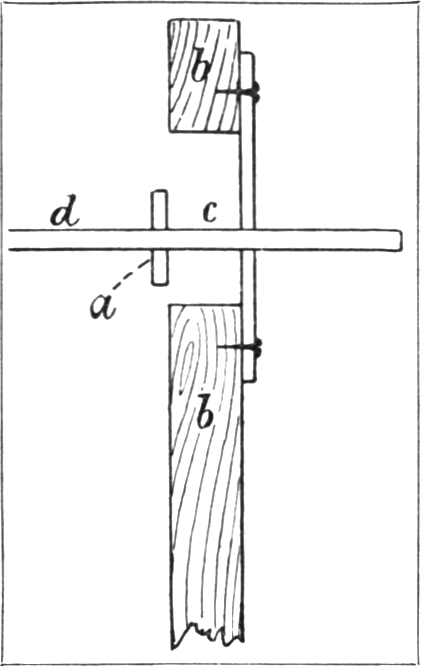
Abb. 25. Achse im Träger.
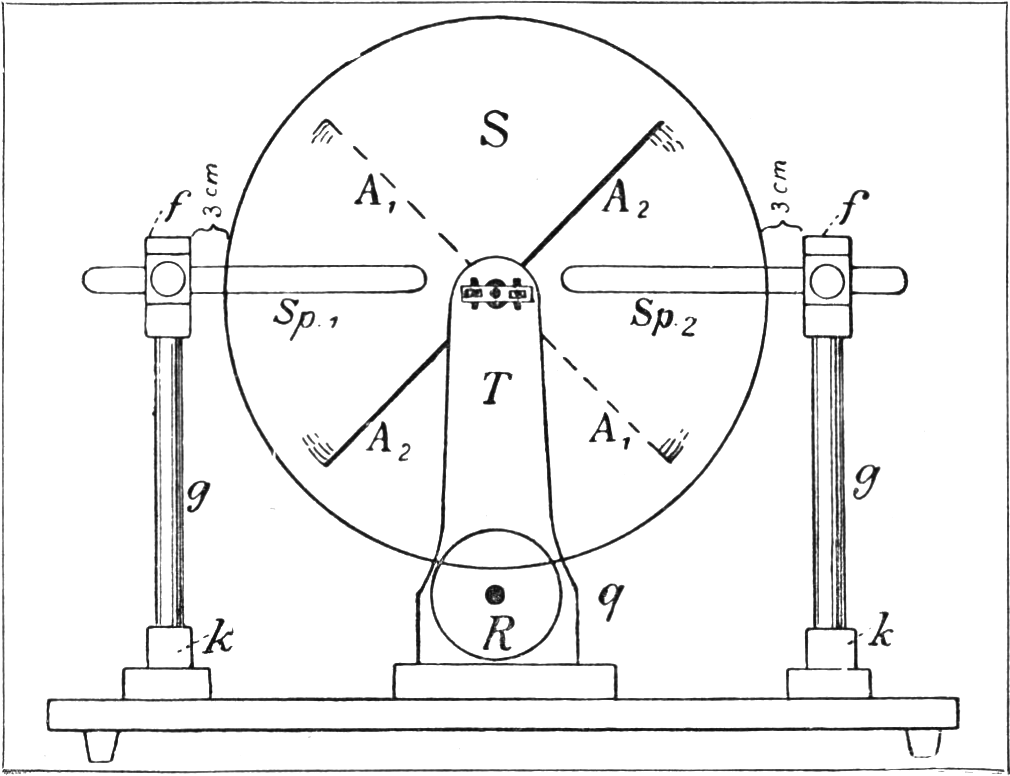
Abb. 26. Schematischer Aufriß der Maschine.
Die beiden Achsenträger sind nun an den zwei in Abb. 22 mit c
bezeichneten Stellen auf dem Grundbrette zu befestigen, indem wir
zunächst von dessen Unterseite her je zwei Schrauben eindrehen, durch
das Brett hindurch bis in die Achsenträger. Da diese Befestigung
wahrscheinlich nicht ausreichen würde, so schneiden wir von einer
sogenannten Glaserlatte vier längere (je 10 cm) und vier
entsprechend kürzere Stücke ab und schrauben sie bei jedem Achsenträger
um dessen Fuß herum so auf das Grundbrett auf, daß sie seitlich ganz
fest an den Trägern anliegen und diese wie in[S. 28] einer Versenkung
stehen. Zur Probe und Abschätzung der Größenverhältnisse kann nun die
Pappscheibe mit ihrer Achse in die Achsenlager der Träger eingesetzt
werden. Abb. 26 zeigt einen schematischen Aufriß der Maschine, wobei
S die Scheibe, T die Achsenträger bezeichnet.
Die Spitzenkammträger.
Nunmehr sind die Träger g der beiden Spitzenkämme Sp
anzubringen. Die Träger g sind Glasstäbe oder dickwandige
Glasröhren, etwa 2 cm im äußeren Durchmesser und an Länge etwa
gleich den Achsenträgern T. Sie sind innen und außen genau so zu
reinigen wie die Glasscheiben und auch in der gleichen Weise ebenfalls
innen und außen mit einem Schellacküberzug zu versehen und dann 1 bis 2
Tage an einem staubfreien Orte liegen zu lassen. Unterdessen besorgen
wir uns zwei Holzklötze (Abb. 26 k), jeden 4 × 4 cm breit
und 5 cm hoch. Jeder dieser Klötze erhält von oben nach unten
eine 3 cm tiefe Bohrung, die so weit ist, daß wir die Glassäule
bequem mit Siegellack oder Schellack einkitten können. Das obere Ende
der Röhre (wenn wir eine solche und keinen Glasstab benutzt haben)
wird mit einem Korke verschlossen und dann, wenn wir sicher sind,
daß keine Feuchtigkeit in dem Rohre ist, das heißt, wenn es sich auf
der Innenseite nach ein paar Stunden noch nicht beschlagen hat, mit
Siegellack abgedichtet. Nachdem letzteres geschehen ist, krönen wir
die Glassäule mit einem Holzklotz f, 4 × 4 cm breit, 7
cm hoch. Die Kammträger werden 3 cm vom Scheibenrande
entfernt an den in Abb. 22 mit b bezeichneten Stellen
aufgeschraubt und ebenso wie die Achsenträger mit Lattenstückchen
umgeben.
Die Triebräder.
Die nächste Arbeit besteht in der Anfertigung der Triebräder, die in
Abb. 27 mit R bezeichnet sind. Man stellt sie aus Holz her und
versieht sie am Rande mit einer Furche zur Aufnahme der Triebschnur.
Die Achse dieser Triebräder muß durch entsprechende Löcher gehen,
die in T einzubohren sind, und soll nahe unter den untersten
Scheibenrand zu liegen kommen. Um einen leichteren Gang zu erreichen,
können wir die Lager dieser Achse T mit Lagerröllchen
ausstatten, deren Herstellung schon bei Abb. 16 beschrieben[S. 29] wurde.
Zur Befestigung der Triebräder bohre man an den entsprechenden
Stellen dünne Löcher in die Achse und treibe Drahtstifte hindurch,
an welchen dann die Räder so befestigt werden, daß sie sich auf der
Achse nicht mehr drehen können. Mit ebensolchen Drahtstiften ist die
Achse selbst in ihren Lagern zu fixieren. Am einen Ende feilt man die
Achse vierkantig und befestigt mit größter Vorsicht an ihr die Kurbel
k, die mit einem entsprechenden Loche versehen sein muß.
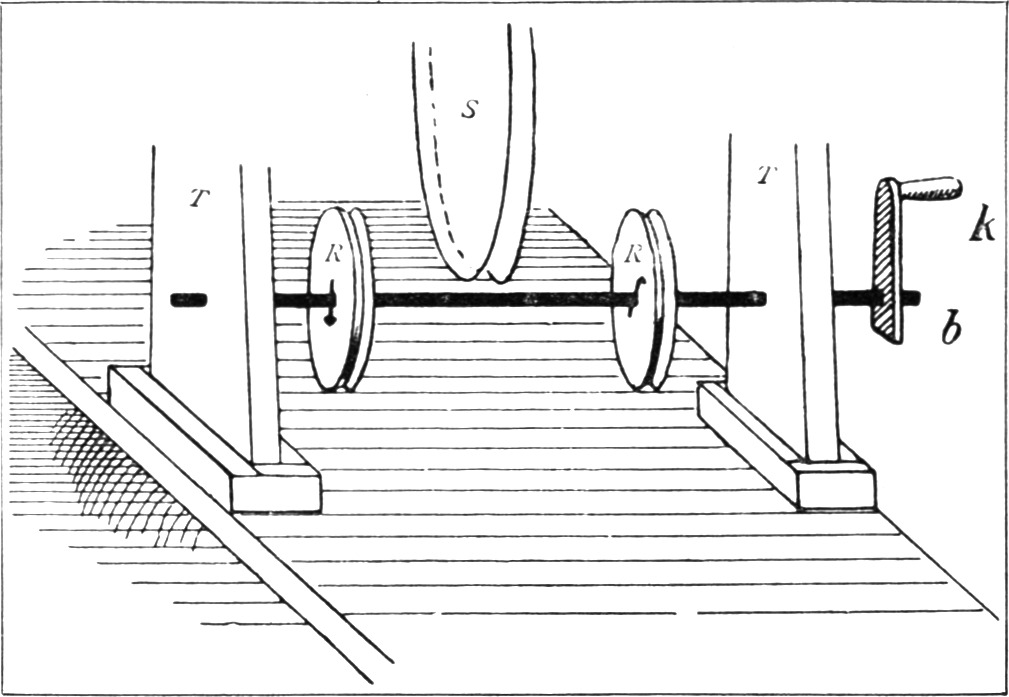
Abb. 27. Antrieb der Scheiben.
Das Einsetzen der Scheiben.
Nun erfolgt das Einsetzen der Glasscheiben (Abb. 28). Die Scheiben
werden hervorgeholt und man steckt die zu Anfang unserer Betrachtung
erwähnten je 15 cm langen Messingachsen b von außen
durch die Metallplatten c und durch h in die Achsenrohre
a, nachdem man an entsprechenden Stellen die ebenfalls mit einer
Furche versehenen Triebrollen d auf ihnen befestigt hat. Die
Achsen b werden so weit nach innen geschoben, daß die beiden
Glasscheiben g in der Mitte sitzend nur noch durch das auf der
einen aufgekittete Geldstück f voneinander getrennt sind; durch
Verstellen der Platten c muß man es dahin bringen, daß die
Scheiben g genau vertikal und zueinander vollkommen[S. 30] parallel
stehen. Da wo sich die Achsenrohre auf den Achsen drehen, werden diese
gleich etwas eingeölt.
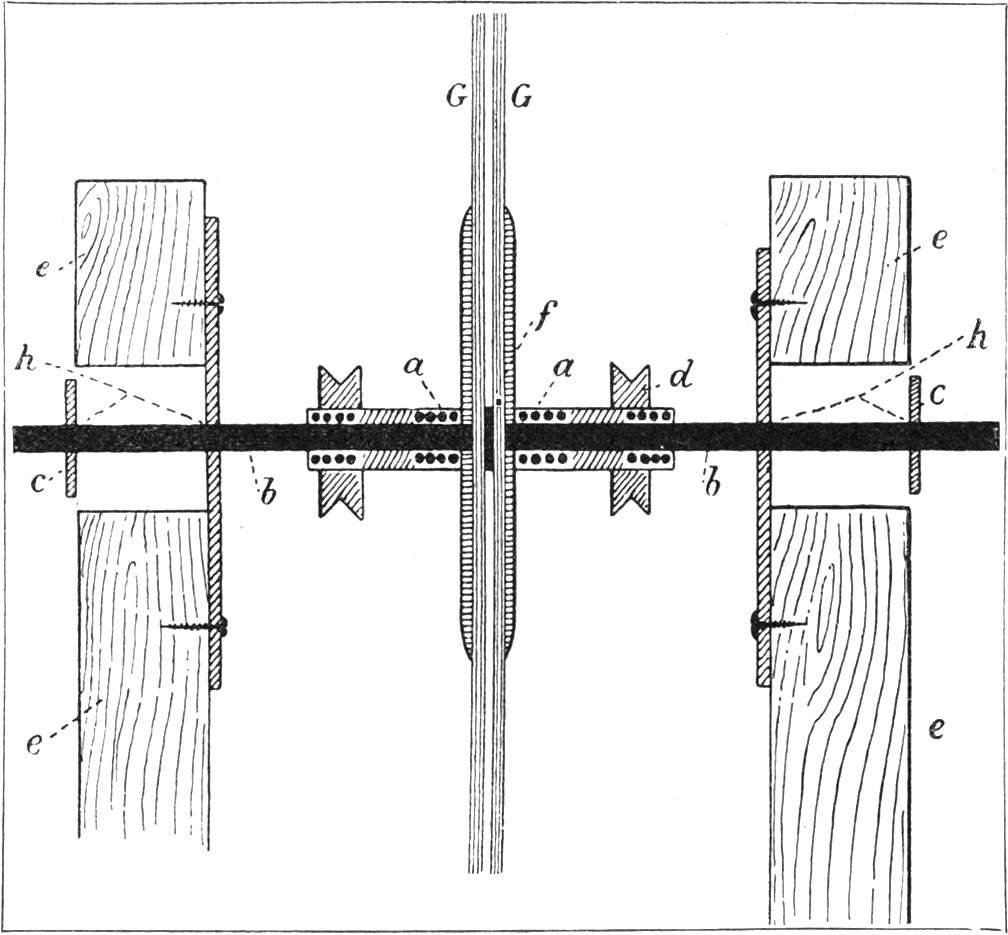
Abb. 28. Achsenlager der Scheiben.
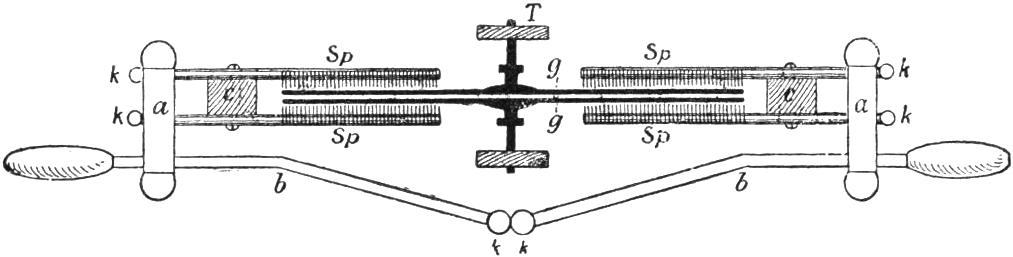
Abb. 29. Stellung der Spitzenkämme.
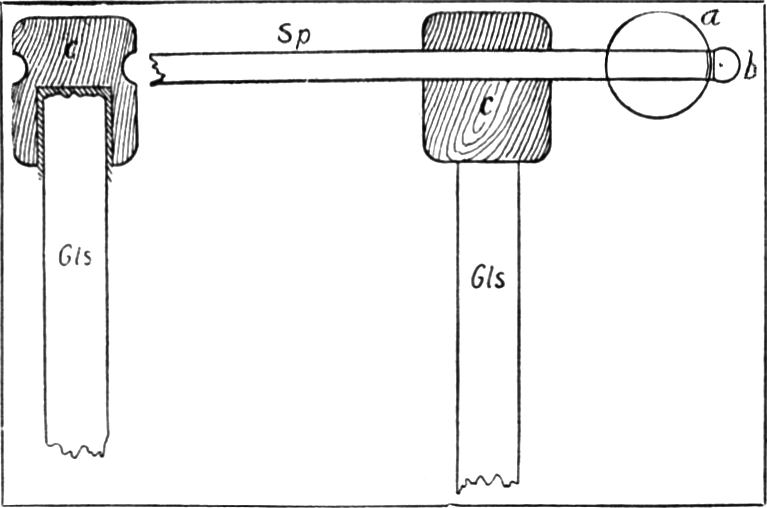
Abb. 30. Durchschnitt des Spitzenkammträgers.
Abb. 31. Spitzenkammträger.
Die Spitzenkämme.
Wir kommen nun zur Herstellung der Spitzenkämme. Ihre Größe im
Verhältnis zu den Scheiben, sowie ihre Stellung zu denselben geht aus
dem schematischen Grundriß der Abb. 29 hervor; dabei sind c,
c die Holzklötze, welche die schon erwähnten Spitzenkammträger
krönen. Nun sind zuerst[S. 31] einmal alle Ecken und Kanten dieser
Holzklötzchen völlig abzurunden; dann erhalten sie auf zwei einander
gegenüberliegenden Seiten je eine Furche, die so weit und tief ist,
daß sie die nachher für den Spitzenkamm zu verwendende Röhre genau zur
Hälfte in sich aufnimmt; Abb. 30 ist ein Schnitt, Abb. 31 eine Ansicht
dieses Teiles. Die Spitzenkämme selbst werden bei kleinen Maschinen aus
mindestens 5 mm, bei großen aus mindestens 10 mm weiten
Messingröhren hergestellt. Wir brauchen vier gleichlange Stücke, welche
in Abb. 29 mit Sp bezeichnet sind. Ferner benötigen wir zwei
etwa 3 cm weite Messingrohre, wie wir solche schon zu dem in der
Abb. 3 dargestellten Konduktor verwendet haben, ihre Länge soll etwa
gleich dem Abstand der beiden Achsenträger T sein. Jedes dieser
Rohre erhält drei Bohrungen. Das erste Loch sei möglichst nahe dem
einen Ende; die Mitte des zweiten Loches sei von der Mitte des ersten
genau um die Dicke des Holzklotzes c (4 cm) entfernt;
das dritte Loch ist nahe dem anderen Ende. Diese Bohrungen sollen so
weit sein, daß wir die Messingröhren Sp und b gerade noch
hindurchschieben können. Die Röhren Sp erhalten da, wo sie an
c anliegen sollen, je eine Bohrung, durch welche sie mittels
einer Holzschraube an c festgeschraubt werden können. Statt
hierbei Holzschrauben zu verwenden, können wir uns bei einem Mechaniker
vier Messingkügelchen drehen und je mit einem Muttergewinde versehen
lassen, ebenso zwei 3 mm starke Messingstäbchen etwa 6 cm
lang, und an den Enden ebenfalls mit Gewinde versehen. Wir durchbohren
nun nicht[S. 32] nur die Rohre Sp, sondern auch c, so daß wir
die Messingstäbchen ganz hindurchstecken und durch beiderseitiges
Aufschrauben der Kugelmuttern die Rohre Sp an c anklemmen
können.
Nun müssen wir die Spitzenreihen auflöten. Die Spitzen sollen etwa 1
mm Abstand von den Glasscheiben haben. Wir besorgen uns eine
große Anzahl von Stecknadeln von passender Größe. Wir dürfen für eine
20 cm lange Spitzenreihe 80 bis 100 Nadeln rechnen. Die Rohre
Sp werden auf einer Seite etwas flach gefeilt, die Nadeln
werden einzeln mit Schmirgelpapier abgerieben und mit den Spitzen in
entsprechenden Abständen in einen Pappstreifen gesteckt und mit ihren
Kopfenden — die Köpfe selbst sind alle mit einer Drahtzange abgezwickt
worden — auf die abgeflachte Seite des Rohres gelegt; durch Beschweren
und Unterstützen werden beide Teile in dieser Lage festgehalten und mit
Lötwasser bestrichen; unter Anwendung von ziemlich viel Lot werden die
Nadeln aufgelötet. Nach dem Erkalten wird die ganze Lotstelle sorglich
rund gefeilt. Sollte sich nachher herausstellen, daß einige Nadeln zu
lang sind und die Glasscheiben berühren, so kann man sie durch Biegen
nach oben oder unten auf ihren richtigen Abstand bringen. Ist dies
alles geregelt, so können wir die Rohre a über die noch frei
über c hinausragenden Endstücke von Sp schieben und
anlöten. An die Enden selbst löten wir kleine Kugeln k. Die
Enden der Rohre a haben wir schon vorher, wie bei dem Konduktor
in Abb. 3, mit Kugelhauben versehen.
Die Elektrodenstangen.
Nun wären noch die Elektrodenstangen anzubringen; ihre Form geht aus
Abb. 29 hervor; sie werden aus dem gleichen Material gefertigt wie
die Spitzenkämme und müssen sich in der für sie bestimmten Bohrung
in a hin und her schieben lassen. Die inneren Enden werden
mit Kugeln versehen, die äußeren müssen isolierende Griffe erhalten.
Diese können wir uns selbst in der Weise herstellen, daß wir die mit
einer groben Feile aufgerauhten Enden mehrfach mit in Schellackfirnis
getränktem Bindfaden umwickeln und nach dem Auftrocknen des Schellacks
mit einer dicken Schicht roten Siegellacks überziehen.
[S. 33]
Die Ausgleicher.
Abb. 26 zeigt nun noch die beiden Ausgleicher A, die wir aus
zwei Kupferdrähten von 3 mm Stärke herstellen; die Länge der
Drähte darf etwas weniger als der Durchmesser der Scheiben betragen.
Sie werden mit ihren Mitten an den Achsenträgern befestigt und erhalten
an ihren Enden aus Metalldresse hergestellte Pinselchen, die auf
den Scheiben, etwa 4 cm vom Rande, leicht aufliegen sollen.
Die Stellung der beiden Ausgleicher ist aus Abb. 26 zu ersehen:
A₂ ist der vordere und bildet mit den Kämmen einen Winkel von
45°, A₁ befindet sich auf der anderen Seite der Scheiben und
kreuzt A₂ unter einem rechten Winkel.
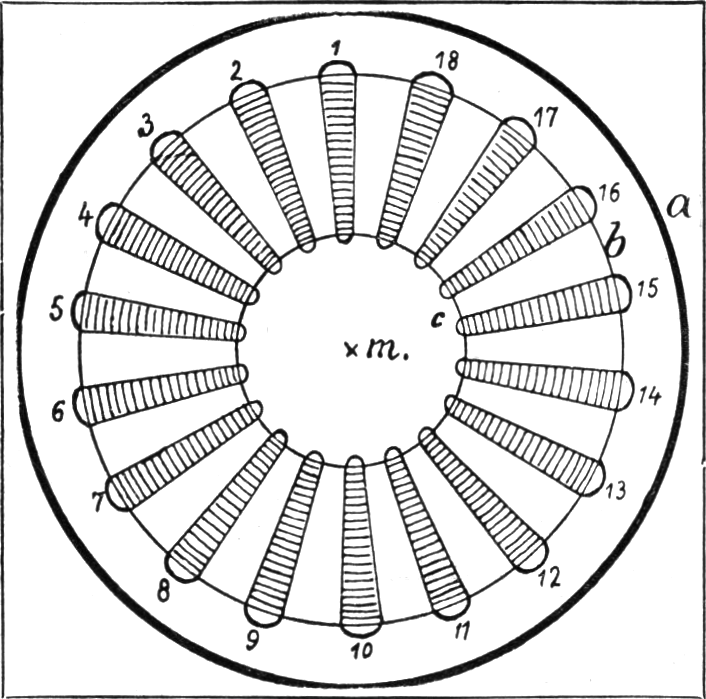
Abb. 32. Stanniolbeläge an den Außenseiten der Scheiben.
Aufkleben des Scheibenbelages.
Nun geht die Maschine ihrer Vollendung entgegen. Wir nehmen die
Scheiben nochmals heraus und bestreichen alle Holzteile mit Schellack.
Die Scheiben selbst versehen wir jetzt mit den Stanniolbelägen: Wir
zeichnen auf einen Bogen Papier einen Kreis, dessen Durchmesser
gleich dem Scheibendurchmesser ist. Dieser Kreis ist in Abb. 32
mit a bezeichnet; außerdem zeichnen wir mit einem 2 bis 2,5
cm kleineren Radius einen zweiten (b) und mit einem je
nach Scheibengröße 6 bis 10 cm kleineren Radius einen dritten
konzentrischen Kreis (c). Den Umfang der Kreise b und
c teilen wir dann in 16 bis 24 gleiche Teile und verbinden die
Teilpunkte paarweise. Endlich zeichnen wir wie in[S. 34] Abb. 32 um diese
Linien schraffierte Flächen auf, die etwa halb bis ein Drittel so
breit sind als ihre Zwischenräume. Einen dieser Sektoren schneidet man
heraus und fertigt sich nach seinem Muster die doppelte Anzahl (32 bis
48) Beläge aus starkem Stanniol. Man legt nun zunächst die eine, dann
die andere Scheibe auf die Zeichnung und beklebt eine jede da, wo die
schraffierten Flächen durchscheinen, mit Stanniolbelägen. Das Bekleben
geschieht folgendermaßen: man bestreicht den Stanniolstreifen auf einer
Seite mit einem Pinsel mit Spiritus, legt ihn mit der bestrichenen
Seite auf die Glasplatte, gleich genau an seinen Platz, und streicht
ihn dann mit dem Finger fest auf, ohne ihn aber dabei zu verschieben.
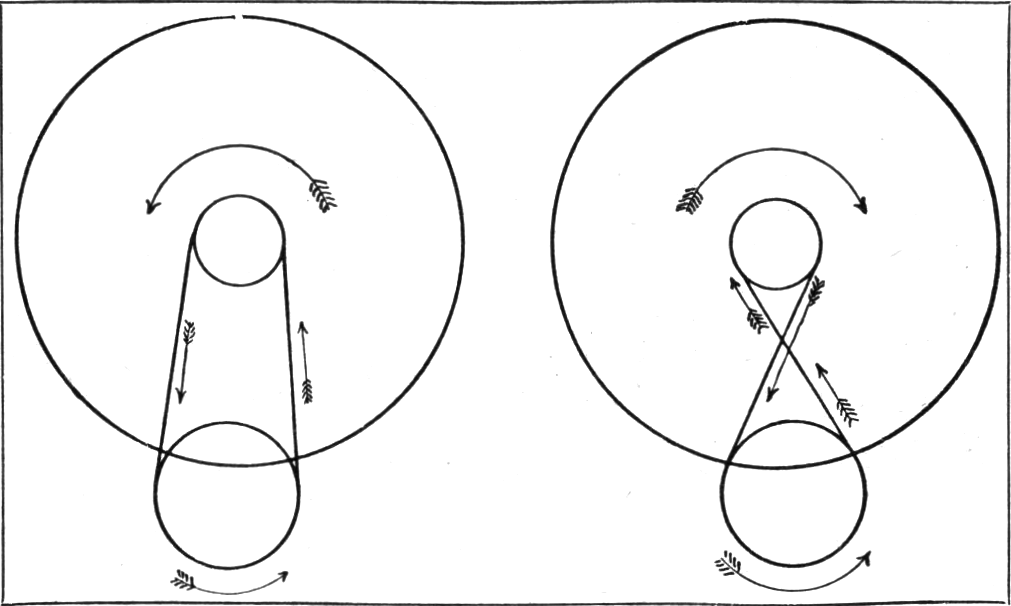
Abb. 33. Auflegen der Treibschnüre.
Die Treibschnüre.
Sind die Sektoren alle aufgeklebt, so kann die Maschine wieder
zusammengesetzt werden, und es fehlen dann nur noch die Treibschnüre.
Da sich die Scheiben in entgegengesetzter Richtung drehen müssen, so
können wir dies nur dadurch erreichen, daß wir auf der einen Seite
die Schnur direkt, auf der anderen sich kreuzend über Triebrad und
Triebrolle führen. Abb. 33 veranschaulicht diese Anordnung.
Pünktliche, saubere Arbeit ist die erste Bedingung für das Gelingen.
Wer alle hier gegebenen Anweisungen[S. 35] genau befolgt, dem bleibt der
Erfolg sicher nicht aus. Die Maschine selbst muß auch nach der
Fertigstellung sehr sorglich behandelt werden. Vor allem muß sie bei
Nichtgebrauch vor dem schädlichen Verstauben bewahrt bleiben, weshalb
es sehr ratsam ist, eine Papierhülle herzustellen, wie dies schon
bei der Reibungselektrisiermaschine (Seite 17) beschrieben wurde. —
Läßt bei ein- bis zweijährigem Gebrauche die Wirkung der Maschine
nach, so sind die Scheiben völlig von ihrem Überzug und ihren Belägen
zu befreien und müssen von neuem hergerichtet werden, genau so, wie
das erste Mal. — Für den Besitzer einer Influenzelektrisiermaschine
ist eine Reibungselektrisiermaschine überflüssig; diese hat nur den
Vorzug, daß sie einfacher herzustellen ist; dagegen ist sie weniger
leistungsfähig und erfordert viel mehr Arbeit, um aus ihr die benötigte
geringe Menge von Elektrizität zu erhalten. Die Influenzmaschine kann
für viele Versuche einen Funkeninduktor ersetzen.
Die letzten Vorbereitungen zum Vortrag.
Da unser Rudi alles, was er einmal anfing, auch pünktlich und gut
ausführte und lieber etwas mehr Zeit aufwandte, als etwas schlecht
zu machen, so war es über seinen Vorbereitungen Winter geworden. Die
nötigen Apparate waren fertig, auch wäre es in seinem Dachkämmerchen
jetzt zu kalt gewesen, um noch darin zu arbeiten. Es handelte sich
nun noch darum, den Vortrag selbst auszuarbeiten und schließlich denn
auch wirklich zu halten. Die Ausarbeitung des Vortrags machte unserem
Rudi zwar mehr Mühe, als er sich anfangs vorgestellt hatte, doch wurde
er verhältnismäßig bald damit fertig, und nun wurden die Zuhörer und
Zuhörerinnen geladen auf einen Sonntagnachmittag 6 Uhr.
Es galt zunächst, das größte Zimmer der Wohnung in ein Auditorium
umzuwandeln. Zu diesem Zwecke wurde, von den schweren Möbeln abgesehen,
alles aus dem Zimmer herausgeräumt; zwei Schritte von der einen
kürzeren Wand entfernt wurde ein langer Tisch aufgestellt und vier
Schritte davon begannen die Stuhlreihen. Auf dem Tisch hatte Rudi die
Apparate so aufgestellt, wie er sie nacheinander in seinem Vortrag
brauchte. Die Mitte des Tisches hatte er freigelassen. Außerdem versah
er die[S. 36] einzelnen Lampen des Kronleuchters nach der Seite der Zuhörer
mit Lampenschirmen, so daß der Experimentiertisch zwar hell beleuchtet,
die Stuhlreihen aber im Schatten waren. Mit der Ausführung der
einzelnen Experimente hatte Rudi bereits seine jüngere Schwester Käthe
vertraut gemacht; sie sollte ihm während des Vortrags assistieren.
Der Vortrag.
Unter allerlei Vorkehrungen, die noch getroffen werden mußten, verging
der Nachmittag, die geladenen Gäste begannen zu kommen, und als die
letzte Tante eingetreten war und Platz genommen hatte, erschien Rudi,
gefolgt von seiner Schwester, die sich auf der einen Seite auf einen
Stuhl setzen mußte, stellte sich hinter seinen Tisch, schlug bedächtig
sein Vortragskonzept auf, ließ einen forschenden Blick über die Zuhörer
schweifen und begann also zu sprechen:
„Meine Herren und Damen! Zuerst meinen besten Dank für Ihr zahlreiches
Erscheinen. Ich hoffe, daß es mir gelingt, Ihnen heute einige
interessante und lehrreiche Experimente vorzuführen, Experimente aus
dem Gebiet der Reibungs- und Influenzelektrizität.“
Die geriebene Siegellackstange.
„Das Wort Elektrizität stammt von dem griechischen Worte Elektron,
das Bernstein bedeutet. Es war schon den alten Griechen bekannt,
daß Bernstein, wenn er gerieben wird, die Fähigkeit erlangt, kleine
leichte Gegenstände anzuziehen. Wie Sie alle wissen, ist Bernstein
ein Harz, und wir können daher dieses bekannte Experiment mit jeder
Siegellackstange wiederholen (Käthe war aufgestanden, rieb nun die
bereitgelegte Siegellackstange mit einem wollenen Lappen und führte
das Experiment aus), wie Sie hier sehen. Es gibt nun noch eine ganze
Reihe von Körpern, die durch Reibung diese Fähigkeit erlangen, die,
wie wir uns ausdrücken, elektrisch werden. So werden wohl manche von
Ihnen schon die Beobachtung gemacht haben, daß beim Kämmen der Haare
mit einem Kautschukkamme dieser elektrisch wird und die Haare anzieht;
oft hört man dabei ein Knistern, und im Dunkeln sieht man kleine
Fünkchen überspringen. Hier wird ein Stab aus Hartgummi gerieben, er
zeigt die gleiche Fähigkeit, ebenso[S. 37] dieser Glasstab. Wer eben den
Vorgang genau beobachtet hat, konnte sehen, daß einige der angezogenen
Papierschnitzel, kaum daß sie an dem Glasstab hingen, gleich wieder
weggeschleudert wurden. Woher mag das kommen?“
Anziehung und Abstossung.
Leiter und Nichtleiter.
Die verschiedenen Elektrizitäten.
Erklärungen über die elektrischen Erscheinungen.
„Ich habe hier an diesen beiden Gestellen je ein Holundermarkkügelchen
an einem Faden aufgehängt. Ich reibe diesen Hartgummistab mit einem
Katzenfell, und Sie sehen, wenn ich ihn hier in die Nähe bringe,
so wird das Holundermarkkügelchen sehr rasch angezogen, doch kaum
hängt es am Stab, so wird es heftig abgestoßen und weicht nunmehr
ständig dem Stab aus. Ich will nun das gleiche Experiment mit
diesem zweiten Holundermarkkügelchen anstellen: es wird ebenfalls
angezogen, doch springt dieses nicht ab; es bleibt vielmehr fest
hängen; ich reiße es los, es wird wieder angezogen. Was mag nun den
Unterschied in diesen beiden Erscheinungen hervorrufen? Dies erste
Kügelchen wird immer noch abgestoßen, das zweite angezogen. Wenn Sie
genauer zusehen, so bemerken Sie, daß das erste Kügelchen hier an
einem seidenen, das zweite an einem leinenen Faden aufgehängt ist.
Es muß also zwischen Seide und Leinen ein ganz besonderer mit der
Elektrizität zusammenhängender Unterschied bestehen. Sehen wir zu,
daß wir noch mehr Stoffe nach dieser Art voneinander unterscheiden
können. Ich will einmal das Kügelchen mit den Fingern berühren; nun
wird es von dem frischgeriebenen Hartgummistab wieder angezogen, doch
alsbald wieder abgestoßen. Berühre ich es mit diesem Glasstab, der
nun nicht mehr elektrisch ist (Käthe hatte ihn unterdessen, um ihn zu
entelektrisieren, mehrmals durch eine zu diesem Zwecke aufgestellte
Weingeistflamme gezogen), so verliert es seine Eigenschaft, von dem
Hartgummistab abgestoßen zu werden, nicht; berühre ich es dagegen
mit dieser Messingröhre, so fällt es wieder in seinen ursprünglichen
Zustand zurück und wird wieder erst von dem Ebonitstab angezogen. Ich
wiederhole nun dieses Experiment mit Gummi, Eisen, Holz, Schwefel,
Seide, Leinen, Porzellan, Kupfer. Diejenigen Stoffe, bei deren
Berührung das Holundermarkkügelchen[S. 38] seinen Zustand nicht ändert, will
ich hier (rechts), die anderen hier (links) hinlegen. (Er führte die
Versuche aus.) Sie sehen nun, hier (rechts) liegt der Gummischlauch,
diese Schwefelstange, das Seidentuch und der Porzellanteller, hier auf
dieser Seite (links) ist es dies Messer, der Holzstab, das Leinentuch
und der Kupferdraht. Wir können also hier die verschiedenen Stoffe
in zwei Gruppen trennen: in solche, die den elektrischen Zustand des
Holundermarkkügelchens ableiten, und in solche, die ohne Einfluß auf
ihn sind. Die Stoffe, die diesen elektrischen Zustand abzuleiten
vermögen, nennen wir kurz Leiter, die anderen nennen wir Nichtleiter
oder Isolatoren. Es wären also Glas, Siegellack, Seide, Porzellan,
Gummi, Schwefel Nichtleiter oder Isolatoren, dagegen Leinen, der
menschliche Körper, Holz, die verschiedenen Metalle Leiter der
Elektrizität zu nennen. Daraus erklärt sich nun auch, warum sich
das Holundermarkkügelchen am Leinenfaden anders verhält wie das am
Seidenfaden. (Kaum hatte Rudi das letzte Experiment beendet, als seine
kleine Assistentin das Holundermarkkügelchen mit dem Leinenfaden
entfernte und dafür ein solches an einem Seidenfaden an dem
Gestell aufhängte.) Ich habe nun hier zwei Holundermarkkügelchen,
beide an Seidenfäden, also isoliert aufgehängt. Ich will nun jedes
einzeln mit diesem geriebenen Glasstab berühren; Sie sehen das
gleiche Schauspiel wie vorhin, und nun werden beide von dem Glasstab
abgestoßen; ich rücke nun die beiden Gestelle zusammen, so daß unter
normalen Verhältnissen die Kügelchen einander berühren müßten, aber
sie stoßen nun einander ab; ich berühre sie mit der Hand, und jetzt
hängen sie ganz friedlich dicht nebeneinander. Jetzt will ich das eine
wieder mit dem geriebenen Glasstab berühren (nachdem er die Gestelle
wieder auseinandergerückt hatte), das andere aber mit diesem Ebonitstab
und nun die Gestelle vorsichtig wieder einander nähern: Sie sehen,
die Kügelchen ziehen einander an, jetzt sind sie beisammen und nun
fallen sie wieder auseinander und reagieren auch aus allernächster
Nähe nicht aufeinander. Es muß also zwischen der Elektrizität des[S. 39]
Glases und des Ebonits ein Unterschied bestehen. Ich will nun einmal
den gleichen Versuch mit Ebonit und Siegellack machen. (Das Reiben
der Stäbe besorgte stets Käthe mit großem Eifer.) Nun verhalten sich
die Kügelchen so wie vorhin, als ich beide mit dem Glasstab berührte;
also ist zwischen der Elektrizität des Siegellacks und des Ebonits
kein Unterschied. Ferner ersehen wir aus diesen Versuchen, daß, wenn
beide Kügelchen mit der gleichen Elektrizität ‚geladen‘ sind — um
diesen Ausdruck jetzt schon zu gebrauchen — sie einander abstoßen,
dagegen anziehen, wenn sie verschiedene Elektrizitäten tragen. Sie
sehen daraus, meine Herren und Damen, daß das Sprichwort: ‚Gleich
und gleich gesellt sich gern‘ hier nicht gilt. Über die eigentliche
Natur der elektrischen Erscheinungen war man lange Zeit nicht ins
klare gekommen. Hypothesen kamen und gingen, und früher wurde ein
heftiger und leidenschaftlicher Kampf um die einzelnen Erklärungen
geführt. Es ist heute nicht meine Aufgabe, Ihnen die geschichtliche
Entwicklung darzutun, ich will nur versuchen, Ihnen ein Bild, oder
richtiger gesagt: Bilder der Vorgänge zu entwerfen, Bilder, die
Ihnen verständlich sein können und die sich an die Tatsachen so nahe
anlehnen, daß sie für Sie als Erklärungen der Erscheinungen gelten
können.“
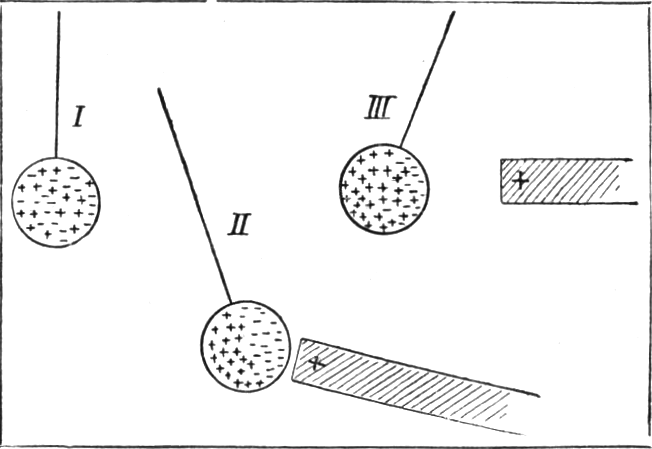
Abb. 34. Vorgang der Anziehung und Abstoßung.
„Man weiß heute, daß die elektrischen Erscheinungen eng verknüpft
sind mit den magnetischen, daß sie als Zustände des hypothetischen
Aethers aufzufassen und qualitativ mit Licht und Wärme identisch
sind. So kam es auch, daß die Erkenntnis der elektrischen Vorgänge
fast alle bis dahin noch vorhandenen Rätsel der Lichterscheinungen
gelöst hat. Wird ein Körper gerieben, so werden durch diese Reibung
die den Molekülen beigeordneten, die elektrischen Werte tragenden
sogenannten Elektronen, die vorher willkürlich durcheinander
lagen, in eine bestimmte Ordnung und Stellung zueinander gebracht;
dadurch wird nicht nur der geriebene, sondern auch der reibende Körper
in den eigentümlichen elektrischen Zustand versetzt. Daß auch der
reibende Körper elektrisch wird, sehen Sie hier: Ich fasse diesen
amalgamierten Lederlappen, um ihn von meiner[S. 40] Hand zu isolieren, mit
dem Seidentuche an und reibe damit den Glasstab, mit welchem ich das
eine Holundermarkkügelchen berühre; mit diesem Reibzeug berühre ich
das andere Holundermarkkügelchen, und nun sehen Sie, daß die beiden
einander anziehen, also entgegengesetzt oder, wie man zusagen pflegt,
ungleichnamig geladen sind. Man kann sich die Elektrizitäten als zwei
verschiedene Stoffe denken, die alle Körper erfüllen und die für
gewöhnlich nicht zur Geltung kommen, da, wenn von beiden gleichviel
vorhanden ist, sie einander binden. Durch Reibung aber werden beide
getrennt; der eine bleibt auf dem reibenden, der andere auf dem
geriebenen Körper. Diejenige Elektrizität, die der Glasstab beim Reiben
annimmt, bezeichnen wir mit diesem Zeichen (hier machte Rudi auf eine
an der Türe hinter seinem Tisch angebrachte Tafel mit Kreide ein
+-Zeichen) und nennen sie positive Elektrizität; die andere, welche der
Siegellack- oder Hartgummistab annimmt, wird mit diesem Zeichen (−)
versehen und heißt negative Elektrizität. Den Vorgang der Anziehung
und Abstoßung soll Ihnen diese Zeichnung hier veranschaulichen (Käthe
hielt einen großen, mit weißem Papier überzogenen Pappendeckel
in die Höhe, auf welchen Rudi die obenstehende Abb. 34 in großem
Maßstabe aufgezeichnet hatte.) Sie sehen hier, dies stellt eine
Holundermarkkugel dar; die positiven und negativen Elektrizitäten
sind regellos verteilt. Bringe ich nun diesen positiv elektrischen
Glasstab in die Nähe, so werden die negativen Elektrizitätsteilchen
der Kugel auf die dem Stab zugekehrte, die positiven dagegen auf
die entgegengesetzte Seite wandern; da nun die ungleichnamigen
Elektrizitäten einander näher sind als die gleichnamigen, so wird die
Holundermarkkugel[S. 41] angezogen. Doch da nun bei der Berührung ein Teil
der positiven Elektrizität vom Glasstab auf die Kugel, von dieser aber
ein Teil der negativen Elektrizität auf den Glasstab übergeht, so wird
auf der Kugel bald ein Überschuß von positiver Elektrizität sein, und
deshalb wird nun das Kügelchen abgestoßen. Anders verhält sich die
Sache, wenn ich das Holundermarkkügelchen an einem Leinenfaden
aufhänge, es also in leitende Verbindung mit der Erde bringe: dann
flieht die abgestoßene Elektrizität nicht nur auf die andere Seite des
Kügelchens, sondern nimmt ihren Weg durch den leitenden Faden hindurch
bis in die Erde, und es bleibt nur die angezogene Elektrizität zurück;
deshalb wird auch das am Leinenfaden aufgehängte Kügelchen nicht
abgestoßen, wie das am Seidenfaden befestigte.“
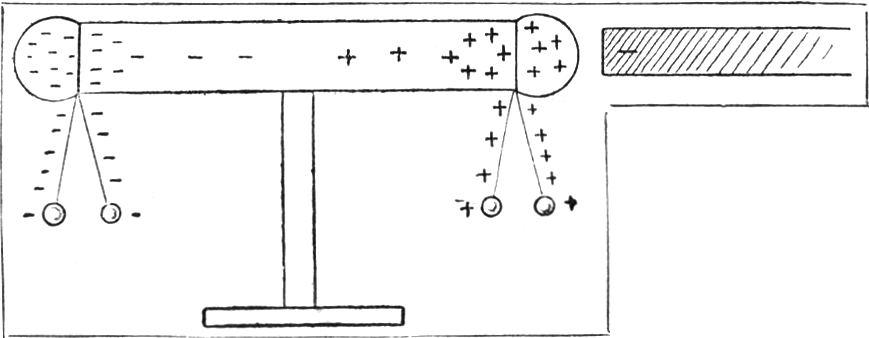
Abb. 35. Darstellung der Verteilung der Elektrizitäten.
Elektrische Verteilung.
„Um diese Vorgänge gewissermaßen dem Auge sichtbar zu machen, dient
dieser einfache Apparat hier: ein auf einer isolierten Glassäule
ruhendes und mit Kugelenden versehenes Messingrohr; hier nahe den
beiden Enden habe ich je zwei Holunderkügelchen an leinenen
Fäden aufgehängt. Bringe ich nun diesen stark geriebenen Ebonitstab
in die Nähe des einen Endes dieses Konduktors, so sehen Sie, daß
die Kügelchen beider Paare einander abstoßen. Die Erklärung dieser
Erscheinung gibt Ihnen diese Tafel hier (Käthe nahm die zweite Tafel
hoch, auf der das in Abb. 35 dargestellte Schema zu sehen war): Dieser
negativ geladene Ebonitstab zieht die positiven Elektrizitätsteilchen
auf die ihm zugekehrte Seite des Konduktors und treibt alle anderen
nach dem entgegengesetzten Ende; daher werden die beiden Kügelchen
eines jeden Paares gleichnamig geladen und stoßen einander deshalb ab.
Entferne ich nun den Stab wieder, so sinken sie zusammen.
[S. 42]
Ich kann die Verteilung der Elektrizitäten auch noch anders nachweisen.
Ich entferne zu diesem Zwecke die Kügelchen. Hier habe ich an einem
Seidenfaden eine kleine Messingkugel aufgehängt; bringe ich sie
mit einem elektrisch geladenen Körper in Berührung, so nimmt sie
dessen Elektrizität an, wie vorhin jenes Holundermarkkügelchen. Ich
will nun an diesem Gestell hier das elektrische Pendel, wie man die
Einrichtung auch nennt, mit positiver Elektrizität laden, indem ich
es mit dem geriebenen Glasstabe berühre. Bringe ich nun wieder wie
vorhin den Ebonitstab in die Nähe des Konduktors und berühre mit diesem
Messingkügelchen, das durch den Seidenfaden von meiner Hand isoliert
ist, das dem Ebonitstab zugewandte Ende dieses Leiters, so muß es
dessen Elektrizität annehmen; welcher Natur diese ist, können wir an
dem elektrischen Pendel sehen; es ist positiv geladen und wird von
dem Messingkügelchen abgestoßen, also enthält letzteres auch positive
Elektrizität, welche ich ihm durch Berühren mit der Hand entziehe. Ich
mache nun den gleichen Versuch, berühre das dem Ebonitstab abgewandte
Ende des Konduktors, und Sie sehen, daß das Holundermarkpendel von dem
Messingkügelchen angezogen wird. Wir haben also wirklich auf diesem
Konduktor die beiden Elektrizitäten getrennt.
Ich bringe nun an dem Konduktor die beiden elektrischen Pendel wieder
an. Wenn ich den Ebonitstab in die Nähe bringe, so divergieren sie,
wenn ich ihn entferne, so fallen sie wieder zusammen. Wenn ich aber
diesen Konduktor, während der Hartgummistab in der Nähe ist, einen
Augenblick mit dem Finger berühre und dann den Stab entferne, so
divergieren nun beide Pendel, obgleich ich den elektrischen Stab
weit entfernt halte. Die Erklärung des Vorganges ist sehr einfach:
Berühre ich den Konduktor, dessen Elektrizitäten durch die Nähe
des elektrischen Stabes verteilt sind, mit der Hand, so wird die
abgestoßene negative Elektrizität zur Erde abgeleitet, während seine
positive, durch die negative des Ebonits gebunden, allein zurückbleibt;
entferne ich nun zuerst die Hand, dann den Stab, so bleibt der Rest
positiver Elektrizität auf dem ganzen Leiter verteilt zurück, wie die
Pendel zeigen; daß[S. 43] nun an beiden Enden wirklich gleiche Elektrizitäten
sind, können wir wieder mit dem Messingkügelchen nachweisen (hier
führte Rudi den oben genannten Versuch nochmals aus). Dadurch sind
wir also in stand gesetzt, einem isolierten Körper eine elektrische
Ladung zu geben. Man sagt, z. B., dieser Messingkonduktor sei positiv
geladen. Bringe ich in die Nähe eines solchen geladenen Körpers einen
ungeladenen, mit der Erde in leitender Verbindung stehenden, z. B.
meinen Finger, so sehen Sie, daß ein kleiner Funke überspringt. (Damit
dieser Funke besser gesehen werde, beschattete Käthe mit einem großen
schwarzen Karton den Konduktor und die Hand ihres Bruders.) Was ist
nun dieser Funken, woher kommt er und wann tritt er auf? Die positive
Elektrizität des Konduktors zieht die negative Elektrizität meines
Körpers an; es sammelt sich also in meiner Fingerspitze eine gewisse
Menge negativer Elektrizität an; je mehr ich den Finger dem Konduktor
nähere, desto stärker naturgemäß wirken die beiden Elektrizitäten
aufeinander und schließlich so stark, daß sie den Widerstand, den der
Luftzwischenraum ihnen entgegensetzt, überwinden und sich durch die
Luft hindurch vereinigen.
Das Elektroskop.
Hier habe ich nun noch einen einfachen Apparat, der dazu dient,
geringere Mengen von Elektrizität nachzuweisen: Er besteht aus einer
Glasflasche, durch deren Kork ein Messingstäbchen geht, das hier unten
zwei Plättchen aus ganz dünnem Metall trägt. Bringe ich in die Nähe
dieser Kugel einen elektrischen Körper, so tritt, wie vorhin bei dem
Konduktor, elektrische Verteilung ein, weshalb die beiden Plättchen, da
sie gleichnamig geladen sind, divergieren.
Das Elektrophor.
Die Tatsachen der elektrischen Verteilung hat man benutzt, um einen
einfachen Apparat zur Erzeugung von Elektrizität zu konstruieren. Es
ist das Elektrophor. Sie sehen hier eine Scheibe aus Schellack; ich
lege sie auf ein Blatt Stanniol und reibe sie mit einem Fuchsschwanz
ab, wodurch sie elektrisch wird. Lege ich nun einen Metalldeckel hier
darauf, so wird in ihm die Elektrizität so verteilt, daß die positive
auf der Unterseite, von der negativen des Kuchens gebunden,[S. 44] die
negative auf der Oberseite sich befindet; berühre ich den Deckel mit
der Hand, so leite ich dadurch die abgestoßene negative Elektrizität
ab und es bleibt nur noch positive zurück. Hebe ich die Metallscheibe
jetzt an dem isolierenden Glasgriff empor, so kann ich ihr, wie vorhin
bei dem Konduktor, mit dem Finger einen Funken entlocken.
Oberflächenverteilung und Spitzenwirkung.
Aus all diesen Experimenten geht also, um dies nochmals zu betonen,
deutlich hervor, daß die gleichnamigen Elektrizitäten einander
abstoßen, sich so weit voneinander entfernen, als sie nur können, und
daß die ungleichnamigen einander anziehen und binden. Wenn wir dies
bedenken, dann müssen wir zur Annahme kommen, daß z. B. bei einer
elektrisch geladenen Kugel sich die größte Menge der Elektrizität auf
der Oberfläche ansammeln muß, da ja die einzelnen elektrischen Teilchen
einander fliehen, soweit sie nur können; oder daß bei einem mit Ecken
und Spitzen versehenen Körper sich die Elektrizität besonders in diesen
anhäuft. Dies ist auch in der Tat der Fall, wie wir mit dieser Kugel
beweisen können: Ich will sie einmal mittels des Elektrophors mit
positiver Elektrizität laden und ebenso dieses Holundermarkkügelchen.
Sie sehen, das Holundermark wird abgestoßen; nun umgebe ich die Kugel
mit diesen beiden Halbkugeln (Abb. 4), entferne sie wieder, und Sie
sehen, diese stoßen das Holundermarkkügelchen ab, während nun die Kugel
unelektrisch geworden ist.
Das elektrische Flugrad.
Daß sich die Elektrizität besonders stark in Spitzen anhäuft und
infolge davon auch leicht aus diesen in die Luft ausströmt, beweist
das sogenannte elektrische Flugrad. Ich habe hier ein Rädchen mit
umgebogenen Spitzen; ich setze es auf eine Nadel, welche ich durch
ein Kettchen mit dieser Maschine, die ich nachher noch erklären
werde, verbinde; durch die Drehung der Scheibe dieser Maschine wird
Elektrizität erzeugt, die sich nun in den Nadelspitzen ansammelt,
und schließlich so stark aus ihnen ausstrahlt, daß sich infolge des
Rückstoßes das Rädchen dreht. Nehme ich das Rädchen ab, halte diese
einzelne Nadelspitze gegen die Flamme der Kerze hier und lasse die
Maschine drehen, so[S. 45] sieht es aus, als ob von dieser Spitze ein Wind
ausginge; dies ist auch in der Tat der Fall, und die Erscheinung rührt
daher, daß infolge der starken Ansammlung der Elektrizität in der
Spitze die benachbarten Luftteilchen ebenfalls elektrisch werden, und
da sie nun die gleiche Elektrizität enthalten wie die Spitze, so werden
sie von dieser abgestoßen, was dann die Winderscheinung, elektrischer
Wind genannt, verursacht.
Kondensatoren.
Aus den eben vorgeführten Experimenten ist ersichtlich, daß es nicht
gerade so ganz einfach sein wird, auf einem Leiter eine größere Menge
von Elektrizität anzusammeln; denn sobald sie eine gewisse Dichte
erreicht hat, so fängt sie an, einfach in die Luft auszuströmen.
Um dies zu verhindern, hat man, ich möchte sagen, eine kleine List
angewendet:
Franklinsche Tafel.
Ich habe hier eine Glastafel, auf beiden Seiten mit Stanniol überzogen;
lade ich mit dem Elektrophor die eine Seite mit positiver Elektrizität,
so wirkt diese verteilend auf die Elektrizitäten des anderen Belages:
die negative wird angezogen, die positive abgestoßen. Berühre ich
nun diesen Belag mit dem Finger, so leite ich die freie, abgestoßene
Elektrizität fort; nun ist hier nur noch negative und auf der anderen
Seite positive Elektrizität; da beide einander anziehen und sich
deshalb binden, so kann ich nun noch mehr positive Elektrizität
zuführen. Der gleiche Vorgang wird sich wiederholen, und ich kann ein
drittes Mal laden u. s. f. bis zu einer gewissen Grenze, die wir später
kennen lernen werden. Erwähnt sei noch, daß es nicht einerlei ist,
welcher Stoff sich zwischen den beiden Leitern befindet. Stelle ich
zwei Metallplatten, die den Stanniolblättern dieser Tafel entsprächen,
mit geringem Abstand einander gegenüber, so daß nur Luft dazwischen
ist, so kann ich keine so starke Ladung erzeugen, als wenn ich z. B.
eine isolierende Flüssigkeit (Petroleum) oder einen festen Körper
dazwischen bringe. Die Kapazität, d. i. Aufnahmefähigkeit für
Elektrizitätsmengen, ist also nicht nur von der Größe des Leiters,
sondern auch von der Natur der isolierenden Substanz abhängig. Man
hat nun bestimmt, wievielmal größer die Kapazität der gleichen
Metallplatten bei gleichem Abstand wird, wenn[S. 46] man statt Luft andere
Isolatoren verwendet; die Zahlen, die sich dabei für die verschiedenen
Stoffe ergeben haben, nennt man deren Dielektrizitätskonstanten
bezogen auf Luft = 1. Wir werden nachher eine Methode kennen lernen,
die uns erlaubt, die Kapazität eines Kondensators zu messen. Habe
ich zwei Metallplatten, die auf Glasfüßen isoliert nur 5 mm
voneinander entfernt stehen, so kann ich, sofern nur Luft zwischen
den Platten ist, auf der einen Platte, während die andere zur Erde
abgeleitet ist, eine gewisse Elektrizitätsmenge aufladen; bringe ich
z. B. Glas dazwischen, so kann mehr Elektrizität in die Platte dringen.
Ich führe den Versuch nicht aus, weil er mich zu lange aufhielte.
Leidener Flasche.
Nichts anderes als eine veränderte Form dieser Tafel, die auch die
Franklinsche Tafel genannt wird, ist die Kleistsche oder Leidener
Flasche. Sie sehen eine solche hier. Will ich sie laden, so stelle
ich sie so auf, daß der äußere Stanniolbelag in leitender Verbindung
mit der Erde steht, damit die freie Elektrizität abströmen kann. Ich
kann die Leidener Flasche dadurch laden, daß ich möglichst oft aus
dem geladenen Elektrophorteller ein Fünkchen in den Messingknopf der
Flasche, der durch diese Stange mit dem inneren Belag in Berührung
steht, überspringen lasse. (Während Rudi so sprach, führte Käthe den
Versuch aus.) Nachdem nun etwa fünfzig kleine Fünkchen in die Flasche
übergegangen sind, will ich das Laden unterbrechen und den gebogenen
Draht, den ich an diesem isolierenden Griffe anfasse, mit dem einen
Ende an den äußeren Belag anlegen und das andere der Kugel nähern
(ein heller klatschender Funke sprang über). Nun haben die beiden
Elektrizitäten, die sich durch das Laden auf den Belägen angesammelt
haben, durch den mittels des Entladers verkürzten Luftzwischenraum
hindurch einander ausgeglichen, wodurch die Flasche unelektrisch, das
heißt entladen worden ist.
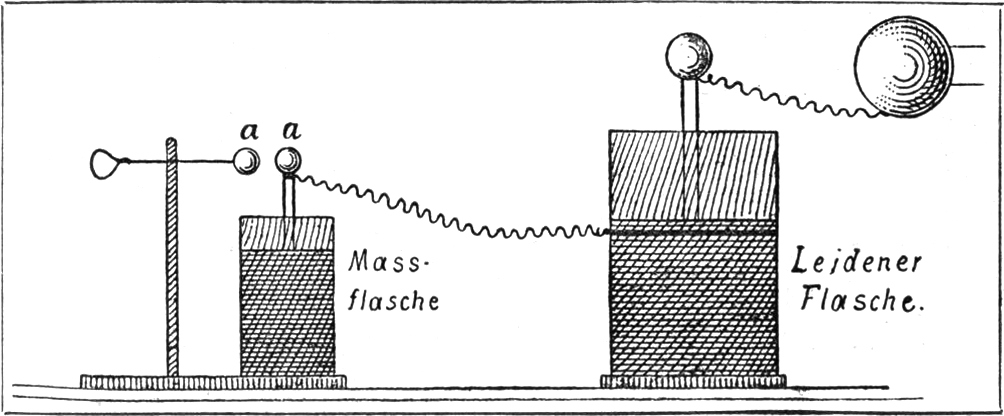
Abb. 36. Messen der Kapazität.
Die Massflasche.
Die Mengen der Elektrizität, die sich in einer solchen Flasche
ansammeln lassen, sind nicht unbegrenzt, sondern hängen von der Größe
der Stanniolbeläge und von dem Dielektrikum ab; je mehr[S. 47] Elektrizität
ein Kondensator, wie solche Sammelvorrichtungen auch genannt werden, zu
fassen vermag, desto größer ist seine Kapazität, und wir können diese
Kapazität eines Kondensators messen, indem wir die eines anderen als
Maß benutzen. Einen solchen Maßstab sehen Sie hier; er ist im Grunde
nichts anderes, als eine gewöhnliche Leidener Flasche. Ich kann z. B.
messen, wievielmal so groß die Kapazität dieser großen Flasche ist
als die einer kleineren. Ich stelle den Kondensator, dessen Kapazität
ich messen will, isoliert auf. (Käthe, welche unterdessen
die Apparate zusammengestellt und verbunden hatte, verwendete zur
isolierenden Aufstellung der großen Flasche den Elektrophorkuchen, den
sie noch mit einem vierfach zusammengelegten Seidentuche bedeckte. Dann
stellte sie den Karton mit dem in Abb. 36 dargestellten Schema auf.)
Ich verbinde den äußeren Belag der zu messenden mit dem inneren der
messenden Flasche und den inneren der ersteren mit dem Konduktor der
Elektrisiermaschine. Setze ich nun diese in Bewegung, so wird die große
Flasche geladen; die dabei frei werdende Elektrizität auf dem äußeren
Belag der großen Flasche wird hier aber nicht zur Erde abgeleitet,
sondern dazu benutzt, die Maßflasche zu laden. Stelle ich nun diese
beiden Kugeln (a a in Abb. 36) auf einen bestimmten
Abstand, so wird sich die Maßflasche, sobald sie eine gewisse Ladung
erhalten hat, durch den geringen Zwischenraum hindurch entladen,
um gleich wieder von der immer noch frei werdenden Elektrizität
des äußeren Belages neu geladen zu werden,[S. 48] bis ein zweiter Funke
überspringt. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis auf der
großen Flasche keine freie Elektrizität mehr auftritt, das heißt bis
sie ganz geladen ist. Ich lasse nun die Maschine in Bewegung setzen
und zähle die überspringenden Funken: eins — zwei — drei — vier
— fünf — sechs — — nun kommt keiner mehr. Die hier frei werdende
Elektrizität hat also ausgereicht, die kleine Flasche sechsmal zu
laden. Ich will nun statt dieser eine größere Flasche benutzen. (Rudi
schaltete jetzt seine größte Leidener Flasche ein und wiederholte den
Versuch, wobei zwölf Funken übersprangen.) Hier sind nun zwölf Funken
übergesprungen, also gerade nochmal so viel wie bei der kleineren
Flasche; die Kapazität dieser ist also nur halb so groß, als die der
großen. Der besprochene Apparat wird nach seinem Erfinder die Lanesche
Maßflasche genannt.
Die Reibungselektrisiermaschine.
Ich will nun noch die Maschine, die ich heute schon mehrmals gebraucht
habe, und ihre Wirkungsweise erklären. Sie erinnern sich ja noch, daß
der Glasstab, mit dem amalgamierten Lederlappen gerieben, elektrisch
wurde. Hier bei dieser Maschine wird eine Glasscheibe dadurch,
daß man sie zwischen zwei anliegenden, amalgamierten Lederkissen
dreht, elektrisch; unweit des Reibzeuges ist die Scheibe von zwei
mit vielen Spitzen versehenen Brettchen umfaßt; die Spitzen, die
aus Stecknadeln hergestellt sind, stehen in metallischer Verbindung
mit der Messingkugel. Erinnern Sie sich nun an die Erscheinungen
der elektrischen Verteilung, so werden Sie leicht einsehen, daß von
der positiv geladenen Glasscheibe die positive Elektrizität in die
Kugel abgestoßen, die negative aber in die Spitzen angezogen wird.
Die Folge davon ist, daß die negative Elektrizität, von den Spitzen
auf die Glasscheibe ausströmend, diese unelektrisch macht, auf dem
Konduktor dagegen sich freie positive Elektrizität zeigt. Aber nicht
nur dies tritt ein, sondern man kann geradezu sagen, daß die positiven
Elektrizitätsteilchen der Glasscheibe, da sie einander gegenseitig
abstoßen, einander selbst in die Spitzen hineinjagen, oder, wie man
sich fälschlicherweise auszudrücken pflegt, von diesen ausgesaugt
werden; daher auch der Name Saugspitzen.
[S. 49]
Die Influenzelektrisiermaschine.
Eine zweite Maschine, die ebenfalls zur Erzeugung von Elektrizität
dient, sehen Sie hier vor sich; es ist die sogenannte Wimshurstsche
Maschine. Sie ist auf dem Prinzip der Influenz — daher auch
Influenzelektrisiermaschine genannt — konstruiert. Elektrische
Influenz ist im allgemeinen nicht verschieden von der schon eingehend
besprochenen elektrischen Verteilung. Hier sind zwei Ebonitscheiben,
die in entgegengesetzter Richtung gedreht werden; diese aufgeklebten
Stanniolsektoren wirken gegenseitig etwa so, wie bei den Versuchen
über elektrische Verteilung der Hartgummistab und der Konduktor. Die
Ableitung der freien Elektrizität, die dort durch Berühren mit der Hand
hergestellt wurde, besorgen hier die Ausgleicher; nur werden dabei die
freien Elektrizitäten der Sektoren, die jeweils von diesen Pinselchen
berührt werden, nicht zur Erde abgeleitet, sondern sie gleichen
einander aus; daher der Name Ausgleicher. Durch diese Wechselwirkungen
wird erreicht, daß die Stanniolsektoren der beiden Glasscheiben gerade
dann gleiche Ladung haben, wenn sie einander zwischen den
Spitzenkämmen gegenüberstehen. Da jedoch die beiden Elektrizitäten
einander abstoßen, so treiben sie einander in die Spitzen, und durch
die Elektrodenstangen, die zu Anfang zusammenstoßen müssen, findet ein
Ausgleich der beiden Elektrizitäten statt. Entferne ich nun die Kugeln
etwas voneinander, so geht ein kontinuierlicher Funkenstrom über.
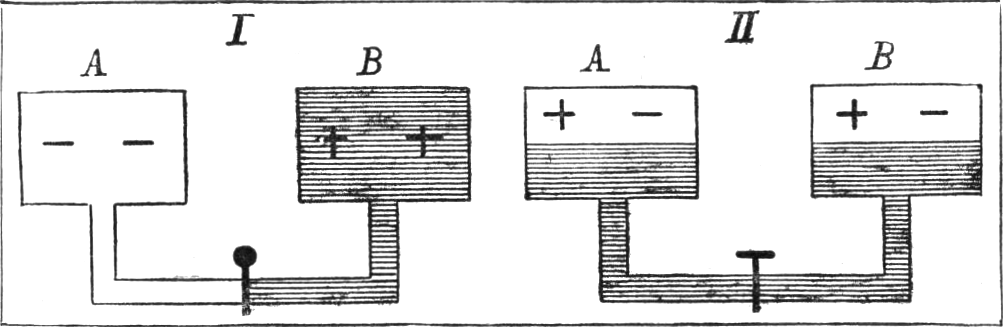
Abb. 37. Darstellung des Ausgleiches der Elektrizitäten.
Ausgleich der verschiedenen Elektrizitäten.
Über den Ausgleich der Elektrizitäten will ich nun noch einiges
erwähnen. Sie haben solche Ausgleiche bei dem Funken des
Elektrophortellers und bei der Entladung einer Leidener Flasche schon
gesehen. Wir haben oben gesagt, daß die Elektrizität als ein Zustand
des Äthers aufzufassen ist, ein Zustand, der von bestimmten Punkten
eben jener oben schon erwähnten Elektronen ausgeht und sich mit diesen
im Raum bewegen kann. Wir haben bisher hauptsächlich Erscheinungen der
ruhenden Elektronen betrachtet; in dem Ausgleich der verschiedenen
Elektrizitäten erkennen wir aber bewegte Elektronen. Wie man sich
nun den Vorgang eines derartigen Ausgleiches[S. 50] vorstellen kann, möge
Ihnen aus folgender Analogie erhellen: Sie erblicken hier auf dieser
Tafel (Rudis Schwester erhob den Karton, dessen Zeichnung in Abb. 37
dargestellt ist) zwei Behälter, deren einer mit Wasser gefüllt ist;
hier unten ist ein Hahn, den wir uns vorerst geschlossen denken wollen.
Der gefüllte Behälter stellt einen positiv geladenen Leiter dar, der
leere einen solchen mit negativer Ladung; der geschlossene Hahn
kommt der isolierenden Substanz gleich, die die beiden Leiter noch
trennt. Öffne ich nun den Hahn, so fließt ein Teil des Wassers in den
anderen Behälter, bis es in beiden gleich hoch steht. Die analoge
Erscheinung bei entgegengesetzt elektrisch geladenen Körpern tritt ein,
wenn wir sie mit einem Draht verbinden, oder so nahe zusammenrücken,
daß ein Funke überspringt. Dabei ist aber eines noch zu beachten: bei
dem Beispiel mit den Wasserbehältern scheint der Ausgleich nur in der
einen Richtung und zwar in der des fließenden Wassers zu geschehen;
wir müssen uns deshalb die ursprüngliche Leere des Behälters
A auch als ein bewegliches Medium vorstellen, das beim Öffnen
des Hahns in B hinüberfließt, also entgegen dem Wasserstrom. Ich
will einmal annehmen, B sei mit zwei Raummengen Wasser, die hier
mit zwei Pluszeichen angegeben sind, gefüllt; diesen entsprechen zwei
Raummengen Leere im Behälter A, die mit zwei Minuszeichen
veranschaulicht seien. Öffne ich nun den Hahn, so fließt die Hälfte
der Wassermenge aus B in A hinüber; dadurch ist nun
A nur noch halb leer, B dagegen nur noch halb voll; in
jedem Behälter ist also ein Raumteil Leere und ein Raumteil Wasser. Die
zweite Figur der Tafel zeigt Ihnen diesen Zustand. Sie sehen hier in
jedem Behälter je ein + und ein −; auf die[S. 51] elektrischen Verhältnisse
übertragen, heißt das so viel als daß der Körper A und der
Körper B nun unelektrisch sind.
Der elektrische Strom.
Wenn man von einem elektrischen Strome spricht, so versteht man
gewöhnlich nur den positiven Richtungsstrom darunter, das heißt in
unserem Beispiel nur den Fluß des Wassers aus dem gefüllten in den
leeren Behälter. Man darf aber dabei nie vergessen, daß ebenso, nur in
entgegengesetzter Richtung, der negative Strom fließt. Was in unserem
Beispiel die Röhre ist, durch die bei geöffnetem Hahn das Wasser
fließt, ist bei der Elektrizität eine leitende Verbindung, z. B. ein
Metalldraht. Also so wie durch die Röhre das Wasser, so fließt durch
den Draht, der zwei entgegengesetzt geladene Körper verbindet, ein
elektrischer Strom, oder genauer zwei Ströme, ein positiver und ein
diesem entgegengesetzter negativer.
Erwärmung durch den elektrischen Strom.
Daß in einem zwei verschieden geladene Körper verbindenden Draht
tatsächlich etwas vor sich geht, beweist neben vielem anderen der
Umstand, daß sich dieser Draht erwärmt. Die Erwärmung können wir
mit einem Apparat (Abb. 14) nachweisen. Ich habe hier in einem
geschlossenen Raum eine Drahtspirale, durch welche ich einen
elektrischen Strom leiten kann; wird nun durch diesen Strom der Draht
warm, so wird die Luft erwärmt, dehnt sich aus, drückt dadurch auf
die blaue Flüssigkeitssäule in der Glasröhre und wird sie um einige
Dezimeter herunterschieben. (Rudi machte den Versuch, indem er die
Entladung seiner größten Leidener Flasche durch die Drahtspirale des
Apparats gehen ließ.)
Der Blitz.
Ich will nun noch einiges über die allen bekannte elektrische
Erscheinung des Gewitters sagen. Der Blitz ist ein riesenhafter
elektrischer Funke, oft von mehreren Kilometern Länge. In seiner Natur
ist er von den Funken, die ich hier erzeugen kann, nicht verschieden;
auch er ist der Weg eines elektrischen Ausgleiches durch die Luft.
Die Lichterscheinung rührt von der kolossalen Erwärmung der Luft
und der Staubteilchen her, die dabei ins Glühen geraten. Woher die
Wolken, zwischen denen der Blitz überspringt, ihre elektrische Ladung
erhalten, kann heute noch niemand bestimmt sagen, es bestehen allerhand
Hypothesen hierüber,[S. 52] doch ist keine haltbar genug, um der Erwähnung
wert zu sein. Wir müssen uns mit einer allgemeinen Betrachtungsweise
zufrieden geben. Wenn wir eine isolierte Spitze oder besser eine Flamme
mit den Blättchen eines guten Elektroskopes (siehe Anhang) verbinden
und sie an einer langen Stange in die Luft hinaufhalten, während das
Gehäuse mit der Erde leitend verbunden ist, so erhalten wir einen
Ausschlag, dessen Größe von vielen Faktoren, z. B. Ort, Jahreszeit,
Feuchtigkeit, Temperatur, Abstand von der Erde usw. abhängig ist.
Diese Tatsache beweist, daß von den höheren Luftschichten nach der
Erde zu ein Potentialgefälle vorhanden ist, das man bei sehr großen
Schwankungen auf rund 100 Volt pro Meter veranschlagen kann; daraus
folgt, daß die ganze Erdoberfläche eine starke negativ-elektrische
Ladung besitzt. Dieses bei gutem Wetter ziemlich gleichmäßige
Spannungsgefälle erleidet bei Wolken- und Gewitterbildungen ganz
beträchtliche Störungen, die so stark werden können, daß zwischen
Wolken und Erde oder zwischen zwei Wolken Spannungsdifferenzen
auftreten, die in die Millionen Volt betragen. Die Folge dieser großen
Spannungen ist der Blitz. Sind die Spannungen nicht so stark, daß es
zum Funkenausgleich kommt, so findet eine allmähliche Ausstrahlung der
Elektrizität statt, was sich bei Nacht durch feine „Büschellichter“,
auch „St. Elmsfeuer“ genannt, zu erkennen gibt: An Blitzableitern,
Hausvorsprüngen, Schiffsmasten und ähnlichen hervorragenden
Gegenständen sieht man bläuliche Lichtbüschel, die den Glimmentladungen
unserer Elektrisiermaschinen gleichen. Endlich sei auf die ebenfalls
elektrische Erscheinung des „Nordlichtes“ besser „Polarlicht“ noch
hingewiesen; man sieht in polaren Zonen nachts eigenartige prächtige
Lichterscheinungen am Himmel, die in ihrer Häufigkeit und Intensität im
Zusammenhang zu stehen scheinen mit den Perioden der Sonnenflecke. Man
will sie mit den Erscheinungen, die wir später bei den Geißlerröhren
kennen lernen werden, in Zusammenhang bringen, doch sind gerade hier
die bekannten Tatsachen noch zu spärlich. Es fehlt uns eben für die
Elektrizität ein Sinn; wir können sie nicht sehen, nicht hören, nicht
schmecken usw. Das ist auch der Grund, warum es so lange dauerte, bis[S. 53]
es gelang, mehr in das Wesen der Elektrizität einzudringen, nur aus
ihren Wirkungen konnte man auf ihre Gesetze schließen. Dem ernsten
und unermüdlichen Forscherstudium ist es aber heute gelungen, den
Zusammenhang dieser bisher so geheimnisvollen Naturerscheinungen mit
den übrigen unseren Sinnen direkt zugänglichen und daher viel früher
erkannten zu finden. Noch nicht alle Fragen sind gelöst, aber der Weg
der Erkenntnis liegt offen vor uns.“
Kritik des Vortrages.
Sich verbeugend schlug Rudi sein Vortragskonzept, in das er nur selten
einen flüchtigen Blick geworfen hatte, zu, und während die Zuhörer
eifrig Beifall klatschten, verschwand er, gefolgt von seiner Schwester,
mit würdiger Miene, wie er gekommen. — Unter den Zuhörern war auch
ein sachkundiger Onkel, der den Abend noch in der Familie verbrachte.
Diesen bat Rudi um eine ausführliche Kritik über den Vortrag, welche
etwa folgendermaßen lautete:
„Zuerst muß ich bemerken, daß der ganze Vortrag ein klein wenig zu
lang war; er hat zu vielerlei gebracht, und das hat sicher viele des
Aufpassens ungewohnte Zuhörer ermüdet. Du hättest manches weglassen
können, wie z. B. die ausführliche Beschreibung der Maßflasche; auch
hätten andere Abschnitte wie der über elektrische Verteilung kürzer
zusammengefaßt werden dürfen. Die Anordnung des Ganzen war gut, nur
hätte ich die Beschreibung der Reibungselektrisiermaschine früher
gebracht. Auch die Experimente waren gut ausgeführt bis auf die ersten
Versuche mit den Holundermarkkügelchen, die sich, da sei weiß waren,
von dem weißen Kleide der meist dahinterstehenden Käthe kaum abhoben;
ein schwarzer Karton, hinter den elektrischen Pendeln aufgestellt,
hätte diesen Übelstand beseitigt. Im übrigen kann ich,“ fuhr der Onkel
zu Käthe gewandt fort, „der kleinen Assistentin nur meine größte
Bewunderung und Anerkennung aussprechen. Ferner hätte ich an deiner
Stelle, wie schon gesagt, vieles kürzer gestaltet, dafür aber noch
eingehender über die Gewitterbildung gesprochen. Den Blitzableiter
und seine Wirkung hast du ganz vernachlässigt, und das hatte doch
sicher sehr viele der Zuhörer interessiert; das hättest du schon bei
der Erwähnung[S. 54] der Spitzenwirkung vorbringen können.“ „Ja,“ warf Rudi
ein, „den Blitzableiter habe ich im Vortrag nur vergessen, im Konzept
steht ein ganzer Abschnitt darüber.“ „Dann habe ich nichts weiter
auszusetzen; du hast laut und deutlich gesprochen, und das ist immer
viel wert.“ Nun sprachen die beiden noch über die verschiedensten
Experimente, und Rudis Onkel wußte noch ein wenig gekanntes, aber
leicht ausführbares und sehr interessantes Experiment: Die Benutzung
einer Influenzelektrisiermaschine als Motor.
Die Influenzmaschine als Motor.
Am sichersten gelingt der Versuch mit zwei Influenzmaschinen,
einer größeren und einer kleineren; man kann aber auch eine der
Influenzmaschinen durch eine gute Reibungselektrisiermaschine
ersetzen. Von der Maschine, die als Motor dienen soll, entfernt man
die Treibschnüre und verbindet die auseinandergeschobenen Elektroden
durch zwei Kupferdrähte mit den sich anfangs berührenden Elektroden
der größeren Influenzmaschine, die man nun in Gang setzt, wonach die
Elektroden so weit als möglich voneinander entfernt werden. Dadurch
erhalten die beiden Spitzenkämme der als Motor dienenden Maschine
entgegengesetzte Ladungen, z. B. der rechte positive, der linke
negative; so werden beide Scheiben auf der rechten Seite positiv und
auf der linken negativ elektrisch; sie stoßen also einander ab und
beginnen sich in entgegengesetzter Richtung zu drehen, wobei die
elektrischen Vorgänge genau so, nur in umgekehrter Reihenfolge, wie bei
der die Elektrizität erzeugenden Maschine eintreten. Es ist möglich,
daß dabei anfangs die beiden Scheiben derart einander das Gleichgewicht
halten, daß sie sich nicht von selbst zu drehen beginnen; es genügt
dann ein kleiner Anstoß der einen Scheibe. Hat man die Maschine kurz
vorher in Gang gesetzt, so läuft sie sicher von selbst an.
Es sei nun noch erwähnt, daß der Besitzer eines sogenannten
Elektrophorkastens die darin meist sehr zahlreich vorhandenen
elektrischen Spielzeuge in einem solchen Vortrage nur möglichst
kurz vorführen soll; sie unterhalten zwar die Zuschauer, haben aber
theoretisch zu wenig Bedeutung; es sind eben nur Spielzeuge, und wir
haben darum auch die Beschreibung ihrer Herstellung weggelassen.
Da Rudis erster Vortrag allgemeine Anerkennung bei seinen Verwandten
und Bekannten gefunden hatte, ließ er nicht viel Zeit verstreichen,
bis er an die Vorbereitungen zu einem zweiten ging. Er wollte diesen
wissenschaftlicher gestalten als den ersten und darum nur Freunde und
solche Verwandte einladen, bei denen er mehr Vorkenntnisse voraussetzen
konnte. Für die Tanten und Cousinen wollte er dann außerdem noch einen
gemeinverständlichen Vortrag halten.
Da es zu weit führen würde, so sei diesmal nicht der ganze Vortrag
wörtlich wiedergegeben, sondern es sollen nur die ausgeführten
Experimente beschrieben werden. Auch setzte sich Rudi diesmal das, was
er sprechen wollte, nicht wörtlich auf, sondern legte sich nur eine
Übersicht zurecht, die er während des Vortrages auf dem Tisch liegen
hatte; damit er nicht wieder einen Teil vergesse, strich er jeweils den
behandelten Abschnitt in seiner Niederschrift, dem Konzept, durch.
Auch diesmal sollte Käthe wieder die Assistentin sein; sie half nicht
nur bei der Ausführung der Versuche, sondern sogar bei der Herstellung
der Apparate selbst.
Geschichte der Entdeckung des galv. Stromes.
In der Einleitung des Vortrages erwähnte Rudi, daß man während
langer Zeit keine andere Methode als die der Reibung und Influenz
zur Erzeugung von Elektrizität kannte, bis im Jahre 1789 Galvani,
Professor der Medizin in Bologna, eine ihm anfangs unerklärliche
Beobachtung machte: er hatte, um den Einfluß der Luftelektrizität auf
die Nerven zu untersuchen, an einem eisernen Geländer eine Anzahl an
einen Kupferdraht befestigte Froschschenkel aufgehängt. Sobald nun der
Wind diese hin und her blies und die unteren[S. 56] Enden der Schenkel das
Eisengeländer berührten, zuckten sie heftig zusammen. Galvani selbst
kam aber dem Wesen dieser Erscheinung nicht auf die Spur, und erst
Volta stellte fest, was für Bedingungen erfüllt sein müßten, damit
der Versuch gelänge. Erstens mußten irgend zwei verschiedene Metalle
vorhanden sein (bei Galvanis Versuch waren es Eisen und Kupfer), die
einander einerseits unmittelbar berühren, anderseits aber durch eine
salzige oder sauere Flüssigkeit verbunden sind (der im Salzwasser
gewaschene Froschschenkel). Der Froschschenkel selbst war für das
Gelingen des Versuches nur insofern nötig, als er einen an sich
unsichtbaren Vorgang anzeigte, indem er durch sein Zucken erkennen
ließ, daß irgend etwas in ihm vorginge.
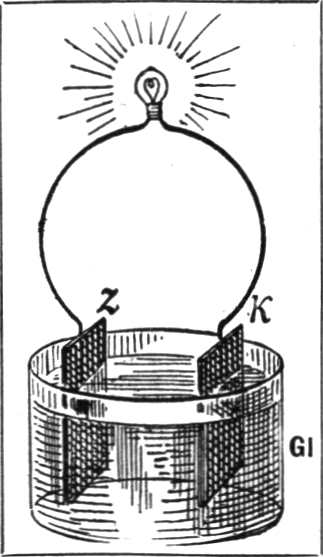
Abb. 38. Darstellung des galvanischen Stromes.
Die Entstehung des galv. Stromes.
Volta fand nun durch eine ganze Reihe von Versuchen folgendes: Werden
zwei verschiedene Metalle in eine angesäuerte Flüssigkeit gebracht
und außerhalb derselben durch einen Draht verbunden, so spielt sich
in dem dadurch gebildeten geschlossenen Kreis ein ganz bestimmter
Vorgang ab. Der Anzeiger dieses Vorganges war anfangs der zuckende
Froschschenkel, doch entdeckte man bald eine ganze Anzahl besserer
und zweckmäßigerer (sicherer) Mittel, um das Vorhandensein dieses
Zustandes nachzuweisen. Man fand die Ähnlichkeit dieser Erscheinungen
mit den bekannten elektrischen Vorgängen und ein sicheres, wenn
auch nicht sehr feines Erkennungsmittel war die Erwärmung, die alle
vom Strom durchflossenen Leiter zeigen. Hier wies Rudi auf den
entsprechenden Versuch in seinem letzten Vortrag hin, während Käthe
folgendes einfache Experiment ausführte: In einem Glasgefäß (Gl
in Abb. 38) hatte sie verdünnte Schwefelsäure (1 Teil Schwefelsäure
und 10 Teile Wasser. Man muß hierbei zuerst das Wasser eingießen,
und dann unter ständigem Umrühren mit einem[S. 57] Glasstabe langsam die
Schwefelsäure zugießen, da eine sehr starke Erwärmung eintritt)[2].
In diese Flüssigkeit tauchte sie während des Vortrages eine Zink- und
eine Kupferplatte, die einander selbst nicht berühren durften; an
jeder Platte war ein etwa 30 cm langer Kupferdraht angelötet.
Zum Nachweis der Erwärmung bei geschlossenem Kreis hängte sie an die
Drahtenden eine kleine 1 Volt-Glühlampe, die nun hell aufleuchtete,
sobald die Platten in die Flüssigkeit kamen. Auch mit dem in Abb. 14
dargestellten Luftthermometer wies Rudi die Erwärmung des Drahtes nach
und sprach dann über die Vorgänge, die den elektrischen Strom erzeugten.
Die elektromotorische Kraft.
Wenn man irgend zwei verschiedene Metalle, z. B. Kupfer und Zink,
in eine angesäuerte Flüssigkeit taucht, so entsteht auf jedem der
beiden Metalle eine elektrische Spannung, das ist eine gewisse
elektrische Ladung, und zwar ist immer die eine der beiden Platten
positiv, die andere negativ elektrisch. Verbindet man nun die beiden
Platten mit einem Leiter, z. B. einem Kupferdraht, so gleichen sich
die verschiedenen Ladungen aus, doch es bilden sich sofort wieder
neue, so daß durch den Draht ein fortwährender Strom fließt. Dabei
bemerken wir, daß sich das Zink unter Wasserstoffbildung viel rascher
in der verdünnten Schwefelsäure auflöst als unter normalen Umständen,
ohne die Gegenwart eines anderen Metalles. Es spielt sich also auch
neben dem elektrischen ein chemischer Vorgang ab, und zwar ist der
chemische der primäre, der elektrische dagegen der sekundäre. Chemische
Vorgänge sind es, die den beiden Metallplatten ihre verschiedene Ladung
erteilen. Jedoch müssen auch noch andere Einflüsse dabei im Spiele
sein, denn man hat gefunden, daß es genügt, zwei verschiedene Metalle
ohne Feuchtigkeit[S. 58] miteinander in Berührung zu bringen, um auf ihnen
verschiedene Ladungen hervorzurufen; allein die Anschauungen über diese
Dinge sind noch nicht geklärt. Wir wollen nur daran festhalten, daß,
wenn irgend zwei verschiedene Metalle in eine angesäuerte Flüssigkeit
gebracht werden, auf ihnen entgegengesetzte Ladungen entstehen. Man
hat nun durch Versuche die Metalle so in einer Reihe angeordnet, daß
je ein vorhergehendes mit irgend einem nachfolgenden in eine saure
Flüssigkeit gebracht, immer positiv elektrisch wird, während das zweite
negative Ladung erhält. Dabei ist der Unterschied in der Stärke der
beiden Ladungen, die sogenannte Spannungsdifferenz, umso größer,
je weiter die Stoffe in der genannten Reihe, der Spannungsreihe,
auseinanderstehen. Je stärker die Spannungsdifferenz ist, umso stärker
wird auch der Strom sein, der den verbindenden Draht durchfließt. Der
Strom wird also von einer unbekannten, wahrscheinlich von chemischen
Vorgängen herrührenden Energie in Bewegung gesetzt und erhalten, und
man spricht deshalb von einer elektromotorischen Kraft; je
größer sie ist, umso stärker ist auch der Strom, den sie in Bewegung
setzen kann.
Soviel sprach Rudi etwa über die theoretischen Dinge und ging dann
dazu über, den Zuhörern die verschiedenen Arten von Stromquellen, bei
denen chemische Energie zur Erzeugung der Elektrizität verwendet wird,
vorzuführen.
Herstellung verschiedener Elemente.
Da es nicht nur von theoretischem, sondern auch von praktischem
Interesse ist, wie man mit einfachen Mitteln starke, ausgiebige
Stromquellen, sogenannte Elemente, sich herstellen kann, so sei an
dieser Stelle die Anfertigung einer größeren Anzahl der verschiedensten
Elemente beschrieben.
Das einfachste Element ist schon in der Abb. 38 dargestellt;
es gibt 1,1 bis 1,2 Volt; es ist ziemlich konstant, jedoch für
Demonstrationszwecke nur bei kurzer Benützung geeignet, da der sich
an der Zinkelektrode bildende Wasserstoff mit der Zeit lästig auf die
Atmungsorgane wirkt.
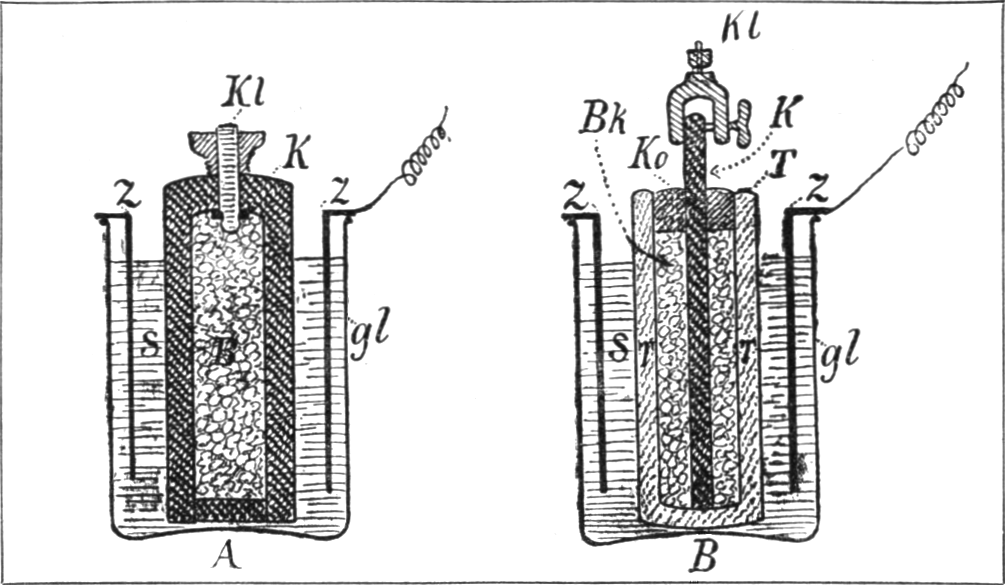
Abb. 39. Leclanché-Elemente.
Das Leclanché-Element.
Ein sehr einfaches und leicht herzustellendes Element ist das von
Leclanché. Wir können uns die Bestandteile dazu[S. 59] kaufen. Abb. 39
zeigt zwei verschiedene Formen: Bei A dient ein Hohlzylinder
aus Retortenkohle mit Braunstein gefüllt als positive Elektrode, bei
B steht dagegen ein Kohlenstab, in ein Gemisch von Kohle und
Braunstein eingebettet, in einem porösen Tonzylinder. Die einzelnen
Bestandteile der Elemente sind bei beiden: erstens ein Glasgefäß
(gl). Hierzu können gewöhnliche Einmachgläser verwendet werden;
auch kann man von hinreichend weiten Flaschen den oberen Teil samt
dem Hals absprengen. Dazu wird die Flasche vorsichtig über einer
Flamme so stark als möglich erwärmt (jedoch bei weitem nicht bis zum
Glühen!) und dann entlang der Stelle, an welcher der Sprung entstehen
soll, mit einem nassen Bindfaden umgeben, worauf der Hals abfällt.
Um die dabei entstehenden außerordentlich scharfen Ränder des Glases
unschädlich zu machen, versieht man sie mit einem Wulst von Siegellack,
der aber sehr heiß auf das vorgewärmte Glas aufgetragen werden muß,
da er sonst schlecht hält. Wir können uns auch vier- oder mehrkantige
Gläser nach der auf Seite 78 u. ff. beschriebenen Weise herstellen.
Zweitens ein Zinkzylinder (z). Diesen biegen wir aus mindestens
1,5 mm starkem Zinkblech und versehen ihn mit drei Ansätzen,
die auf dem Glasrande aufliegend ihn[S. 60] tragen; außerdem wird an einem
der Ansätze ein 30 cm langer, 1 bis 2 mm starker,
unisolierter, zur Spirale gewundener Kupferdraht angelötet und die
Lotstelle mit Asphaltlack bestrichen. Drittens bei A aus einem
hohlen Kohlenzylinder (K), der mit feingekörntem Braunstein
(B) gefüllt und unten mit einem Kork verschlossen ist; oben
in dem Kohlenzylinder ist eine Klemmschraube (Kl) befestigt.
Bei Abb. B haben wir einen porösen Tonzylinder (T)
in dem, wie schon erwähnt, ein in einem gleichteiligen Gemisch von
feingekörntem Braunstein und feingekörnter Retortenkohle (Reststücke
von Bogenlampenkohlen) oder Koks (Bk) eingebettet ein Kohlenstab
(K) steht, der um einige Zentimeter den Tonzylinder überragt.
An dem freien Ende wird eine Klemme (Kl) angebracht. Die
Braunsteinkohlefüllung darf den Zylinder nicht ganz ausfüllen, sondern
es sollen oben 2 bis 3 cm freibleiben, welcher Raum dann mit
Kolophonium (Ko) ausgegossen wird. Beide Elemente werden bis
einige Zentimeter vom oberen Rande mit gesättigter Salmiaklösung
gefüllt. Alle Kohlen und auch die Tonzylinder müssen an ihren oberen
Enden, soweit diese aus der Flüssigkeit herausragen sollen, einige
Minuten in kochendes Paraffin getaucht werden. Ein mit entsprechenden
Ausschnitten versehener Deckel aus einem Stück in Paraffin gekochter,
nicht zu schwacher Pappe verhindert das zu rasche Verdunsten der
Flüssigkeit.
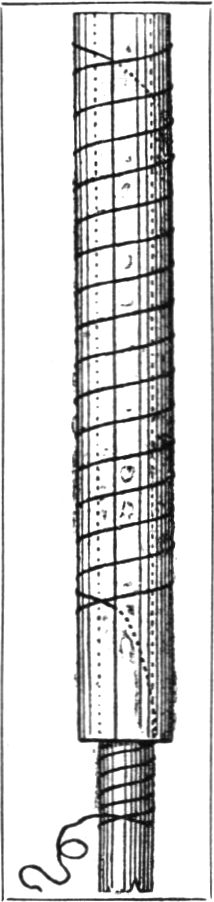
Abb. 40. Holzstab für Anfertigung von Gipszylindern.
Anfertigung von Gipszylindern.
Da wir bei den nachher zu beschreibenden Daniellschen und Bunsenschen
Elementen ebenfalls poröse Zylinder brauchen, so sei an dieser Stelle
die Herstellung solcher aus Gips beschrieben.
An Hand der folgenden fünf Abbildungen 40 bis 44 ist das Verfahren
leicht zu erklären. Wir richten uns einen etwa 30 cm langen, 3
bis 4 cm dicken, runden Holzstab (ein Stück Besenstiel) her und
umwinden ihn mit einer dünnen Schnur[S. 61] oder einem starken Leinenfaden,
wie dies aus Abb. 40 bei dem unten freien Ende des Holzstabes zu sehen
ist. Um diesen herum wickeln wir nun mehrere Lagen eines starken
Papieres, bis der Stab so dick geworden ist, als der Hohlraum des
Zylinders weit sein soll. Das Abrollen der Papierumhüllung verhindern
wir durch Umwinden mit einem dünnen gewöhnlichen Nähfaden. Abb. 40
zeigt diesen ersten Bestandteil der Gußform. Nun brauchen wir zwei
Gummiringe, die so stark sein müssen, als die Wandungen des Zylinders
dick werden sollen. Diese Ringe können wir aus einem Gummischlauche
herstellen, indem wir Stücke von passender Länge über eine Kordel
ziehen und die Enden mit Gummilösung zusammenkleben. An einem Ringe
werden, wie Abb. 41 zeigt, an zwei Stellen Bindfäden befestigt. Bevor
die Ringe auf den Stab geschoben werden, wird dessen Papierbelag mit
Fett (Schweineschmalz) eingerieben. Die obere Fläche soll möglichst
eben sein, etwa vorhandene Spalten zwischen den einzelnen Papierlagen
müssen mit Fett angestrichen werden. Nun wird der eine Ring mit den
Fäden auf das obere Ende des Stabes geschoben; der andere von unten her
so weit von diesem entfernt, als die Tiefe des Zylinders betragen soll.
Aus der Abb. 42 ist diese Anordnung deutlich zu erkennen.
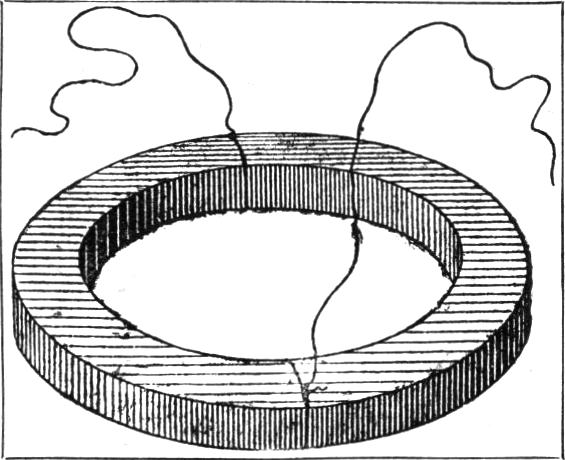
Abb. 41. Gummiring.
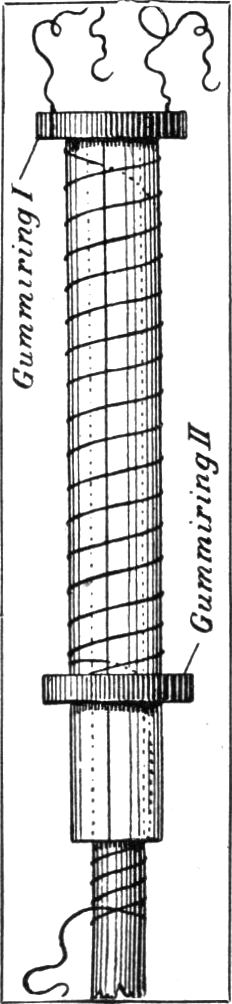
Abb. 42. Holzstab nach Befestigen der Gummiringe.
Des weiteren richten wir uns aus starkem Papier einen ziemlich
langen Streifen, der etwa 5 cm breiter ist, als der Abstand
der[S. 62] beiden Gummiringe beträgt. Dieser Papierstreifen soll, wie aus
dem Längsschnitt der Abb. 43 zu ersehen ist, über den Stab, durch
die Gummiringe von ihm getrennt, aufgerollt werden und zwar so, daß
der entsprechende Rand der Papierhülle 1 cm (oder mehr, je
nachdem die Stärke des Bodens gewünscht wird) über das obere Ende
des Stabes hinausragt. Die Innenseite der Papierhülle muß ebenfalls
stark eingefettet sein, und man bestreicht deshalb am besten vor dem
Aufwickeln ein entsprechend breites Stück mit Fett. Das selbsttätige
Aufrollen der Hülle verhindert man wiederum durch Umwinden mit
Bindfaden.
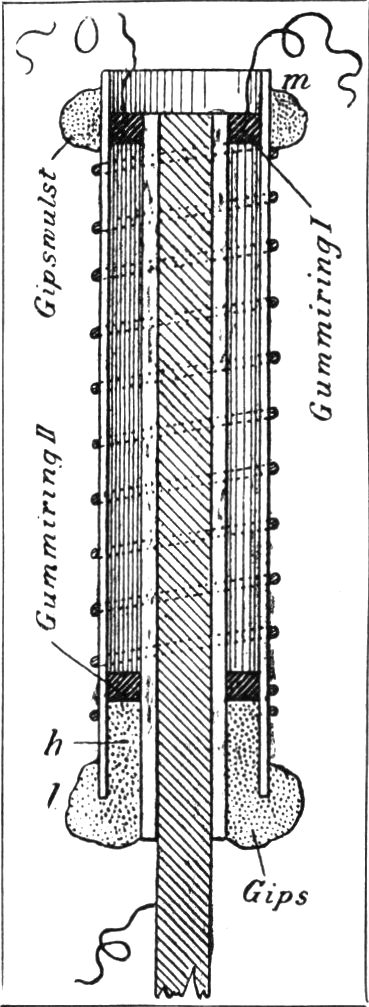
Abb. 43. Aufrollen des Papierstreifens.
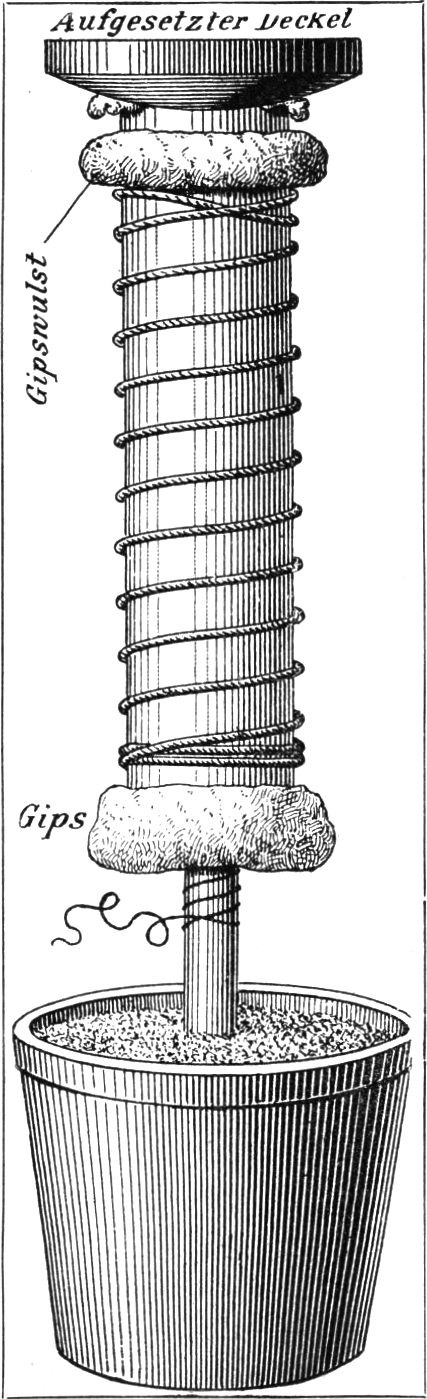
Abb. 44. Die fertige Form zur Herstellung von
Gipszylindern.
Der Hohlraum, der in Abb. 43 mit h bezeichnet ist, wird nun
mit ziemlich dickflüssigem Gipsbrei unter Benützung eines Messers
ausgestrichen, und außerdem wird[S. 63] die Stelle auch außen noch mit einem
Wulst von Gips (l) umgeben. Ebenso wird an dem oberen Ende ein
Gipskranz m angebracht.
Sind die Gipswülste, die zur Erhöhung der Festigkeit der Form dienen,
genügend getrocknet, so wird der obere Gummiring mit Hilfe der beiden
Fäden herausgezogen, und nun ist die Form fertig. Abb. 44 zeigt, wie
man sie in einem mit Erde gefüllten Blumentopfe bequem senkrecht
aufstellen kann.
Im Gusse darf nur ganz reiner, guter Gips verwendet werden. Wir gehen
am sichersten, wenn wir uns an einem bereits erhärteten Stückchen Gips
davon überzeugen, ob es, in verdünnte Schwefelsäure geworfen, seine
Festigkeit nicht verliert. Der Gipsbrei darf nicht zu wässerig sein, er
soll gerade noch gut fließen, wenn er in die Form gegossen wird. Etwa
mitgerissene Luftblasen werden durch vorsichtiges Erschüttern der Form
zum Steigen gebracht und an der Oberfläche dann abgestrichen. Um dem
Boden eine Wölbung nach innen zu geben, wird irgend ein nicht zu stark
gewölbter Gegenstand (z. B. ein Schaumlöffel oder irgend ein passender
Deckel) eingefettet und auf die Form gedrückt, so daß noch etwas Gips
auf den Seiten herausquillt.
Ist der Guß — man kann dies an dem oben herausgequollenen Gips
erkennen — hinreichend erhärtet, so wird die Form aus dem Blumentopf
herausgenommen und umgedreht und der um den Holzstab gewundene
Faden wird an dem freien Ende herausgezogen. Dadurch wird der Stab
frei und kann auch herausgenommen werden. Nun rollt man den inneren
Papierstreifen nach innen zusammen und nimmt ihn ebenfalls heraus. Die
äußere Hülle springt nach Entfernung der Gipswülste und der Schnur von
selbst los. Runden wir noch die meist zu scharfen Kanten mit einem
Messer ab, so ist der Zylinder fertig.
Indem wir den Holzstab mit verschieden starken und langen Papierbelägen
umwickeln, können wir den Zylindern die verschiedensten Formen geben.
Die einzelnen Bestandteile der Form lassen sich wieder zusammensetzen
und von neuem gebrauchen.
[S. 64]
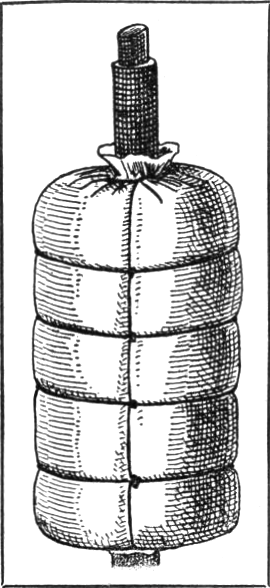
Abb. 45. Kohlenelektrode.
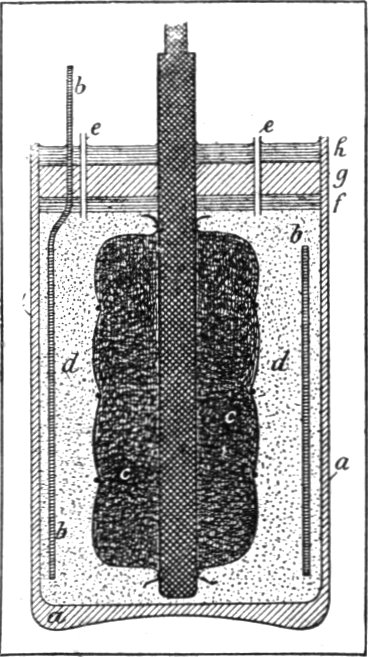
Abb. 46. Trockenelement (Durchschnitt).
Kohlenelektroden.
Für Leclanché-Elemente sind die sog. Kohlebeutelelektroden der
Verwendung von Tonzellen vorzuziehen, schon deshalb, weil sie viel
einfacher herzustellen sind. Die Ansicht einer solchen Elektrode zeigt
Abb. 45, der Durchschnitt ist in Abb. 46 dargestellt. Wir besorgen
uns eine gewöhnliche Bogenlampenkohle, deren Dicke sich nach der
Größe des Elementes richten muß. Für ein Element mittlerer Größe soll
sie etwa 1,5 bis 2,0 cm dick und 15 bis 20 cm lang
sein. Der Kohlestab muß zu ¾ bis 4⁄5 seiner Länge in einem mit einem
Braunsteinkohlegemisch gefüllten Tuchbeutel stecken. Wir feilen nahe
dem unteren Ende der Kohle eine nur wenig tiefe Ringnut ein und ebenso
an der Stelle, bis zu welcher der Beutel reichen soll. Ein beiderseits
offenes Säckchen aus starkem Leinenstoff wird einerseits in die untere
Nut eingebunden und mit einem gleichteiligen Gemisch aus ziemlich fein
gekörntem Braunstein und Koks (oder Retortenkohle) gefüllt. Damit
der Beutel eine regelmäßige Form erhält, umgeben wir ihn mit einem
Zylinder aus Pappdeckel, den wir mit einer Schnur umwinden, damit er
einigen Druck aushält. Jetzt wird die Füllung unter Zugabe von Wasser
mit einem Holzstab so fest als möglich in das Säckchen hineingepreßt
und festgestampft; dann wird der obere Rand des Säckchens in die obere
Ringnut der Kohle eingebunden. Nach Entfernung des Pappzylinders wird
der Beutel noch mit Schnur befestigt, wie dies aus der Abb. 45 zu
ersehen ist. Der aus dem Beutel herausragende Teil der Kohle wird in
kochendes Paraffin getaucht und dann wird am oberen Ende die[S. 65] Rundung
mit der Feile etwas abgeflacht, damit eine Klemmschraube bequem
angesetzt werden kann.
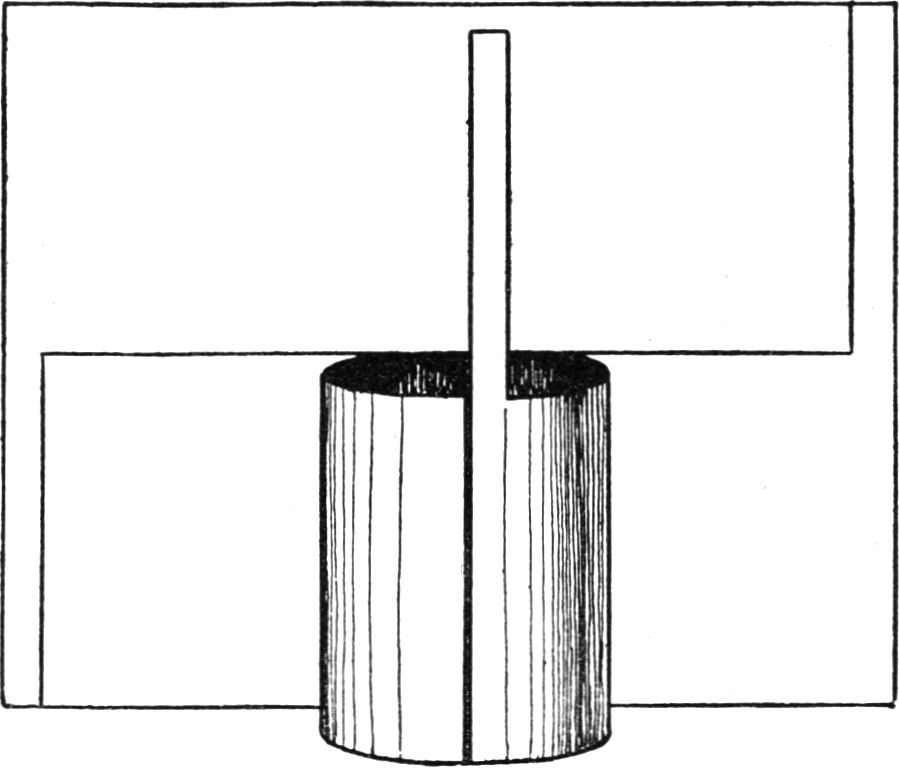
Abb. 47. Zinkzylinder.
Das Trockenelement.
Auch die in neuerer Zeit so sehr beliebt gewordenen Trockenelemente
kann man sich leicht selbst herstellen; sie sind ebenfalls nach
dem System von Leclanché konstruiert. An Hand der Abb. 46 sei ihre
Anfertigung erklärt: Als Behälter (a in Abb. 46) für das
Trockenelement wählen wir ein Glasgefäß von passender Größe; den
Zinkmantel (siehe unten) selbst als Gefäß zu benutzen, ist nicht
empfehlenswert. Ferner fertigen wir uns aus starkem Zinkblech einen
zylindrischen Mantel mit einem Fortsatzstreifen an. Wie aus einem Stück
Blech zwei solcher Mäntel ohne Materialverlust geschnitten werden,
zeigt Abb. 47. Der Zinkmantel (b in Abb. 46) soll mit 2 bis 3
mm Spielraum in das Glasgefäß hineinpassen. Endlich stellen wir
uns eine Kohlebeutelelektrode (c) her, deren Durchmesser je
nach der Größe des Elementes 2 bis 5 cm kleiner ist, als der
des Zinkzylinders. Die Füllung (d) besteht aus feinem, reinem
Sägemehl von weichem Holz, das 1 bis 2 Stunden in einer[S. 66] gesättigten
Salmiaklösung gelegen hat. Kurz vor Gebrauch wird das Sägemehl in einen
Leinenbeutel gefüllt und durch leichtes Pressen von der überschüssigen
Flüssigkeit befreit. Dann gibt man in das Glasgefäß erst eine etwa
5 mm dicke Schicht davon auf den Boden; hierauf werden der
Zinkzylinder und die Kohlenelektrode, die vorher in Salmiaklösung
stand, eingesetzt und der freie Raum zwischen diesen sowie zwischen
Zink und Glas mit der genannten Füllmasse ausgefüllt. Mit einem
geeigneten Holzstab muß die Masse recht fest zusammengestampft werden.
Die dabei an die Oberfläche tretende Flüssigkeit gießt man erst ab,
wenn die Füllung beendet ist; letztere soll die obere Fläche des
Kohlebeutels noch etwa 5 mm hoch bedecken. Ist die überschüssige
Flüssigkeit abgegossen, so ebnet man die Oberfläche der Füllung, steckt
zwei kleine Gummischläuchlein (Ventilschlauch) (e, e)
etwa 5 mm tief hinein und gießt nicht zu heißes Paraffin auf die
Füllung direkt auf, eine 2 bis 3 mm dicke Schicht (f).
Jetzt wird der noch freie Glasrand innen mit einem Wattebausch sehr
sorgfältig getrocknet. Die nächste Deckschicht (g) besteht
aus Kolophonium-Wachskitt, dem außer ziemlich viel Leinöl auch etwas
Spiritus (etwa 5 Volumenprozent) zugesetzt ist; der Kitt muß auch nach
dem Erkalten noch eine zähe, fadenziehende Masse bilden. Hiervon wird
eine 5 bis 10 mm dicke Lage eingegossen, wobei der Kitt sehr
heiß sein soll. Für die oberste Schicht (h) verwenden wir wieder
Paraffin oder Asphalt.
Die käuflichen Trockenelemente sind meist nach Verfahren hergestellt,
die Fabrikgeheimnisse sind. Die Leistung sehr vieler dieser Fabrikate
ist sehr gut, insbesondere kommen für die kleinen Taschenlämpchen sehr
gute, kleine Batterien (meist 3 Elemente) in den Handel. Da Rudi gerade
diese kleinen Taschenlämpchen viel gebrauchte, sei hier einiges über
sie gesagt.
Die Trockenbatterien zu 3 Elementen, meist zusammen in einer
Papierhülle, leisten 4 Volt und bringen ein kleines Lämpchen zum hellen
Leuchten; besonders erfreut war Rudi, als auch diese 4-Volt-Lämpchen
mit Metallfaden, statt Kohlenfaden ausgerüstet wurden, wodurch bei
gleichem Stromverbrauch mehr als die dreifache Helligkeit erzielt
wurde. Ein Brechen des feinen Metallfadens ist nicht zu befürchten, da[S. 67]
er zu kurz ist; sie sind also weit weniger empfindlich als die großen
Metallfadenlampen, die gegen Erschütterungen sehr empfindlich sind.
Wer einen möglichst konstanten, starken Strom gebraucht, muß sich
schon eine Batterie von Bunsen- oder Daniellelementen herstellen;
auch Chromsäurebatterien sind recht geeignet. Wer gute Gelegenheit
zum Akkumulatorenladen hat, beschafft sich natürlich eine
Akkumulatorenbatterie. Wo solche Gelegenheit fehlt und größere Kosten
nicht gescheut werden, sind die Kupronelemente entschieden am
meisten zu empfehlen.
Das Bunsenelement.
Das Bunsenelement besteht aus einem Glasgefäß, in dem ein dicker
Zinkzylinder steht; in dem Gefäß befindet sich verdünnte Schwefelsäure
(auf 10 Teile Wasser 1 Teil Schwefelsäure) und ein poröser Tonzylinder,
in dem in konzentrierter, gewöhnlicher Salpetersäure ein starker
Kohlenstab steht. Dies Element gibt 1,9 Volt.
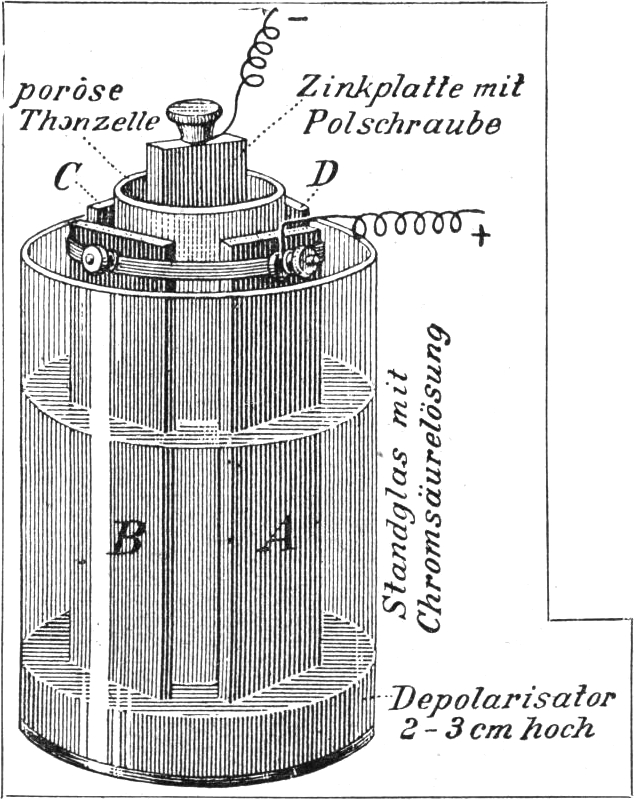
Abb. 48. Das verbesserte Bunsenelement.
Das Daniellsche Element.
Das Daniellsche Element besteht ebenfalls aus einem Glasgefäß mit
einem porösen Tonzylinder. In ersterem steht ein Kupferzylinder in
gesättigter Kupfervitriollösung, in letzterem ein starker Zinkstab oder
Zinkmantel in verdünnter Schwefelsäure oder auch Zinksulfatlösung. Die
erzeugte elektromotorische Kraft beträgt hier etwa 1,1 Volt.
Verbessertes Bunsenelement.
Die beiden obigen Elemente haben in der beschriebenen Form für uns
eigentlich mehr theoretisches als praktisches[S. 68] Interesse. Rudi hatte
sich eine stattliche Batterie aus abgeänderten Bunsenelementen
hergestellt, die ihm einen starken und konstanten Strom, mit dem er
auch Akkumulatoren laden konnte, lieferte. Abb. 48 zeigt ein solches
Element. Die Kohlenelektrode stellen wir aus vier flachen Kohlenplatten
her, die, ungefähr ein Viereck bildend, um die Tonzelle aufgestellt
sein sollen. Es handelt sich nun darum, die vier Kohlenplatten gut und
fest miteinander zu verbinden. Können wir Platten verwenden, deren
obere Enden, wie in Abb. 49, mit Klemmschrauben versehen sind, so
stellen wir uns aus dickem, geglühtem Kupferdraht einen Ring her, wie
ihn Abb. 51 zeigt. Durch die vier an den breitgeschlagenen Stellen
eingebohrten Löcher werden die Schraubenenden der Kohlen gesteckt und
mittels Muttern festgeschraubt.
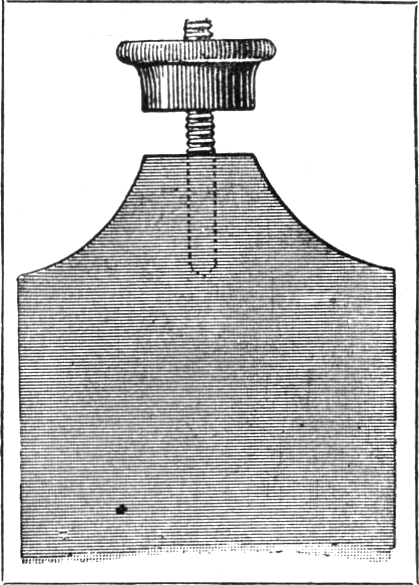
Abb. 49. Kohlenplatte mit eingebrannter Polschraube.
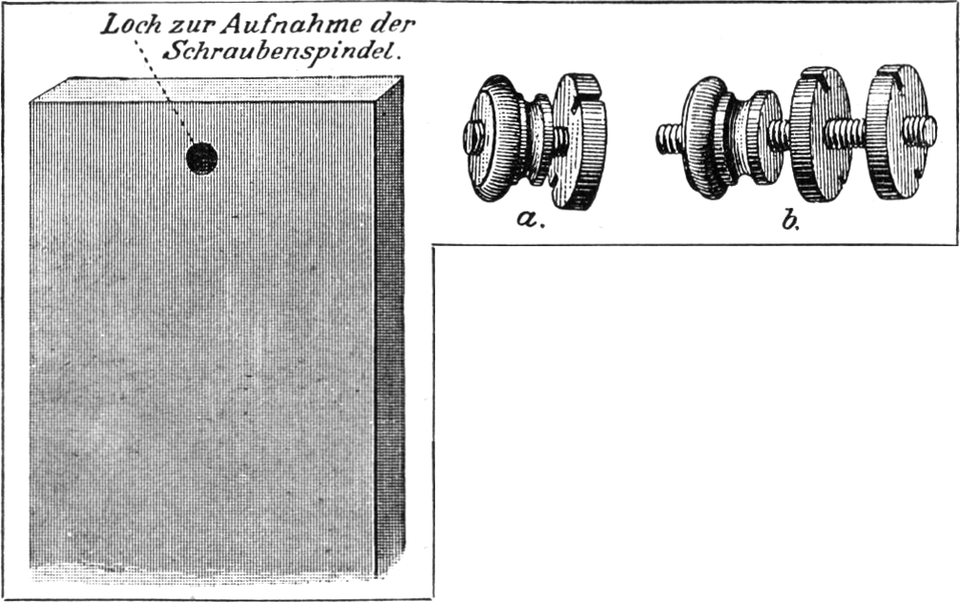
Abb. 50. Kohlenplatte mit Klemmschrauben.
a Klemme zur
Befestigung des Metallstreifens (für jedes Element drei erforderlich).
b Klemme für denselben Zweck, jedoch gleichzeitig
zum Anschrauben des Poldrahtes (für jedes Element eine erforderlich).
Stehen uns nur einfache Kohlenplatten zur Verfügung, so versehen wir
sie an ihrem oberen Ende mit einem Loch, durch das wir Metallschrauben
mit Muttern hindurchstecken[S. 69] können (Abb. 50). Durch einen entsprechend
gebogenen und mit vier Löchern versehenen Kupferblechstreifen werden
die Kohlen miteinander verbunden, wie dies in Abb. 48 deutlich zu
erkennen ist. Die oberen Enden der Kohlen müssen in kochendes Paraffin
getaucht, die Metallteile mit Asphaltlack bestrichen werden. Auf
den Boden der Tonzelle gießt man etwas Quecksilber (dies ist zwar
nicht unbedingt nötig und verhindert nur rascheres Auflösen des
Zinks) und stellt einen gut amalgamierten starken Zinkstab hinein. Nun
wäre das Element noch zu füllen: Wir stellen den Tonzylinder in das
Standglas und geben zuerst eine als Depolarisator wirkende Masse auf
den Boden des Gefäßes, einige Zentimeter hoch. Die Masse besteht aus
6 Teilen pulverisiertem, doppeltchromsauren Kali, die mit 60 Teilen
Kalialaun in einem Glas- oder Porzellangefäß unter Zugießen von 10
Teilen konzentrierter Schwefelsäure mit einem Glasstab zusammengerührt
werden. Die dabei entstehende Masse ist teigartig und kann längere Zeit
offen aufbewahrt werden.
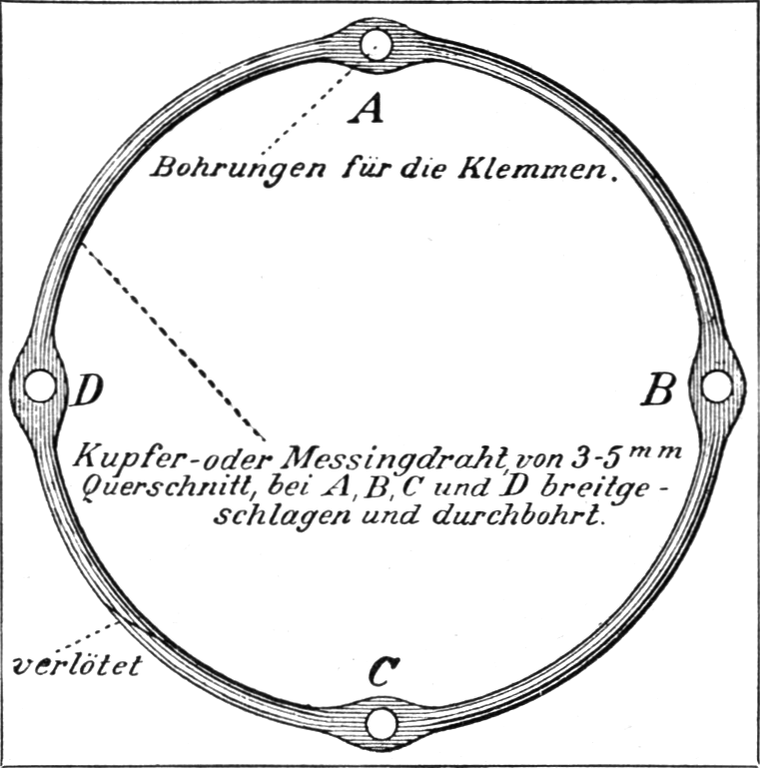
Abb. 51. Breitgeschlagener Kupfer- oder Messingdraht.
Nun wird zuerst der Tonzylinder mit verdünnter Schwefelsäure (1 : 10)
und dann das Glasgefäß mit verdünnter Chromsäure (1 : 9) angefüllt.
Hier sind Volumteile gemeint. Diese Elemente eignen sich besonders zum
Laden von Akkumulatoren.
[S. 70]
Das Chromsäureelement.
Wir wollen nun noch die Chromsäureelemente, die nur in Form von
sogenannten Tauchbatterien verwendet werden, kurz besprechen. Unser
Rudi war zwar ein persönlicher Feind dieser Elemente, denn er hatte
schlechte Erfahrungen damit gemacht. In der Tat erfordert eine
Chromsäurebatterie zu ihrer guten Instandhaltung mehr Arbeit und
Sorgfalt, als sie eigentlich wert ist. Jedoch ist ihre Herstellung
ziemlich einfach und billig.
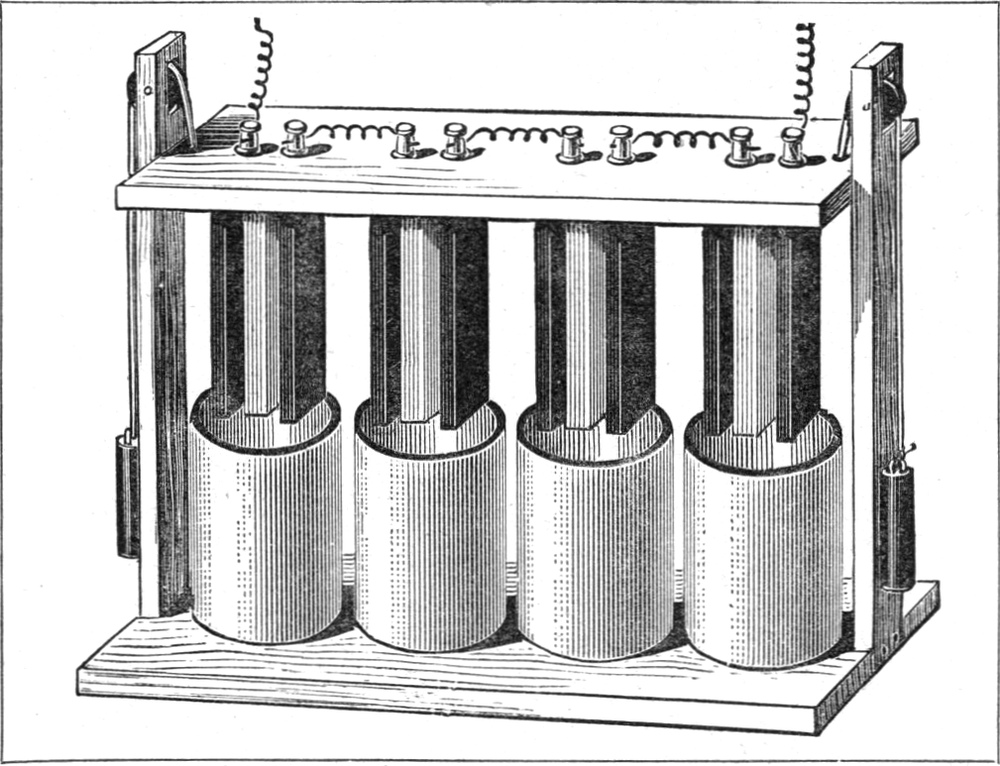
Abb. 52. Holzgestell für Chromsäurebatterie.
Die positive Elektrode des Elements besteht aus zwei Kohlenplatten,
zwischen denen eine starke Zinkplatte steht und die negative
Elektrode bildet. Die Chromsäurelösung wird aus 1 Gewichtsteil
doppeltchromsaurem Kali, 12 Gewichtsteilen Wasser und 2 Gewichtsteilen
Schwefelsäure hergestellt. Die Schwefelsäure gieße man, wie schon
erwähnt, unter ständigem Umrühren langsam zu. Die Elektroden müssen
so aufgehängt werden, daß sie mit einem einfachen Handgriff in die
Gläser eingetaucht und herausgezogen werden können. Wir können uns
hierfür verschieden[S. 71] konstruierte Holzgestelle herrichten. Abb. 52
zeigt ein solches, bei dem Kohle und Zink aus der Flüssigkeit gehoben
werden. Diese Art von Batterien ist den vielfach noch gebräuchlichen
Chromsäureflaschenelementen, wie Abb. 53 ein solches zeigt, entschieden
vorzuziehen; diese seien nur der Vollständigkeit wegen erwähnt.
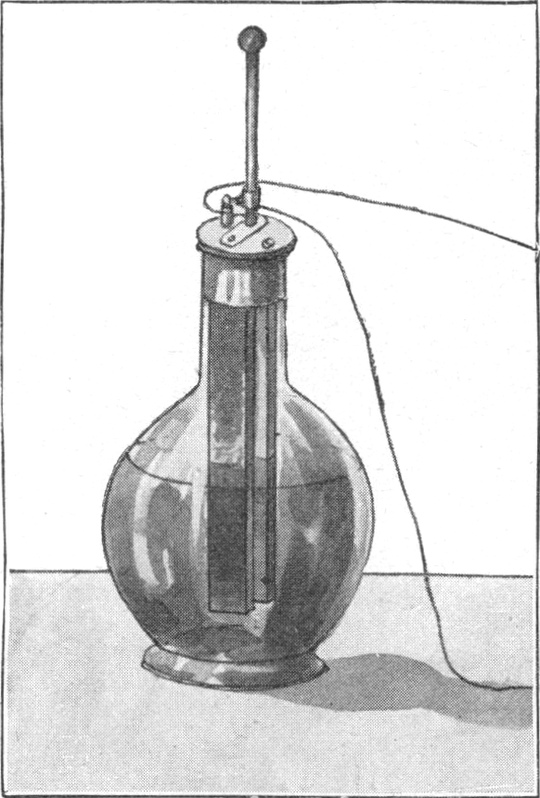
Abb. 53. Chromsäureflaschenelement.
Jede Batterie, die nicht in kürzester Zeit schlecht werden soll,
bedarf sorgfältiger und reinlicher Wartung. Man stelle sie deshalb
nicht an unzugänglichen Orten auf. Größere Batterien von solchen
Elementen, die Wasserstoff entwickeln (fast alle, bei denen Zink in
Schwefelsäure steht), sollen nicht in einem bewohnten Zimmer sein.
Bei den Salmiakelementen wird regelmäßig das verdunstete Wasser der
Lösung durch frisches ersetzt; die Gläser sollten stets mit Deckeln
versehen sein. Sobald sich innerhalb oder außerhalb an den Elementen
Salze gebildet haben, sind Gefäß und Elektrode gründlich davon zu
befreien, zu reinigen, einige Stunden, die Elektroden aber getrennt, in
verdünnte Salzsäure zu stellen, dann mit Wasser gründlich abzuspülen
und schließlich neu zu füllen. Die aus der Flüssigkeit herausragenden
Teile der Kohle müssen immer mit einem guten Paraffinüberzug versehen
sein; freie Teile der Zinkelektroden werden am vorteilhaftesten mit
Asphaltlack bestrichen. Verbindende Drähte sind entweder zu verlöten
oder mittels guter Klemmschrauben fest anzuschließen; mangelhafte
Verbindungsstellen bilden große Widerstände.
[S. 72]
Der Akkumulator.
Als das beste und brauchbarste Element, das wir kennen, ist jedenfalls
der Bleiakkumulator zu bezeichnen. Eine günstige Gelegenheit, den
Akkumulator selbst zu laden oder laden zu lassen, darf wohl bei den
meisten jungen Lesern vorausgesetzt werden; für geringere Ansprüche
genügt auch eine der oben beschriebenen Batterien zum Laden der
Akkumulatoren.
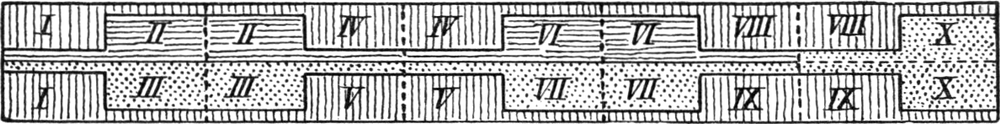
Abb. 54. Einteilung des Werkbleistreifens in Platten.
Die Selbstanfertigung eines guten Akkumulators ist nicht so schwierig,
als wohl manchem scheinen möchte. Ein wenig Geduld müssen wir haben;
denn ein großer Teil der Arbeit, das Ausstanzen der Löcher, ist nicht
gerade sehr unterhaltend.
Zuerst müssen wir uns klar darüber werden, wie viel Zellen mit wie
viel und wie großen Platten wir herstellen wollen. Wir nehmen einmal
an, es sollten zwei Zellen, jede zu fünf Platten angefertigt werden
und jede Platte 10 cm lang und 5 cm breit sein, also
50 qcm Fläche haben. In diesem Falle genügt ein 1,5 mm
dickes Bleiblech, da wir jede Platte aus zwei Lagen bestehen lassen
werden; bei mehr als 50 qcm muß das Blei 2 mm stark sein.
Wir haben also zwei Zellen, jede zu fünf Platten, die je aus zwei Lagen
zusammengesetzt sind, deren jede 50 qcm Fläche hat. Wir brauchen
also 2 · 5 · 2 · 50 qcm = 1000 qcm; dabei haben wir aber
die Fortsätze noch nicht in Rechnung gezogen, die an den Platten sein
müssen. Diese machen nochmals 200 qcm aus, so daß im ganzen 1200
qcm erforderlich sind. Um das Material möglichst auszunützen,
kaufen wir uns einen 1 m langen, 12 cm breiten und 1,5
mm starken Streifen von gewöhnlichem Werkblei. Dieser wird nach
dem in Abb. 54 angegebenen Muster in Doppelplatten eingeteilt, die
alle mit langen Fortsätzen versehen sind. Die beiden Hälften einer
Doppelplatte hängen bei Nr. II bis IX so zusammen, wie es Abb. 55
zeigt. Nur bei X haben wir[S. 73] die langen Seiten gemeinsam und
bei Nr. I gar keine. Nachdem wir die Einteilung auf den Bleistreifen
aufgezeichnet haben, schneiden wir die Doppelplatten heraus (Abb. 55).
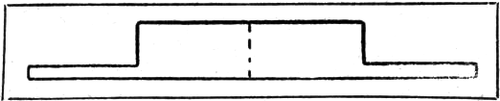
Abb. 55. Eine Doppelplatte.
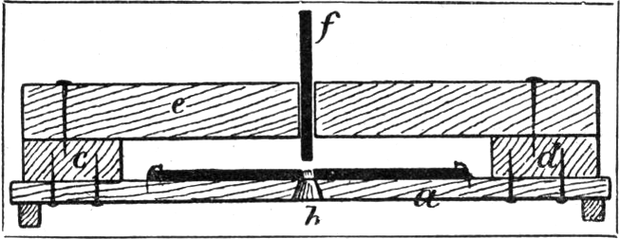
Abb. 56. Maschine zum Ausstanzen der Löcher.
Um die wirksame Fläche der Platten zu vergrößern, müssen wir sie
mit einer großen Anzahl von Löchern versehen; wir wollen auf jeden
Quadratzentimeter Fläche ein 4 mm weites Loch annehmen. Wir
ritzen gitterartig Linien auf den Doppelplatten (Abb. 55) ein, deren
erste 5 mm vom Rande entfernt ist, während jede folgende 1
cm von der vorhergehenden absteht, somit fünf Linien parallel zu
den langen, 20 parallel zu den kurzen Seiten. In den 100 Schnittpunkten
beider Liniensysteme sind die Löcher auszustanzen, wozu wir uns eine
einfache Maschine anfertigen, die Abb. 56 im Schnitt zeigt. Auf ein 2
cm starkes quadratisches Brett wird eine Eisenplatte genagelt
oder besser in das Brett eingelassen; sie enthält in ihrer Mitte ein
Loch, das 4 mm weit sein und möglichst scharfe Kanten haben
soll. Außerdem verschaffen wir uns eine genau in das Loch passende,
also auch 4 mm starke Eisenstange (f), die 7 bis 8
cm lang und auf einem Ende möglichst eben und scharfkantig
abgefeilt sein muß. An zwei gegenüberliegenden Stellen am Rande des
Brettes a werden zwei 2 bis 3 cm dicke Holzklötzchen
(c und d) und über diese eine 3 cm starke und etwa
5 cm breite Leiste (e) aufgenagelt. In letztere wird
genau über dem Loch in der Eisenplatte eine Durchbohrung angebracht,
die so weit ist, daß die Eisenstange f leicht, doch ohne zu viel
Spielraum zu haben, hindurchgeschoben werden kann. Ebenso erhält das
Brett a eine sich nach unten erweiternde Fortsetzung (b)
des Loches in der Eisenplatte. Die Stange f muß, durch die
Bohrung in e gesteckt, genau auf das Loch in der Platte stoßen.[S. 74]
Wir legen nun die Bleiplatte so auf diesen Apparat, daß eine der
durch die Schnittpunkte der eingeritzten Linien bezeichneten Stellen
genau unter den etwas in die Höhe gehobenen Stab f zu liegen
kommt, auf den nun mit dem Hammer ein kräftiger Schlag ausgeübt wird;
ein kleines Bleischeibchen fällt dann zu dem Loche b heraus.
Wir verschieben nun die Bleiplatte bis zum nächsten Schnittpunkt und
wiederholen die gleiche Manipulation, und so fort, bis alle 1000
Löcher durchgestanzt sind. Wer etwas Mühe sparen will, kann vier
Doppelplatten, die dann beim Montieren die beiden äußersten Platten in
jeder Zelle bilden, ungelocht lassen.
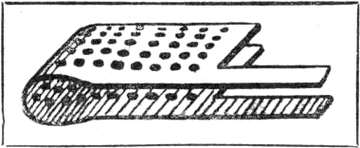
Abb. 57. Eine zusammengebogene Doppelplatte.
Nun wird jede Doppelplatte II bis IX so zusammengebogen, daß die
beim Ausstanzen oberen Seiten nach innen kommen, jedoch ohne
einander zu berühren (Abb. 57); die Platte X läßt sich entsprechend
längs der mittleren Langseite biegen. Die beiden Platten I muß man
unter Zwischenlegen von Glasröhren einstweilen zusammenbinden.
In ein genügend weites und tiefes Glasgefäß stellen wir fünf der
zusammengebogenen Doppelplatten, durch Glasröhren voneinander
getrennt, so ein, daß die erste, dritte und fünfte ihre Fortsätze
nach links haben, die zweite und vierte nach rechts; ebenso in einem
zweiten Glas die übrigen fünf Platten. Beide betten wir in eine mit
Sägemehl angefüllte Kiste und verbinden nun die sechs Fortsätze der
einen Seite untereinander mit einem Kupferdraht, ebenso die vier
Fortsätze der anderen Seite. Die beiden Drahtenden führen wir zu zwei
Klemmschrauben, die wir an der Kiste angebracht haben, und bezeichnen
das Drahtende, das von den sechs Fortsätzen kommt, mit - (minus),
das andere mit + (plus). Nun werden die beiden Gefäße mit verdünnter
Schwefelsäure — 1 Teil Schwefelsäure auf 9 Teile Wasser — soweit
angefüllt, daß die Platten, von den Fortsätzen abgesehen, vollständig
in der Flüssigkeit stehen. Um die Platten zur weiteren Behandlung
geeigneter zu machen, werden sie geladen und zwar zuerst in umgekehrter
Richtung,[S. 75] das heißt der positive Pol des Ladestromes wird
mit dem negativen des Akkumulators, und der negative
mit dem positiven verbunden. So läßt man 2 Stunden lang einen
1½ Ampere starken Strom bei mindestens 5 Volt hindurchgehen. Dann
dreht man den Strom um und verbindet die positiven Pole miteinander
und ebenso die negativen und ladet nun 5 Stunden. Wir können nun den
gleichen Vorgang wiederholen, das heißt wieder 2 Stunden verkehrt und
5 richtig laden, doch ist dies nicht unbedingt nötig. Nach dem Laden
sehen die vier positiven Platten schwarzbraun, die sechs negativen
grau aus. Sie werden nun alle aus den Gefäßen herausgenommen und an
einem Platze, wo die verdünnte Schwefelsäure nichts schaden kann, zum
Abtropfen aufgestellt. Unterdessen rühren wir in einem irdenen oder
porzellanenen Schälchen etwa 150 g Mennige und in einem anderen
ebensoviel Bleiglätte mit verdünnter Schwefelsäure (1 : 10) zu einem
dicken, jedoch noch gut plastischen, nicht zu trockenen Brei an. Dann
nehmen wir eine der positiven (braunen) Doppelplatten heraus, biegen
sie auseinander, legen sie auf eine ebene Unterlage, streichen die
Löcher gut mit dem Mennigebrei aus und bedecken die Platte außerdem
noch 1 mm hoch damit. Ist dies geschehen, so wird die Bleiplatte
wieder zusammengebogen, diesmal aber, ohne einen Zwischenraum darin
zu lassen; dann legt man sie zwischen zwei Bretter und beschwert
diese mit ein paar Kilogramm. Genau so wird mit den übrigen braunen
Platten verfahren und auch mit den grauen, nur daß letztere mit der
gelben Bleiglätte behandelt werden. Wer eine zarte Haut, oder gar
wunde Stellen an den Fingern hat, unterlasse es ja, das Auftragen
des mit verdünnter Schwefelsäure angerührten Breies mit den Fingern
zu besorgen, obwohl diese die besten Instrumente für solche Arbeit
sind. Man schnitze sich ein flaches Stäbchen und besorge es damit.
Wer dennoch die Hände dazu gebrauchen will, stelle eine Schüssel mit
Wasser, in das er soviel Ammoniak (Salmiakgeist) gegeben hat, daß
es stark danach riecht, neben sich und halte die Hände alle 2 bis 3
Minuten einige Sekunden hinein, oder ziehe Gummihandschuhe an. Sind
Kleidungsstücke mit Schwefelsäure bespritzt worden, so betupfe[S. 76] man
sie an der betreffenden Stelle reichlich mit Salmiakgeist. Nun wird
jede Platte für sich in saubere (alte) Leinwand — man kann sich zu
diesem Zweck auch billigen Schirting kaufen, der aber vor dem Gebrauch
gewaschen werden muß — eingehüllt und so einen Augenblick in verdünnte
Schwefelsäure getaucht; dann werden je fünf Platten aufeinander und
die beiden Stöße nebeneinander gelegt und mit etwa 50 kg beschwert. So
bleiben sie über eine Nacht; dann werden sie wieder ausgepackt und 24
Stunden in verdünnte Schwefelsäure gestellt. Endlich werden sie wieder
herausgenommen und an einem geschützten, aber nicht etwa geheizten Orte
zum Trocknen aufgestellt.
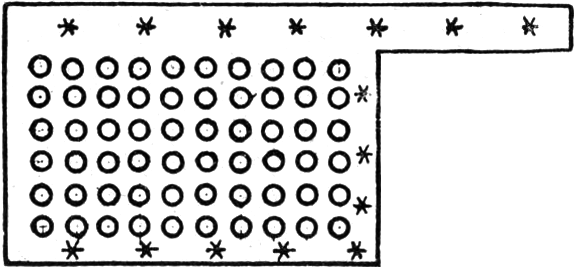
Abb. 58. Das Vernieten der Platten.
(Es sind hier sechs Lochreihen statt
fünf angenommen.)
Um die beiden Hälften der einzelnen Platten fest zusammen zu halten,
werden sie miteinander vernietet. Man bohrt an den in der Abb. 58
mit Sternchen bezeichneten Stellen Löcher und steckt kurze Stückchen
Bleidraht von entsprechender Dicke hindurch, so daß sie auf jeder Seite
1 mm herausragen mögen. Da das Blei sehr weich ist, so fällt es
nicht schwer, die Drahtstückchen durch einfaches Klopfen mit dem Hammer
so zu vernieten, daß sie nicht mehr über die Platte herausragen.
Damit sind die Hauptbestandteile des Akkumulators, die Platten,
fertig, und wir können zu ihrem Einbau in die Glasgefäße schreiten.
Da die Bleiplatten nicht unmittelbar auf dem Boden aufstehen dürfen,
weil sonst etwa abbröckelnde Stückchen von Bleioxyd einen Kurzschluß
verursachen könnten, so stellen wir sie auf zwei 1 cm starke
Glasröhren, die wir auf dem Boden jedes Gefäßes mit ein paar Tropfen
Siegellack befestigen. Jetzt können die Platten eingesetzt werden,
wieder wie vorher, die Fortsätze der negativen auf der einen, die
der positiven auf der anderen Seite. Jede Platte ist dabei von der
folgenden durch je zwei 3 bis 4 mm dicke Glasröhren zu trennen.
Statt der Glasröhren kann man auch starkwandigen, entsprechend[S. 77]
dicken Gummischlauch verwenden. Der Rand des Glasgefäßes soll 2
bis 3 cm höher als der obere Rand der Platten sein, da die
Schwefelsäure mindestens einen halben Zentimeter hoch über den Platten
stehen soll und außerdem noch ein gut schließender Deckel angebracht
werden muß. Wir füllen das Glas bis 1,5 cm vom oberen Rande mit
Wasser und achten dabei besonders darauf, daß die Bleifortsätze und der
Teil der inneren Glaswand, der nicht unter Wasser ist, völlig trocken
bleiben, da sonst die abschließende Vergußmasse nicht genügend fest
haften bleibt. Nun wird in der einen Ecke des Behälters mit etwas Wachs
ein 3 bis 4 mm weites Glasröhrchen angebracht, das oben mit dem
Gefäßrand abschneidet und unten gerade noch unter den Wasserspiegel
taucht. In der Mitte stellen wir auf die Platten ein 1 cm
weites, 2 bis 3 cm langes Glasröhrchen. Dann wird in einem
kleinen Pfännchen oder in einem Blechlöffel Paraffin geschmolzen und
in möglichst heißem Zustand auf das Wasser gegossen, wo es sich dann
rasch verbreitet und erstarrt. Es soll überall an den Glaswänden und
den Bleistreifen gut anliegen; nötigenfalls gießt man noch etwas nach.
Die Paraffinschicht braucht nicht stärker als etwa 2 mm zu sein;
denn der eigentliche Verschluß wird genau so hergestellt, wie dies
oben beim Trockenelement schon beschrieben wurde. Ist der Guß völlig
erkaltet, so gießen wir das Wasser aus.
Es sind nun noch die Bleifortsätze zusammenzulöten. Wir biegen die vier
Bleistreifen der negativen Platten nach der Mitte zusammen, umwinden
sie mit einem Draht, so daß sie fest aneinander liegen, und schmelzen
die Oberfläche der vier Enden mit einem bis zur Rotglut erhitzten und
reichlich mit Salmiak gereinigten Lötkolben zusammen; Lötwasser darf
dabei nicht verwendet werden. Ebenso werden die Streifen der
positiven Platten miteinander vereinigt. Gleichzeitig können wir sowohl
an den negativen wie an den positiven Fortsätzen je einen 10 bis 20
cm langen starken Bleidraht anschmelzen.
Jetzt haben wir den Akkumulator nur noch zu füllen: wir gießen in
9 Volumteile destilliertes Wasser 1 Volumteil konzentrierte
reine Schwefelsäure (unter Beobachtung[S. 78] der bereits erwähnten
Vorsichtsmaßregeln). Nachdem sich die Flüssigkeit abgekühlt hat,
wird die Akkumulatorenzelle damit angefüllt und das in den Verschluß
eingegossene Glasrohr in der Mitte mit einem Gummistöpsel
verschlossen, während das kleine in der Ecke offen bleibt.
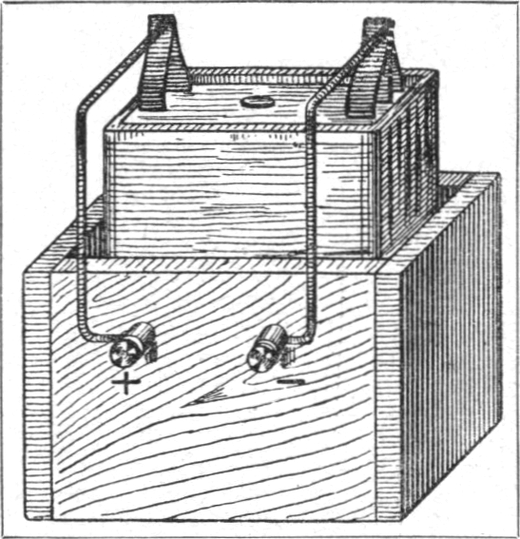
Abb. 59. Fertige Akkumulatorzelle.
Die nun fertige Zelle wird in einem geeigneten Holzkasten in Sägemehl
eingebettet. An dem Holzkasten bringen wir zwei Klemmschrauben an,
zu denen die Bleidrähte geführt werden. Mit roter Ölfarbe wird unter
jede Klemme das ihr zukommende Vorzeichen gesetzt. Abb. 59 zeigt den
fertigen Akkumulator. Über das Laden und den Gebrauch der Akkumulatoren
wird weiter unten (S. 80/81) noch ausführlich gesprochen werden; jetzt
wollen wir noch sehen, wie wir uns auf einfache Weise selbst gute
Gefäße für Akkumulatoren herstellen können.
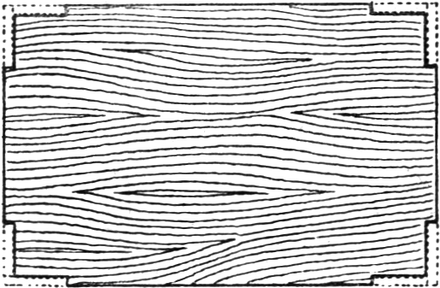
Abb. 60. Der Boden des Holzgestelles.
Herstellung von
Glasbehältern.
Wir verwenden gewöhnliche Glasplatten, etwa alte photographische
Platten, von denen die Schicht abzuwaschen ist, und schneiden uns für
jede Zelle fünf Scheibchen — vier Seiten und eine Bodenfläche — in
passender Größe. Dann fertigen wir uns aus Zigarrenkistenholz ein
Gestell, in welches die zugeschnittenen Gläser gerade hineinpassen, und
dessen Herstellungsweise aus den beiden Abb. 60 und 61 hervorgeht. Die
etwa 1 cm breiten Holzleistchen müssen, wenn sie geschnitten
sind, mit Glaspapier schön geglättet und dann[S. 79] einige Minuten in
Paraffin gekocht werden. Hierauf läßt man sie abkühlen, schabt das
oberflächlich anhaftende Paraffin mit einem Messer ab und setzt die
Leistchen, wie Abb. 61 zeigt, zu dem Gestell zusammen.
Nun bereiten wir
uns wieder den bekannten Kolophonium-Wachskitt, nehmen aber diesmal
etwas mehr Leinöl, etwa 3 bis 3,5 g auf 10 g Kolophonium.
Mit dieser kleberigen, fadenziehenden Masse bestreichen wir zuerst
die Ränder des Scheibchens, das den Boden bilden soll, und legen es
an seinen Platz im Gestell; ebenso verfahren wir dann mit den für die
Seitenwände bestimmten Glasplatten, die darauf zwar alle schon fest
zusammenhalten, aber noch nicht genügend dicht schließen.
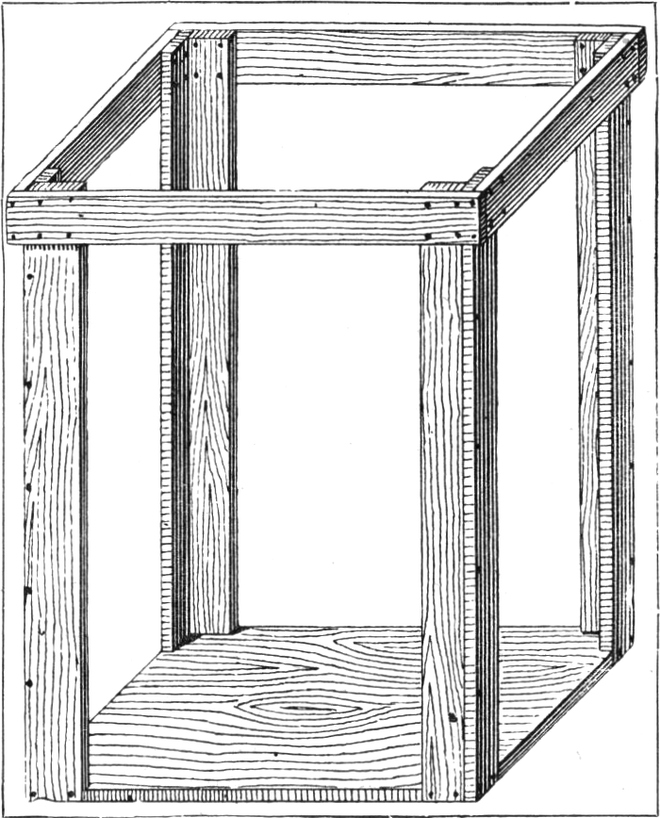
Abb. 61. Das Holzgestell.
Einen an Leinöl ärmeren Kitt (0,5 bis 1 g : 10 g),
dem wir etwas gewöhnlichen Asphalt (3 g) zusetzen, erhitzen
wir unter tüchtigem Umrühren bis zum Sieden[3] und gießen damit die
inneren Kanten des Gefäßes aus. War der Guß genügend heiß, so wird
er sich überall gut an das Glas angeschlossen haben, was man daran
erkennt, daß die[S. 80] Masse in den Kanten hohl liegt, wie dies in Abb. 62
a angedeutet ist. Ist sie dagegen nicht in dieser Weise auf die
Glasplatten übergeflossen, sondern zusammengeballt geblieben, wie in
Abb. 62 b, so muß man sie an Ort und Stelle mit einem dicken,
glühenden Nagel nochmals zum Schmelzen bringen, wobei sie sich dann
richtig an das Glas anschmiegt. Ein anderer für solche Zwecke ebenfalls
sehr geeigneter Kitt wird dadurch hergestellt, daß man erst 50 Teile
Kolophonium schmilzt, dann 50 Teile rohes Bienenwachs zugibt und in
der siedenden Masse 10 bis 20 Teile Guttapercha auflöst. Endlich
können wir die Kittfugen noch mit in Alkohol gelöstem roten Siegellack
überstreichen, der aber vollkommen trocken sein muß, bevor die Gläser
gefüllt werden.
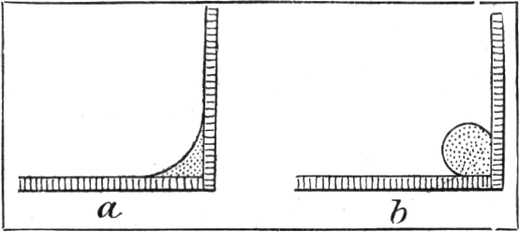
Abb. 62. Ausgießen der Kanten des Gefäßes.
Die Rahmen für solche Gefäße können wir uns auch aus Blechstreifen
zusammenlöten, doch ist gerade bei Akkumulatoren paraffiniertes Holz
vorzuziehen, da Metall von der Säure sehr stark angegriffen wird. Die
Glasplatten halten auch ganz ohne Rahmen sehr fest zusammen, doch sind
sie in solchen vor dem Zerbrechen mehr geschützt und können bequemer
getragen werden. Sollen sie dennoch ohne Gestell gefertigt werden, so
ist es zu empfehlen, die zusammenzukittenden Ränder der Glasscheiben
vorher mit Flußsäure rauh zu machen. (Über die Handhabung der Flußsäure
siehe Seite 12.) Auf alle Fälle müssen sie unbedingt rein sein, weshalb
sich ein vorheriges Abwaschen mit Natronlauge empfiehlt. Die so
gereinigten Stellen sollen mit den Fingern nicht mehr berührt werden.
Für die Bedienung und Instandhaltung der Akkumulatoren
beachte man folgendes: Jede geladene Akkumulatorenzelle hat eine
Spannung von 2,2 (max.) Volt. Beim Zusammenschalten mehrerer Zellen
gilt genau das gleiche, was auf den folgenden Seiten allgemein von
Elementen gesagt ist. Der Ladestrom für eine Akkumulatorenbatterie
muß[S. 81] immer eine etwas höhere Spannung haben, als die geladene
Batterie. Die Stromstärke richtet man mit Hilfe eines Regulier- oder
Lampenwiderstandes (siehe Anhang) so ein, daß beim Beginn der Ladung
gerade eben eine leichte Gasentwicklung zu bemerken ist; es sollen
nur vereinzelte kleine Gasbläschen von den Platten aufsteigen. Die
Ladung soll dann bei gleichbleibendem Strom so lange fortgesetzt
werden, bis die Gasentwicklung anfängt stürmisch zu werden. Man kann im
allgemeinen rechnen, daß der Ladestrom pro Quadratdezimeter Oberfläche
der positiven Platten während 8 bis 10 Stunden mit 0,5 Ampere wirken
soll. Stärker darf auch der Entladestrom nicht sein; nur ganz kurze
Augenblicke (5 bis höchstens 10 Sekunden) kann man etwa die vierfache
Stromstärke dem Akkumulator entnehmen, ohne ihn zu schädigen.
Der obere Plattenrand soll immer von der Säure bedeckt sein; ist
sie durch Verdunsten weniger geworden, so wird destilliertes Wasser
nachgegossen. Sollen mehrere Zellen dauernd zu einer Batterie
vereinigt werden, so dürfen die Verbindungen nur aus Blei (Draht oder
Blechstreifen) bestehen und müssen in der oben angegebenen Weise
verschmolzen werden. Man sehe immer von Zeit zu Zeit zwischen den
Platten durch, ob sich nichts dazwischen gesteckt hat, denn es kommt
leicht vor, daß losgelöste Mennige zwischen den Platten Kurzschluß
bildet; solche Teilchen sind zu entfernen. Akkumulatoren, die zum
Laden nicht aus dem Haus getragen werden müssen, werden vorteilhaft
nicht mit einem festen Verguß, sondern nur mit einem lose aufsitzenden
Deckel verschlossen. Werden die Akkumulatorenzellen in Holzkästen
eingebaut, so sollten diese stets seitliche Öffnungen haben, durch die
man zwischen die Akkumulatorenplatten sehen kann. Sind Platten infolge
langen Gebrauches schlecht geworden oder haben sie sich verbogen, so
werden sie herausgenommen und getrocknet; dann entfernt man durch
leichtes Klopfen alles lose sitzende Bleisuperoxyd und streicht
in die mit verdünnter Schwefelsäure angefeuchtete Platte wie oben
neuen Mennigebrei ein. Darauf werden die Platten zwischen feuchten
Leinenlappen ein paar Stunden gepreßt und endlich wieder eingesetzt.
[S. 82]
Kupronelement.
Endlich sei noch das Kupronelement (Kupferoxydelement) erwähnt, das
wohl von allen primären Elementen — so nennt man alle obengenannten
Elemente zum Unterschied vom Akkumulator, den man auch sekundäres
Element nennt — das beste ist; es liefert bei 0,9 Volt einen sehr
konstanten Strom und erfordert fast keine besondere Bedienung. Es hatte
aber für Rudi einen sehr großen Nachteil: die guten Fabrikate sind sehr
teuer und die billigeren älteren Konstruktionen nicht empfehlenswert.
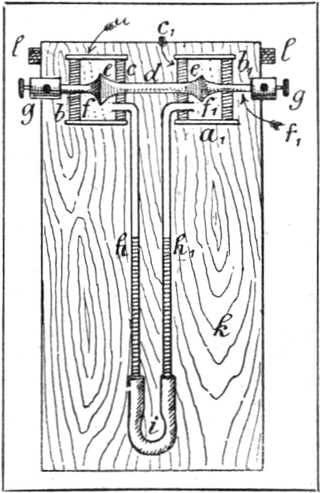
Abb. 63. Luftthermometer zum Nachweis des
Peltiereffektes.
Thermoelemente.
Zum Schluß seien auch noch die Thermoelemente erwähnt, die für unsere
Zwecke nur theoretisches Interesse haben, da sie als Stromquellen
nicht in Betracht kommen. Rudi führte in seinem Vortrage ungefähr
folgendes aus: Wir haben gesehen, daß bei der Berührung von zwei
verschiedenen Metallen auf diesen eine Spannungsdifferenz auftritt,
die unter Zwischenschaltung von Elektrolyten recht groß werden kann.
Es zeigen sich überhaupt immer eigentümliche Erscheinungen und nicht
nur solche elektrischer Natur bei der Berührung verschiedener Stoffe.
So hat man (Peltier) z. B. gefunden, daß die Temperatur der Lötstelle
zweier verschiedener Metalle sich beim Stromdurchgang verändert,
und zwar je nach den Metallen und der Stromrichtung positiv oder
negativ. Zum Nachweis dieser Temperaturveränderung baute sich Rudi
folgenden Apparat, der im wesentlichen zwei hintereinander geschaltete
Luftthermometer darstellt. Die Anordnung erkennen wir aus der etwas
schematisierten Abb. 63. Die Thermometergefäße bestehen aus zwei
kurzen Stücken eines weiten Glasrohres a, a₁ (in
der Abbildung im Schnitt gezeichnet), die beiderseits durch Korke
verschlossen sind; die Korke b und b₁ erhalten je
eine, c und c₁ je zwei Bohrungen. Einen etwa
3 mm starken Eisendraht d hämmert man an seinen Enden
e, e[S. 83] breit und schneidet gerade ab; an die dadurch
entstandenen Schneiden lötet man die ebenso hergerichteten Enden je
eines 3 mm starken Kupferdrahtes f und f₁;
die freien Enden werden mit Klemmschrauben g und g₁
versehen. Dieser Streifen f, d, f₁ wird mittels
der Korke b und c so zwischen den beiden Glasrohrstücken
festgehalten, wie dies aus der Figur erhellt. Durch die zweite Bohrung
der beiden Korke c und c₁ sind die oben rechtwinkelig
umgebogenen Glasröhren h und h₁ eingelassen, deren
untere Enden durch den Gummischlauch i miteinander verbunden
sind. h und h₁ sind etwa zur Hälfte mit irgend einer
farbigen Flüssigkeit gefüllt. Die Korke werden mit Siegellack oder
Kolophonium-Wachskitt abgedichtet. Der ganze Apparat ist auf einem
Grundbrett k aufmontiert, auf dessen Unterseite die Leiste
l angeschraubt wird, die so hoch sein muß, daß k mit der
Tischebene einen Winkel von etwa 10° bildet. Leitet man von einem oder
mehreren Elementen (bei Akkumulatoren muß, weil sonst durch Kurzschluß
Schaden entstehen könnte, ein Widerstand vorgeschaltet werden) einen
Strom z. B. von g nach g₁, so sieht man, daß in
h die Flüssigkeit steigt und in h₁ entsprechend
fällt; d. h. so viel, als daß sich die Luft in a zusammenzieht,
also abgekühlt wird, in a₁ sich ausdehnt, also
erwärmt wird. Wird die Stromrichtung umgekehrt, so dreht sich
auch die Temperaturerscheinung um. Indem man diesen Versuch auch mit
anderen Metallen als mit Eisen und Kupfer ausführt, ergibt sich wie
bei der Voltaschen Säule eine Spannungsreihe, in der die Metalle so
angeordnet sind, daß, wenn der Strom von einem vorstehenden zu einem
nachstehenden fließt, die Lötstelle immer abgekühlt wird und daß der
Grad der Abkühlung umso stärker ist, je weiter die beiden Stoffe in der
Reihe auseinanderstehen. Die wichtigsten Stoffe der Reihe sind: Wismut,
Quecksilber, Platin, Gold, Kupfer, Zinn, Blei, Zink, Silber, Eisen,
Antimon.
Wenn man nun den Apparat so abändert, daß man den in Abb. 63 mit
d bezeichneten Eisendraht länger (etwa 20 cm) macht
und ihn nicht in ein Luftthermometer einschließt, sondern die eine
Lötstelle in eine Kältemischung (Salz-Eis), die andere in siedendes
Wasser bringt, also die eine abkühlt und die andere erwärmt, und die
Klemmen g[S. 84] und g₁ mit einem Galvanoskop verbindet,
so zeigt dieses das Vorhandensein eines Stromes an, der um so stärker
ist, je größer die Temperaturdifferenz an den beiden Lötstellen ist.
Untersucht man auch hier verschiedene Metalle, so ergibt sich die
gleiche Spannungsreihe wie oben, bei welcher Anordnung der positive
Strom an der wärmeren Lötstelle von einem in der Reihe früher zu einem
in der Reihe später stehenden Metall fließt.
Die in solchen Thermoelementen erzeugten Ströme, die thermoelektrischen
Ströme, sind aber so schwach, daß sie in der Praxis nur für eine ganz
spezielle Verwendung Bedeutung haben, nämlich zu Temperaturmessungen.
Da man auch die schwächsten elektrischen Ströme noch mit großer
Genauigkeit messen kann und da bei einem Thermoelement sich die
allergeringste Temperaturänderung in einer, wenn auch geringen, so
doch meßbaren Änderung des Thermostromes äußert, so benutzt man das
Thermoelement, verbunden mit einem feinen Galvanometer, direkt zur
Messung kleinster Temperaturdifferenzen.
Nachdem wir die Herstellung der verschiedensten Elemente kennen gelernt
haben, wollen wir hören, was Rudi über die Gesetze des galvanischen
Stromes vorgetragen und welche erklärenden Versuche er dabei ausgeführt
hat.
Die Gesetze des galvanischen Stromes.
Was wir unter elektromotorischer Kraft verstehen, haben wir schon
gehört, wie auch, daß sie abhängig ist von der Größe der Spannung, die
infolge der chemischen Einflüsse auf den beiden Elektroden auftritt.
Noch nicht erwähnt haben wir, wie Rudi an einem sehr einfachen
Experimente zeigte, von welcher Bedeutung für die elektromotorische
Kraft eines Elementes sowohl die Natur der beiden Elektroden als auch
die der Flüssigkeit sei: In ein Standglas mit Wasser stellte er eine
Eisen- und eine Zinkplatte, die je mit einem längeren Draht versehen
waren, und wies mit einem Multiplikator, dessen Herstellung später
beschrieben wird (Seite 92 bis 96), das Vorhandensein eines sehr
schwachen Stromes nach. Dann schaltete er den Multiplikator aus und
eine 1,5 Volt-Glühlampe in den Stromkreis ein, die nicht glühte;
aber als er etwas Schwefelsäure[S. 85] unter das Wasser mischte, begann der
Kohlenfaden schwach rot zu werden, leuchtete aber erst dann hell auf,
als die Eisenplatte durch eine solche von Kupfer ersetzt wurde.
Ein zweiter Versuch sollte zeigen, daß je nach den Verhältnissen ein
Strom bei gleichbleibender elektromotorischer Kraft verschieden stark
sein kann: In den Stromkreis eines Leclanchéelementes schaltete Rudi
mit zwei kurzen Drähten eine 1,5 Volt-Glühlampe ein, die hell glühte.
Dann ersetzte er den einen der kurzen Drähte durch einen sehr langen
und sehr dünnen Kupferdraht, worauf das Lämpchen nur noch mit halber
Kraft glühte. Darauf vertauschte er den Kupferdraht mit einem kurzen
Nickelindraht, und die Lampe wurde noch etwas dunkler. An Hand dieser
Versuche wies er darauf hin, daß die Stärke eines Stromes nicht nur
von der ihn treibenden Kraft abhängt, sondern auch von der Natur
der ihn leitenden Stoffe und von der Länge und Dicke seines Weges.
In dem langen Draht ist der Strom schwächer als in dem kurzen; bei
gleichlangen Drähten verliert er in Nickelin mehr von seiner Kraft als
in Kupfer, in einem dünnen Draht mehr als in einem dicken. Es scheinen
also die Metalle zwar den Strom zu leiten, aber nicht, ohne ihm einen
gewissen Widerstand entgegenzusetzen; denn sonst würde der Strom nicht
in einem langen Leiter mehr geschwächt werden als in einem kurzen, in
einem dünnen nicht mehr als in einem dicken. Auch leiten verschiedene
Metalle verschieden gut. Haben wir nun recht aufgepaßt, so konnte uns
nicht entgehen, daß wir es hier mit drei Größen zu tun haben: 1. mit
der elektromotorischen Kraft, unmittelbar abhängig von der Spannung,
die auf den Elektroden entsteht, und deren Maßeinheit das Volt
ist; 2. mit der Stromstärke, denn je heller die Lampe glühte, desto
stärker mußte der sie durchfließende Strom sein; die Einheit für die
Stärke oder die Intensität des Stromes ist 1 Ampere; 3. mit
dem Widerstand, den wir in Ohm messen. (Die elektromotorische
Kraft sei fernerhin immer mit E, die Intensität des Stromes mit
J und der Widerstand mit W bezeichnet; man setzt oft
auch die Anfangsbuchstaben der drei Einheiten: V, A,
O.) Durch genaue Messungen hat man[S. 86] nun ein sehr einfaches
Gesetz gefunden, das zwischen diesen Größen besteht: es ist das Ohmsche
Gesetz und sagt aus, daß J umso größer ist, je größer E
und je kleiner W ist, oder in eine Formel gefaßt: J
proportional EW. Man hat zur Vereinfachung die drei
Einheiten so gewählt, daß sogar J = EW ist.
Daraus ergibt sich E = J · W, oder in Worten:
E ist umso größer, je größer J und je größer W
ist; ferner ergibt sich, daß W umso größer ist, je größer
E und je kleiner J ist: W =
EJ.
Des weiteren schaltete Rudi in den Stromkreis eines Leclanchéelementes
eine 2 Volt-Glühlampe[4], die nur schwach glühte; dann schaltete
er zwei Elemente hintereinander, das heißt so, daß er den Kohlepol
des einen mit dem Zinkpol des anderen verband; als er nun die Lampe
einschaltete, glühte sie hell. Diesen Vorgang erklärte er wie folgt:
Wie schon erwähnt, besteht auf den Elektroden eines Elementes eine
Spannungsdifferenz; hier beträgt sie etwa 1 Volt; das Zink hat eine
Ladung negativer Elektrizität von ½ Volt, das Kupfer eine
solche positiver Elektrizität von ½ Volt. Bringe ich nun das
Zink mit der Erde in leitende Verbindung, so sinkt sein Potential (=
Spannung) auf den Wert 0; da aber die Spannungsdifferenz des Elementes
immer gleich 1 ist, so muß nun das Potential des Kupfers auf 1 Volt
steigen. Bringe ich das Zink in Verbindung mit dem Konduktor einer
Elektrisiermaschine, so steigt seine Spannung auf 100000 Volt und
folglich die des Kupfers auf 100001 Volt. Daraus ergibt sich nun
folgende praktisch sehr wichtige Tatsache: Schalte ich eine größere
Anzahl von Elementen, sagen wir zehn, so, daß jeweils die negative
Elektrode des einen mit der positiven des nächsten verbunden wird, so
wirkt in der dadurch entstandenen Reihe[S. 87] (Kette) eine zehnmal größere
elektromotorische Kraft als in einem Element; denn nehmen wir
die Spannung auf dem Kupfer des ersten Elementes als 1 Volt an, so
werden alle mit ihm verbundenen aber sonst isolierten Leiter dieselbe
Spannung annehmen. In unserem Fall wird das Zink des zweiten Elementes
ebenfalls die Spannung von 1 Volt erhalten, damit steigt aber das
Potential des Kupfers im zweiten Element auf 2 Volt; da mit dieser
Kupferplatte aber die dritte Zinkelektrode ebenfalls eine Spannung von
2 Volt erhält, so steigt diese beim dritten Kupferpol auf 3 Volt und
so fort, bis wir bei der zehnten und letzten positiven Elektrode eine
Spannung von 10 Volt haben. Bei dem Zink des ersten Elementes haben wir
das Potential 0 angenommen und so ergibt sich eine Spannungsdifferenz
von 10 Volt; es ist also auch die elektromotorische Kraft dieser Kette
zehnmal größer als die eines einzelnen Elementes. Wir können nun aber
auch alle gleichnamigen Elektroden miteinander verbinden, also die
Zinkplatten aller Elemente zusammen und die Kupferplatten zusammen;
dadurch gewinnen wir an elektromotorischer Kraft nichts. Die Vorteile
dieser Schaltungsweise werden wir nachher kennen lernen.
Wir können nun mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes einige einfache
Berechnungen machen. Nehmen wir an, wir hätten eine Anzahl von
Elementen und einen Stromkreis von einem bestimmten Widerstand
gegeben. Wir wollen nun berechnen, wie wir die Elemente schalten
müssen, ob hintereinander oder nebeneinander, um einen möglichst
starken Strom zu erhalten. Nehmen wir ein Bunsenelement und verbinden
wir seine Pole mit irgend einem Widerstand (z. B. einer Glühlampe),
so ist nach dem Ohmschen Gesetz die Intensität des Stromes gleich
der elektromotorischen Kraft des Bunsenelementes dividiert durch den
gesamten Widerstand; dabei ist nicht zu vergessen, daß der Strom
auch die Flüssigkeit des Elementes zu passieren hat und in ihr einen
Widerstand findet, der umso kleiner ist, je größer und einander näher
die Elektroden sind; man nennt ihn den inneren Widerstand des
Elementes.
[S. 88]
Vereinige ich nun etwa zehn Elemente so, daß ich jeweils den Kupferpol
des einen mit dem Zinkpol des nächsten verbinde, also hintereinander
oder, wie man auch zu sagen pflegt, in Serie, so tritt in dieser
Anordnung von Elementen die zehnfache elektromotorische Kraft eines
einzigen Elementes auf. Aber auch der innere Widerstand ist nun zehnmal
so groß, so daß sich für die gesamte Stromstärke ergibt: zehnfache
elektromotorische Kraft eines Bunsenelementes geteilt durch den
äußeren Widerstand plus dem zehnfachen inneren eines Elementes;
oder in einer Formel geschrieben: 10 EO + 10 W. Dabei sei mit O der äußere, mit W der
innere Widerstand bezeichnet. Ist nun der äußere Widerstand so klein
im Verhältnis zum inneren, daß wir ihn, ohne einen allzu großen
Fehler zu begehen, vernachlässigen können, so haben wir J =
10 E10 W
oder J = EW. In diesem
Falle ist es also ziemlich gleich, ob man ein oder zehn hintereinander
geschaltete Elemente benützt.
Ist dagegen der äußere Widerstand sehr groß, so daß man ihm gegenüber
den inneren vernachlässigen kann, so ist annähernd: J =
10 EO. Diesmal haben wir also beinahe die zehnfache
elektromotorische Kraft, als wenn wir nur ein Element benützten.
Nun kann man aber auch die zehn Elemente so zusammenschalten, daß man
einerseits alle Zink-, anderseits alle Kohlenelektroden miteinander
verbindet, das heißt, wie schon erwähnt, daß man sie alle nebeneinander
schaltet. Dadurch gewinnen wir zwar nichts an elektromotorischer Kraft,
dafür haben wir aber nur 1⁄10 des inneren Widerstandes eines einfachen
Elementes. Die Stromstärke berechnet sich hier also folgendermaßen:
J =
EO + 1⁄10 W.
Nehmen wir nun den äußeren Widerstand sehr klein an, so ist J =
E1⁄10 W
= 10 EW,
die Intensität ist also nahezu zehnmal so groß, als wenn wir nur ein Element[S. 89] gebrauchten. Ist
umgekehrt dagegen der äußere Widerstand sehr groß, so ist J =
EO, also nicht stärker als bei nur einem Element.
Daraus ergibt sich also die Regel:
Will man von einer Anzahl von Elementen einen möglichst starken Strom
erhalten, so schalte man sie bei einem sehr großen äußeren Widerstand
hintereinander, bei einem sehr kleinen dagegen nebeneinander. Wir
können auch die beiden Schaltungsweisen kombinieren, je nachdem es das
Verhältnis des äußeren zum inneren Widerstand als günstig erscheinen
läßt. Abb. 64 zeigt fünf verschiedene Schaltungsweisen.
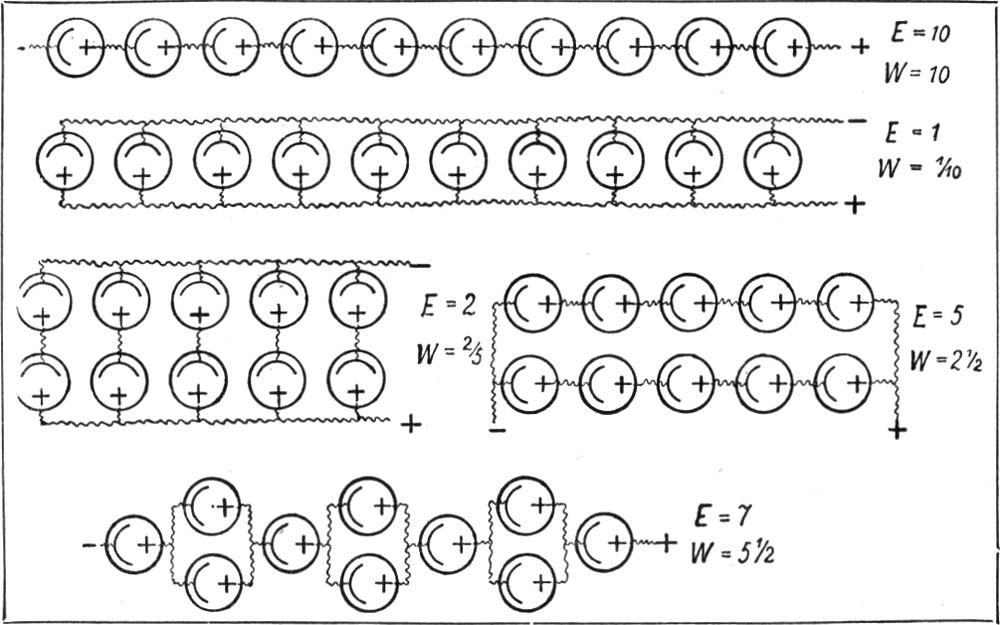
Abb. 64. Darstellung fünf verschiedener Schaltungsarten.
Bei all diesen Versuchen hatte Rudi, um die verschiedenen Stromstärken
sichtbar zu machen, sich kleiner Glühlampen bedient. Er tat dies, um
nicht Apparate verwenden zu müssen, die er erst später beschreiben
wollte. Bei manchen Versuchen wäre es trotzdem geeigneter gewesen, wenn
er sich des Galvanoskopes oder eines Voltmeters bedient hätte. Da für
die nächsten Versuche diese Apparate unumgänglich nötig sind, so seien
sie an dieser Stelle beschrieben.
[S. 90]
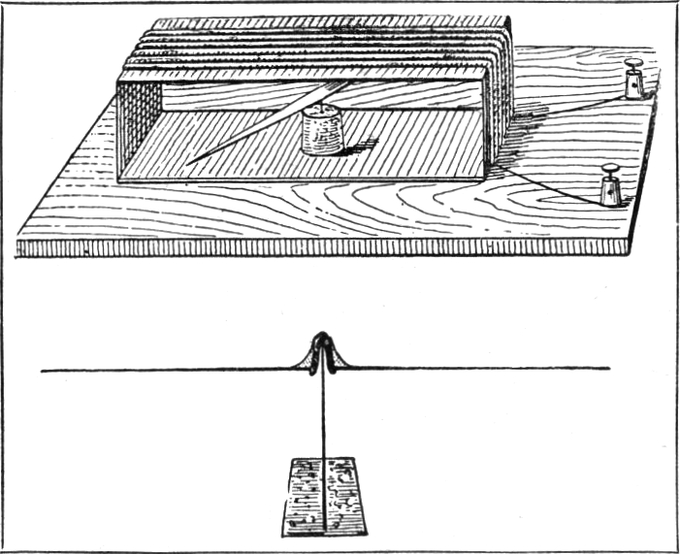
Abb. 65. Galvanoskop.
Einfaches Galvanoskop.
Um einen aus einem Pappestreifen gebogenen Rahmen wickeln wir einige
Windungen von isoliertem Kupferdraht auf. In den Rahmen stellen wir
einen gewöhnlichen Kompaß und drehen nun ersteren so, daß seine
Windungen parallel der Magnetnadel verlaufen. Schicken wir dann
einen Strom durch den Draht, so wird die Magnetnadel aus ihrer
Nord-Südrichtung abgelenkt und kommt in einer zu den Windungen nahezu
senkrechten Stellung wieder zur Ruhe. Rudi hatte sich in dieser Art
besonders für Demonstrationszwecke einen ziemlich großen Apparat
hergestellt (Abb. 65). Auch die große, 10 cm lange Magnetnadel
hatte er sich selbst gefertigt, indem er ein Stück einer alten Uhrfeder
zuerst völlig durchglühte, ihm dann durch Beschneiden mit einer
Blechschere die doppelte Lanzettform gab und in die Mitte ein Loch
bohrte, durch das er, nachdem er die Nadel wieder gehärtet hatte, ein
auf einer Seite zugeschmolzenes kurzes Glasröhrchen (etwa 5 mm
lang) steckte, um es dann mit etwas Siegellack zu befestigen (besser
wäre auch hier unser Kolophonium-Leinölkitt). Durch Streichen mit
einem starken Magneten verlieh er nun der Nadel eigenen Magnetismus.
Eine durch einen Kork gesteckte Nähnadel bildete die Spitze, auf der
die Nadel schwebte. Wie Magnete herzustellen sind, werden wir noch an
anderer Stelle des Buches (S. 103) ausführen.
Vertikalgalvanoskop.
Für den Nachweis sehr schwacher Ströme genügt jedoch dieses Instrument
nicht; auch ist es, selbst wenn es noch so[S. 91] groß ausgeführt ist,
zur Demonstration wenig geeignet, da man es, um Beobachtungen zu
machen, von oben betrachten muß. Rudi hatte sich deshalb auch noch
ein Vertikalgalvanoskop hergestellt. Abb. 66 zeigt ein solches von
ziemlich einfacher Art. Der Rahmen, auf den der isolierte Kupferdraht
aufgewunden wird, ist 10 cm lang, 0,5 cm breit, 3
cm tief und ist aus dünnem Zink- oder Messingblech gefertigt.
Abb. 67 zeigt das Netz, Abb. 68 den fertigen Rahmen, der auf der
Außenseite mit einem dicken Schellacküberzug versehen und dann mit
30 bis 40 m eines 0,5 bis 0,6 mm starken isolierten
Kupferdrahtes umwickelt wird.
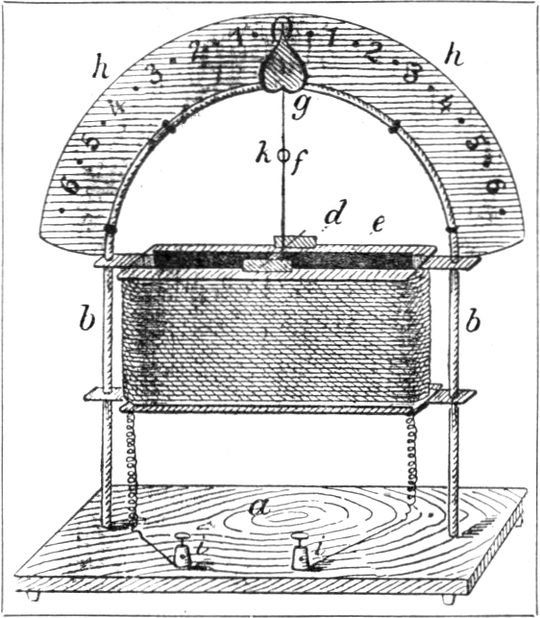
Abb. 66. Vertikalgalvanoskop.
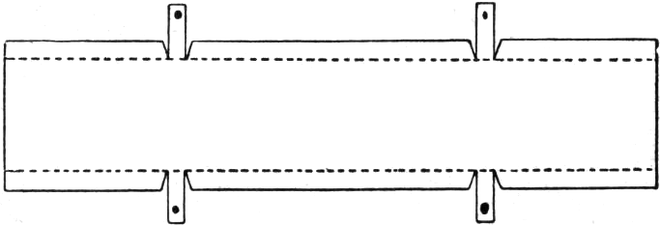
Abb. 67. Netz für das Vertikalgalvanoskop.
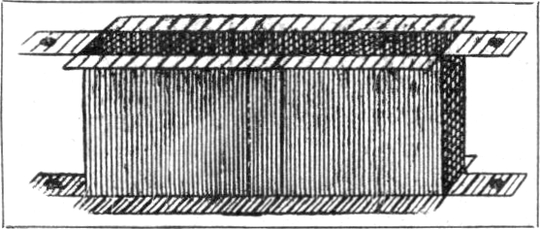
Abb. 68. Rahmen.
Nun biegen wir uns einen 2 bis 3 mm starken Messingdraht so
wie den in Abb. 66 mit b bezeichneten und befestigen an ihm
den Blechrahmen in der ebenfalls aus der Abbildung hervorgehenden
Weise. Auf den beiden oberen Rändern des letzteren werden noch zwei
Blechstreifchen (d) angelötet, die als Lager für die Achse
dienen und deren Form Abb. 69 d zeigt. Bei einem Mechaniker
kaufen wir uns einen flachen, etwa 9 cm langen Stabmagneten
(e)[S. 92] — wir können ihn uns auch selbst anfertigen, wie es bei
der magnetelektrischen Maschine beschrieben ist —, den wir in der
Mitte mit einem Band aus Messingblech (m) versehen. Dabei
legen wir die Enden des Bandes nicht übereinander, sondern biegen
sie nach oben und löten sie zusammen. Dadurch entsteht eine kleine
Lasche, welche wir durchbohren, um das 1,5 cm lange Stück
einer Stricknadel (l) hindurchzuschieben und festzulöten.
Außerdem wird daran ein etwa 10 cm langer, 1 mm starker
Kupferdraht (f) angelötet. An der Unterseite des Bandes wird ein
kürzeres Stück Draht angelötet, an welchem wir ein kleines Scheibchen
aus Bleiblech (n) befestigen. An dem Draht f bringen
wir ein Scheibchen aus Messingblech (k) so an, daß wir es
verschieben können, außerdem an seinem oberen Ende eine herzförmige
Zeigerspitze (g) aus rotem Papier. Über dem gebogenen Teil
des Drahtes b (Abb. 66) befestigen wir eine aus weißem Karton
ausgeschnittene Skala (h). Nun sind die beiden Drahtenden der
Spule noch zu zwei Klemmen (i, i) auf dem Grundbrette zu
führen, und der Apparat ist fertig.
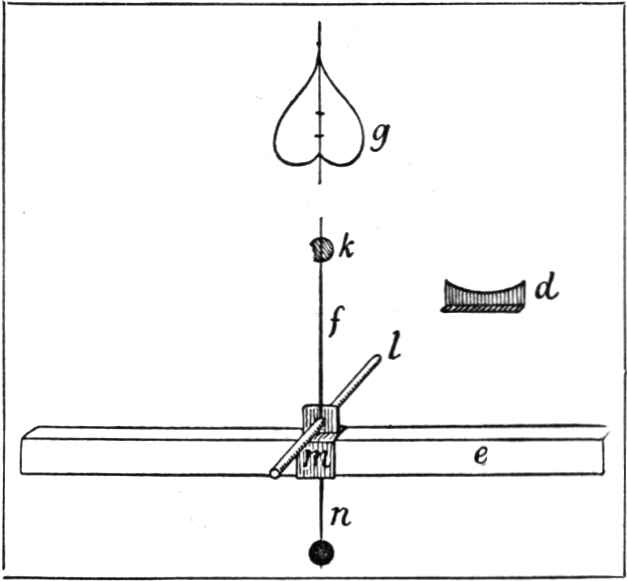
Abb. 69. Stabmagnet.
Obgleich das eben beschriebene Instrument schon recht empfindlich ist
— die Empfindlichkeit läßt sich durch Verschieben der Messingscheibe
k nach oben vermehren, durch Verschieben nach unten verringern
—, so wird es uns nicht für alle Fälle genügen, und wir wollen
deshalb sehen, wie wir uns einen Apparat fertigen können, der an
Empfindlichkeit für schwache elektrische Ströme nichts zu wünschen
übrig läßt.
Der Multiplikator.
Der Multiplikator, wie man ein solches Instrument nennt, ist im Prinzip
nicht anders konstruiert, als die beiden obigen Apparate:[S. 93] ein Magnet,
der sich senkrecht zu den vom Strome durchflossenen Windungen einer
Drahtspule zu stellen sucht.
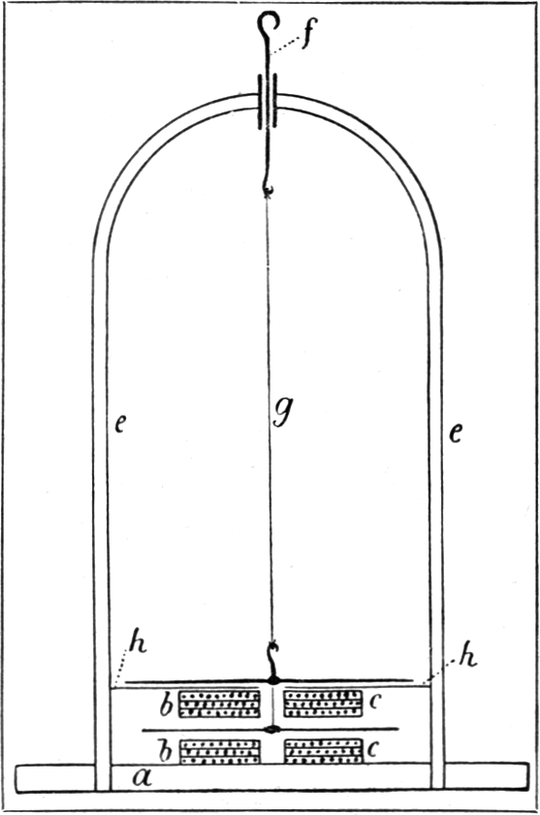
Abb. 70. Multiplikator im Vertikalschnitt.
Abb. 70 zeigt uns den Multiplikator im Vertikalschnitt: a
ist ein kreisrundes Grundbrett, an dessen Rande drei verstellbare
Schrauben die Füße bilden. Auf dem Brett liegen mit 3 bis 4 mm
Zwischenraum zwei Drahtspulen nebeneinander (b und c),
die beide im allgemeinen genau so zu verfertigen sind, wie die des
Vertikalgalvanoskopes, nur müssen sie kleiner sein als jene, etwa 7
cm lang, 2 cm breit, und es darf der Spulenrahmen nicht
aus Weißblech gemacht werden, wie überhaupt jede Spur von Eisen an
dem Apparat zu vermeiden ist. Für die Rahmen verwenden wir dünnes
Zink-, Kupfer- oder Messingblech, oder wir kleben sie aus Karton
zusammen. Das Bewickeln hat für jede Spule mit 30 bis 34 m
0,4 mm starken Drahtes zu geschehen, und es muß jede Lage von
der nächsten durch ein in Schellackfirnis getränktes Papier getrennt
werden. Man sehe sich vor, daß die Isolierung des Drahtes nirgends
verletzt werde. Die fertigen Spulen klebt man mit Schellack in 3 bis
4 mm Abstand genau in die Mitte des Grundbrettes. Die beiden
äußeren Drahtenden werden zu zwei Klemmen auf den Rand des Brettes
a geführt, die beiden inneren werden miteinander verbunden.
Sind die Spulen richtig gelegt worden, so muß ein elektrischer Strom
beide in der gleichen Richtung durchfließen.
Bei diesem Instrument kommt nun nicht nur eine Magnetnadel
zur Verwendung, sondern ein System von[S. 94] zweien, ein sogenanntes
astatisches Nadelpaar. Dies besteht aus zwei miteinander
verbundenen und parallelen Magnetnadeln, die mit den ungleichnamigen
Polen übereinanderliegen. Von einer ziemlich dünnen Stricknadel
schneiden wir uns zwei Stäbchen ab, das eine 6 cm, das andere 7
cm lang. Die beiden Enden des längeren schleifen wir auf einem
Schleifsteine zu feinen Spitzen aus. Die Nadeln werden dann, nachdem
sie magnetisiert sind, in einem Abstande, der sich aus der Dicke der
Spulen ergibt (5 bis 7 mm), so miteinander verbunden, wie es
Abb. 71 darstellt: mit einem geglühten und mit Glaspapier gereinigten,
etwa 8 mm starken Kupfer- oder Messingdrahte wird die Mitte
zuerst der kürzeren, dann mit dem richtigen Abstande die der längeren
Nadel umwunden und schließlich das Ende des Drahtes zu einem Häkchen
umgebogen, dessen oberste Stelle genau über der Mitte der beiden Nadeln
liegen muß. Um der Befestigung noch mehr Halt zu geben, löten wir die
Windungen des Kupferdrahtes zusammen. Dies hat mit einem Lötkolben zu
geschehen und muß möglichst rasch ausgeführt werden, damit die Härte
des Stahles der Nadeln nicht durch zu große Erhitzung leidet.
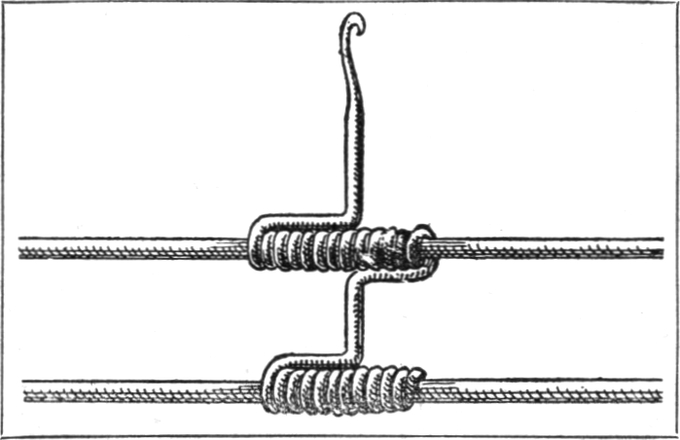
Abb. 71. Astatisches Nadelpaar.
Zum Aufhängen des Nadelpaares an einem Seidenfaden dient uns der
Drahtbogen e, der aus 3 bis 4 mm starkem Messingdrahte
gebogen ist und mindestens 20 cm hoch sein soll. Nachdem wir
die beiden Schenkel des Bogens unten in das Grundbrett eingelassen
und befestigt haben, sägen wir ihn oben in der Mitte auseinander, um
zwischen die dadurch entstandenen Enden ein 4 bis 5 mm weites
dünnwandiges Messingröhrchen einzulöten, wie es Abb. 72 a im
Schnitt, b in der Ansicht zeigt. Da in diesem[S. 95] Röhrchen der
Stift f (Abb. 70), der als Aufhängepunkt für den Seidenfaden
dient, verschiebbar sein soll, so müssen die Wandungen des Röhrchens
federnd an ihm anliegen, was dadurch erreicht wird, daß wir es von oben
und unten mit zwei Sägespalten versehen (siehe Abbildung 72 b)
und dann seitlich etwas zusammendrücken. An dem Stift f,
der oben mit einem Knopf, unten mit einem Häkchen zu versehen ist,
werden einige nicht gedrehte Kokonfäden (g) befestigt, deren
unteres Ende in das Ringchen des Nadelpaares eingeknüpft wird. Die
für diesen Zweck geeignetsten Kokonfäden sind als Seidenumspinnung
an den guten elektrischen Kabelschnüren zu finden. Auch aus
loser, nicht zu stark gedrehter Stickseide können wir gute Kokonfäden
herausziehen. Der Faden muß so lang sein, daß bei einer mittleren
Stellung des Stiftes f die untere Nadel genau in der Mitte des
Hohlraumes der beiden Spulen schwebt; die obere Nadel ist so weit von
der unteren entfernt, daß sie nun einige Millimeter über der oberen
Fläche der Spulen steht, auf welche noch eine mit einer Gradeinteilung
versehene runde Kartonscheibe (h) aufgeklebt wird; diese muß in
ihrer Mitte einen 7 cm langen, 4 mm breiten Spalt haben,
damit man die Nadel herausnehmen kann.
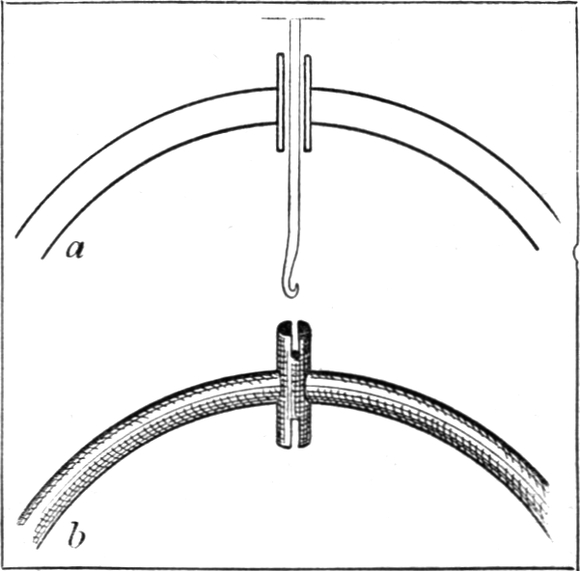
Abb. 72. Messingröhrchen für den Multiplikator.
Damit wäre unser Multiplikator in der Hauptsache fertig, nur müssen
wir die überaus leicht bewegliche Nadel vor Luftströmungen schützen
können, was wir durch eine über den ganzen Apparat gestülpte Glasglocke
erreichen. Wir können uns aber auch selbst eine durchsichtige
Schutzhülle herstellen, die uns nicht so teuer zu stehen kommt, indem
wir uns aus ebenen Glasplatten einen viereckigen[S. 96] Kasten nach Art
der auf Seite 79 beschriebenen Glasbehälter fertigen. Wer gar einen
unbrauchbar gewordenen, noch nicht zerschnittenen Rollfilm
erhalten kann, der verfahre wie folgt: Sagen wir, die Schutzhülle soll
einen Durchmesser von 10 cm und eine Höhe von 20 cm
bekommen. Wir schneiden uns von dem Film, der etwa 10 cm breit
sein mag, zwei 32 cm lange Stücke ab und befreien sie durch
Abwaschen in mäßig warmem Wasser von ihrer Gelatineschicht. Aus starkem
Karton kleben wir uns einen 10 cm weiten und 1 cm breiten
Ring, den wir mit Essigäther, welcher ein Lösungsmittel für Zelluloid
ist, bestreichen, und ziehen dann den Filmstreifen darüber, dessen
übereinanderfallende Ränder wir ebenfalls mit Essigäther bestreichen
und zusammenkleben. Den zweiten Streifen kleben wir oben an dem ersten
an. Dadurch ist ein etwa 20 cm hoher Zylinder entstanden, dessen
oberer Rand, wie der untere, noch durch einen Kartonstreifen verstärkt
wird. Die eine der Öffnungen des Zylinders wird mit einer kreisrunden
Zelluloidscheibe zugeklebt, und die Schutzhülle ist fertig.
Volt- und Amperemeter.
Die oben beschriebenen Apparate dienen, wie der Name schon sagt, mehr
dazu, das Vorhandensein galvanischer Ströme gewissermaßen
sichtbar (Galvanoskop) zu machen, weniger um ihre Stärke zu
messen; dazu gebrauchen wir besondere Meßinstrumente, Voltmeter
und Amperemeter (Galvanometer).
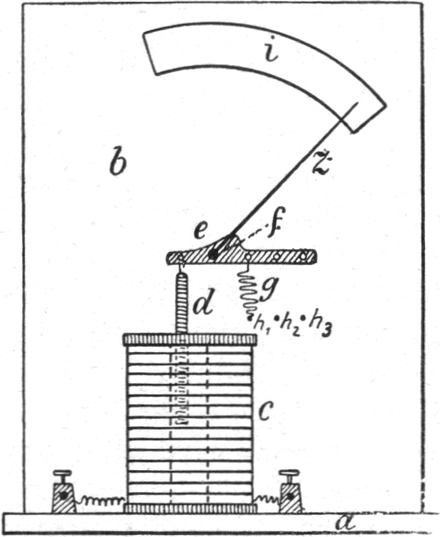
Abb. 73. Schema eines Voltmeters.
Abb. 73 zeigt uns das Schema eines Voltmeters. An dem Grundbrette
a, das mit Stollen versehen wird, ist die Rückwand b
angeschraubt. Auf a befestigt ist die Drahtspule c,
deren Bewickelung sich nach der Größe der mit dem Instrument zu
messenden Spannungen richten muß.[S. 97] d ist ein Eisenkern aus
gut durchgeglühtem weichem Eisen, der mit einer Drahtschlinge an dem
Hebel e aufgehängt ist. Abb. 74 zeigt diesen Hebel in etwas
größerem Maßstabe: Ein dünnes etwa 1 cm langes Messingröhrchen
(m), das glatt über einen 3 bis 4 cm langen Messingstift
paßt, dient als Lager im Drehpunkt des Hebels. Der Hebel selbst
(h in Abb. 74) wird aus 1 mm starkem Messingblech
geschnitten und auf m angelötet. Das Verhältnis der Armlängen
geht aus der Figur hervor. Der Zeiger z wird aus Kupferdraht
hergestellt und an h angelötet. Der Messingstift f
ist in b eingelassen. Die Spiralfeder g ist aus etwa
0,5 mm starkem ungeglühtem Kupferdraht hergestellt und soll
einen Durchmesser von 1 bis 1,5 cm haben. Entsprechend den
drei Einschnitten im Hebel sind auf dem Brett b drei Häkchen,
h₁, h₂, h₃ angebracht; dadurch kann man
die Feder an drei verschiedenen Punkten des Hebels angreifen lassen und
damit die Empfindlichkeit des Instrumentes regulieren. i ist ein
Kartonstreifen, auf den die Skala eingezeichnet wird.
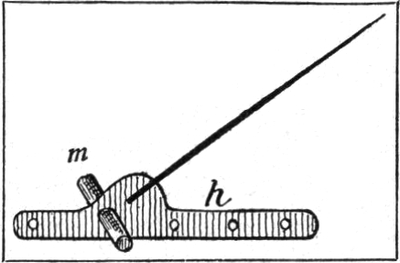
Abb. 74. Hebel.
Für unsere Zwecke wird für die Spule eine Bewickelung von 40 m
eines 0,3 bis 0,5 mm starken Kupferdrahtes geeignet sein. Da nun
ein Voltmeter, um als solches zu dienen, nicht in den Hauptstromkreis
eingeschaltet werden darf, sondern im Nebenschluß liegen muß, so müssen
wir einen Draht von geringerem Widerstand als dem der Spule auf der
Rückseite des Brettes b anbringen. Wir verwenden dazu einen 1
mm starken, 5 m langen Kupferdraht, dessen Enden wir wie
auch die der Spule zu Klemmen führen, die auf dem Grundbrette a
angebracht sind. Näheres über die Schaltungsweise werden wir später
hören.
Ein Amperemeter unterscheidet sich nur dadurch von einem Voltmeter, daß
es in den Hauptstromkreis eingeschaltet wird und deshalb die Windungen
der Spule in geringerer Zahl und von dickerem Draht sein müssen. Wir
werden also etwa 3 bis 5 m eines 1,5 bis 2 mm starken[S. 98]
Kupferdrahtes verwenden. Bei einem Mechaniker lassen wir uns die
Instrumente durch Vergleich mit guten Präzisionsapparaten eichen.
Abb. 75 zeigt uns eine andere Konstruktion eines Galvanometers welches
dadurch wirkt, daß sich in einer Drahtspule eine feste Eisenplatte und
ein bewegliches Eisenplättchen befinden; geht nun ein Strom durch den
Draht, so werden beide Eisenteile gleichnamig magnetisch und stoßen
einander ab.
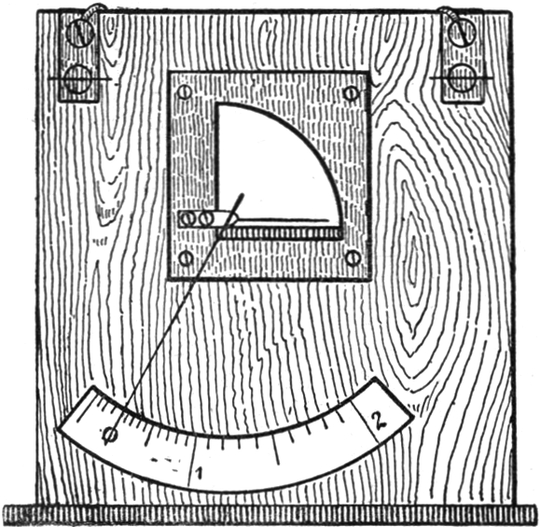
Abb. 75. Andere Konstruktion eines Galvanometers.
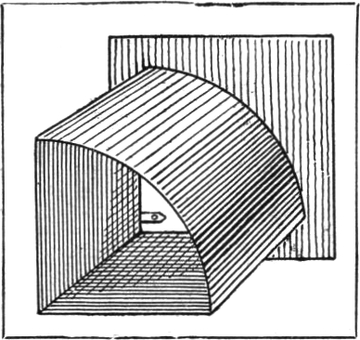
Abb. 76. Rahmen des Galvanometers.
Wir stellen uns aus dünnem Messingblech einen Rahmen her, dessen Form
Abb. 76 zeigt; die vordere Begrenzungsplatte ist in der Abbildung
weggelassen; sie soll ziemlich größer sein als die hintere und auch aus
etwas stärkerem Blech hergestellt werden. Auf dem Boden des Rahmens
befestigen wir eine 2 bis 3 mm starke Eisenplatte. In dem
Winkel, den diese Eisenplatte mit der geraden Seitenwand des Rahmens
bildet, soll die Drehungsachse für das bewegliche Plättchen liegen.
Da die Lagerreibung möglichst gering sein muß, stellen wir uns ein
Spitzenlager her: Ein Eisenstäbchen, 2 mm stark und 3 mm
länger als der Rahmen, wird an beiden Enden spitz zugefeilt. Nun wird
aus dünnem Weißblech ein rechteckiges Plättchen geschnitten, dessen
Größe sich aus der Konstruktion ergibt und außerdem aus Abb. 75 zu
ersehen ist und das, wie der aus Kupferdraht herzustellende Zeiger,
an das Eisenstäbchen anzulöten ist[S. 99] (siehe Abb. 77). Sowohl an der
vorderen als auch an der hinteren Begrenzungsplatte werden zwei kleine
Arme (e in Abb. 78) so angebracht, daß sie noch in die Öffnung
des Rahmens hineinragen. Beide erhalten je an einem ihrer Enden kleine
kegelförmige Vertiefungen (mit dem Körner einzuschlagen!), die zur
Aufnahme der Spitzen des Eisenstäbchens dienen. Einer dieser Arme darf
angelötet sein, während der andere mit zwei Schrauben befestigt wird.
Für die Bewickelung gilt bei diesem Instrument das gleiche wie bei dem
oben beschriebenen. Bevor wir jedoch den Draht auf den Metallrahmen
aufwinden, müssen wir ihn mit in Schellack getränktem Papier umkleben.
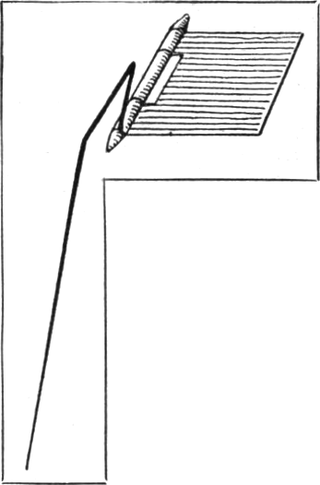
Abb. 77. Das Plättchen mit Zeiger.
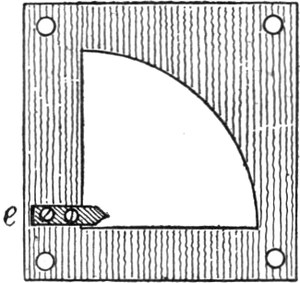
Abb. 78. Anbringen der Arme zur Aufnahme der Spitzen des
Eisenstäbchens.
Ein rechteckiges Brettchen wird auf ein Grundbrett aufgeschraubt
und erhält oben eine Öffnung, die so groß ist, daß wir den hinteren
Teil des Rahmens durchschieben können, daß sie aber von der
vorderen Begrenzungsplatte ganz bedeckt wird; letztere wird mit
vier Schrauben an dem Brett befestigt. Jetzt soll der Zeiger nicht
senkrecht herunterhängen, sondern unten etwas nach links sehen; das
Eisenplättchen soll horizontal liegen, mit dem Zeiger einen Winkel von
100 bis 110° bilden und in einem Abstand von höchstens 2 mm
über der Eisenplatte schweben. Ist es so leicht, daß es dem nach links
ragenden Zeiger nicht das Gleichgewicht halten kann, so hilft man sich,
indem man es mit einigen Tropfen Siegellack beschwert. Die Drahtenden
werden zu Klemmen geführt, und schließlich wird die Skala angebracht,
wie dies oben beschrieben wurde.
Die Messbrücke.
Zur Bestimmung von Widerständen bedient man sich im allgemeinen der
sogenannten Wheatstoneschen Brücke, die sehr einfach und leicht
herzustellen ist. Abb. 79 gibt die Ansicht einer solchen von oben,
Abb. 80 einen Querschnitt. a ist ein[S. 100] 10 cm breites,
1,10 m langes Brett aus gutem Holz (etwa Nußbaum); darauf
aufgeschraubt sind in einem Abstand von 2 cm die beiden Leisten
b₁ und b₂, zwischen denen der 3 cm lange
Schieber c₁ sich hin und her schieben läßt. Auf diesen
Schieber wird ein Messingblech aufgeschraubt, dessen Form aus Abb.
80 II (von oben gesehen) und III (von der Seite gesehen) zu erkennen
ist. An den Enden des Brettes werden zwischen den Leisten b₁
b₂ quadratische Brettchen aufgeleimt; auf diesen werden
je mit einer Klemmschraube die Enden eines 1 mm starken
Nickelindrahtes befestigt. Der Draht muß gut angespannt sein und genau
in der Mitte zwischen b₁ und b₂ verlaufen; außerdem
muß er auf der Spitze des Kontaktbleches e fest aufliegen. Auf
dem Brettchen b₂ wird nun noch ein Metermaß, auf dem auch
die Millimeter eingezeichnet sind, angebracht und auf dem Schieber
eine Noniuseinteilung, deren Nullpunkt genau vor der Spitze des
Kontaktbleches e liegen muß.
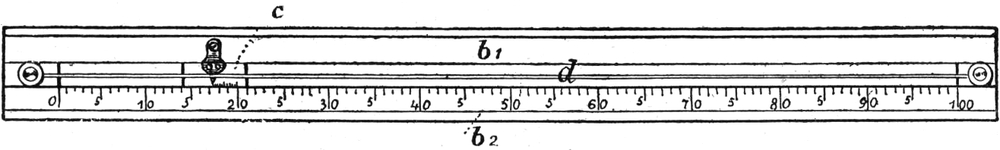
Abb. 79. Die Wheatstonesche Brücke.
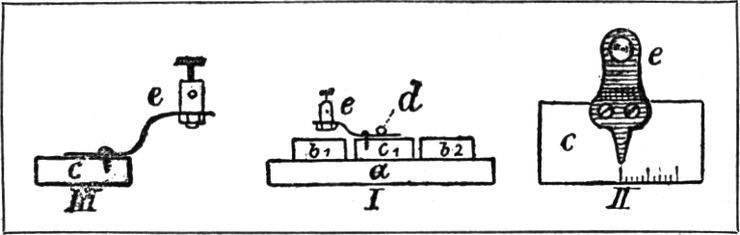
Abb. 80. Querschnitt der Wheatstoneschen Brücke.
Nun brauchen wir noch einen oder mehrere Vergleichswiderstände, das
heißt Drähte, deren Widerstände, in Ohm gemessen, uns bekannt sind. In
den einschlägigen Geschäften kann man sich geeichte Widerstände kaufen.
Außerdem sei erwähnt, daß ein 1 m langer und 0,5 mm
starker Nickelindraht einen Widerstand von etwa 2 Ohm, und daß ein 4
m langer und 0,3 mm starker Kupferdraht einen solchen von
ungefähr 1 Ohm besitzt.
[S. 101]
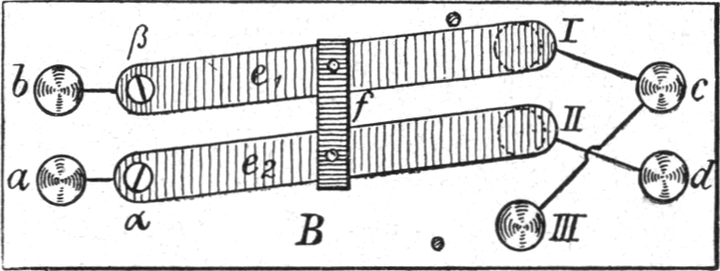
Abb. 81. Der Kommutator.
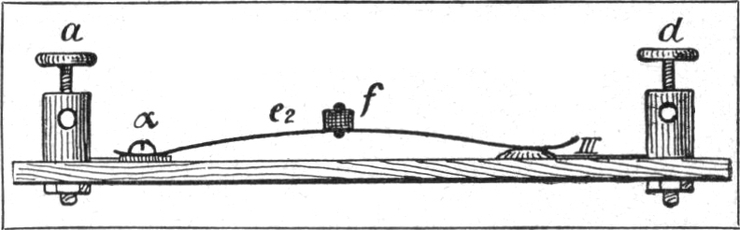
Abb. 82. Seitenansicht des Kommutators.
Der Kommutator.
Es fehlt uns nun noch der Kommutator oder Stromwender, das ist
eine Einrichtung, um mit einem einfachen Handgriff die Richtung
des Stromes in einer Leitung zu ändern. An den beiden Schmalseiten
eines Brettchens (B in Abbildung 81) befestigen wir je zwei
Klemmschrauben (a, b, c, d). Dann machen
wir zwei 5 mm starke und 7 cm lange Messingblechstreifen
(e₁ e₂) durch kräftiges Hämmern federnd und geben
ihnen die aus Abb. 82 (Seitenansicht) zu erkennende Form. Ihre Mitten
werden mit einem Hartgummi- oder Beinstäbchen (f), welches mit
Nieten befestigt wird, verbunden. Die nicht aufgebogenen Enden der
Federstreifen werden durchbohrt und bei α und β so angeschraubt, daß
sie sich gerade noch leicht drehen lassen. Die in Abb. 81 mit I, II,
III bezeichneten Punkte sind drei flachgewölbte, messingene Ziernägel,
die so anzubringen sind, daß jeweils zwei davon unter den Enden der
Federn e₁ und e₂ liegen. Nun werden die Klemmen
a mit α und b mit β durch ein kurzes Stück Kupferdraht,
das beiderseits anzulöten ist, verbunden. Ebenso werden I mit c,
II mit d und III wieder mit c verbunden. Die einzelnen
Verbindungsdrähte dürfen nicht in leitende Verbindung miteinander
kommen, die Enden von e₁ und e₂ müssen federnd und
fest auf den Nagelköpfen aufliegen. Verbinde ich nun den positiven Pol
einer Stromquelle mit a, den negativen[S. 102] mit b, so ist bei
der in Abb. 81 gezeichneten Stellung der Federn d die positive
und c die negative Klemme. Schiebe ich nun die Messingstreifen
so, daß sie die Köpfe II und III berühren, so wird c positiv und
d negativ.
Nachdem wir nun mit der Beschreibung aller der Apparate, die Rudi im
weiteren Verlauf seines Vortrages gebrauchte, zu Ende gekommen sind,
wollen wir in nachstehendem hören, welche Versuche er damit anstellte.
Der Einfluss des galvanischen Stromes auf den Magneten.
Rudi legte seine große Magnetnadel auf die Spitze des Gestelles, das
er sich für das elektrische Flugrad (Seite 17) gemacht hatte, und
versah deren nach Norden zeigende Spitze mit einem roten, die nach
Süden zeigende mit einem weißen Papierchen, um die Bewegungen der
Nadel deutlicher sichtbar zu machen. Er zeigte mit einem gewöhnlichen
Stabmagnet die Anziehung und Abstoßung der ungleichnamigen und
gleichnamigen Pole. Dann leitete er durch einen einfachen, zur Spirale
gewundenen Draht einen starken Akkumulatorenstrom — dabei durfte er
die Einschaltung eines Widerstandes (siehe Anhang) nicht vergessen,
da es sonst einen Kurzschluß (Seite 153) gegeben hätte — und zeigte,
daß diese Spirale die gleichen Eigenschaften aufwies, wie der Magnet.
Nun ließ er von seiner Schwester den Strom ausschalten und zog die
Spirale auseinander, so daß er einen gestreckten Draht in den Händen
hatte, welchen er parallel über die wieder zur Ruhe gekommene Nadel
hielt. Als Käthe den Strom wieder einschaltete, wurde die Nadel von
ihrer Nord-Südrichtung abgelenkt. Die gleichen Versuche machte Rudi mit
einigen aus vielen Windungen bestehenden Drahtspulen, wies auf
die nun erhöhte Wirkung hin und erklärte, daß die Wirkung einer solchen
Spule umso größer ist, je größer das Produkt aus der Zahl der Amperes
und der Zahl der Windungen (Amperewindungen) ist.
Die Kraftlinien.
Um den Begriff der Kraftlinien zu erläutern, legte Rudi einen
starken Stabmagneten unter einen weißen Karton, den er mit feinen
Eisenfeilspänen bestreute und durch Klopfen mit dem Finger[S. 103] leicht
erschütterte; dabei ordneten sich die Eisenspäne nach den Kraftlinien
des Magneten. Solche Kraftlinienbilder hatte sich Rudi schon vor dem
Vortrag mehrere hergestellt und sie durch sehr reichliches Bestäuben
mit Fixativ fixiert; diese gab er nun seinen Hörern, da die Linien
des anderen beim Herumgeben zu bald zerstört worden wären. Um zu
zeigen, daß sich um jeden Strom, auch wenn er geradlinig verläuft, ein
kreisförmiges magnetisches Feld ausbreite, steckte Rudi durch das Loch
einer dünnen Messingscheibe, die er mit Eisenfeile bestreute, einen 3
mm starken Kupferdraht, mit dem er seine Akkumulatorenbatterie
nur einige Sekunden kurz schloß, während er gleichzeitig die
Blechscheibe etwas erschütterte; dabei ordneten sich die Feilspäne in
konzentrischen Ringen um den Draht herum. (Man sei bei diesem Versuche
vorsichtig, da der Draht durch den Kurzschluß bis zum Glühen oder gar
Schmelzen erhitzt werden kann!) Wie sich nun diese Kraftlinien bei
einer Spule so vereinigen, daß sie eine ähnliche Anordnung wie beim
Magneten erhalten, erläuterte Rudi an einer Tafel, auf der das in Abb.
83 wiedergegebene Bild aufgezeichnet war. Bei dieser Gelegenheit wies
er auch darauf hin, daß die Größe der magnetischen Kraft mit der Zahl
der Kraftlinien, die z. B. durch 1 qcm gehen, also mit der
Dichte der Linien wächst.
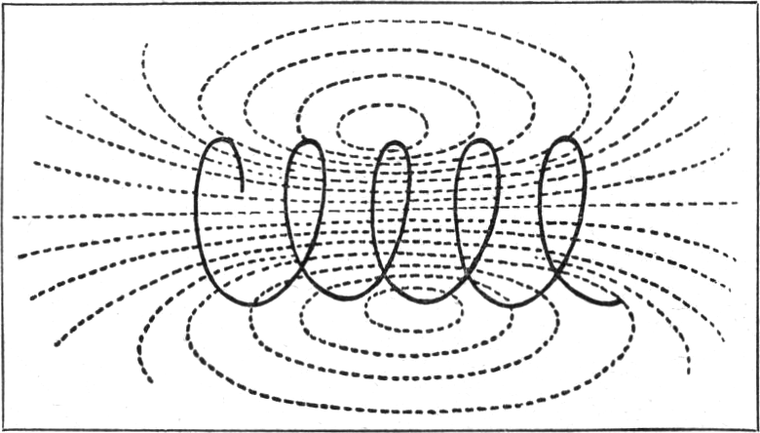
Abb. 83. Verlauf der Kraftlinien in einer vom
elektrischen Strome durchflossenen Drahtspirale.
Der Elektromagnet.
Für den nächsten Versuch stellte Rudi eine Spule (mit etwa 300
Windungen) so in der Nähe seiner Magnetnadel auf, daß diese, sobald
durch jene ein Strom in Stärke von drei Leclanché-Elementen floß, ein
wenig abgelenkt wurde. Ohne[S. 104] den Strom auszuschalten, schob er dann
einen Eisenstab in die Spule; dadurch wurde die magnetische Kraft
sofort um so viel stärker, daß die Magnetnadel ganz nach der Spule
hingezogen wurde. Dabei wies er darauf hin, daß jetzt die Kraftlinien
der Windungen nicht mehr allein wirken, sondern auch das
Eisen selbst magnetisch machen und dieses nun eigene Kraftlinien
erzeugt. Ferner erwähnte er, daß sich nicht alle Sorten von Eisen
gleich stark vom elektrischen Strome magnetisieren lassen und daß
weiches Eisen sich ganz anders verhalte wie Stahl. Er tauchte ein
Stück eines gut durchgeglühten 3 mm starken Eisendrahtes in
Eisenfeilspäne, welche nicht angezogen wurden; dann steckte
er über den Draht eine kleine vom Strom durchflossene Spule, und nun
wurden die Feilspäne angezogen; darauf entfernte er die Drahtrolle,
und die Späne fielen herab. Denselben Versuch machte er auch mit
einer stählernen Stricknadel; als er aber hierbei die Drahtspule
entfernte, fielen die Feilspäne nicht herab, sondern blieben hängen.
Die Erklärung dieser Vorgänge führte Rudi etwa folgendermaßen aus: Wir
müssen uns die Moleküle des Eisens als mit zwei magnetischen Polen
versehen vorstellen. Für gewöhnlich liegen diese kleinsten Teile
gänzlich ungeordnet, so daß sie ihre magnetischen Wirkungen gegenseitig
aufheben. Durch die Kraftlinien einer magnetischen Drahtspule werden
die Moleküle so geordnet, daß nach der einen Richtung alle ihre
nordmagnetischen Pole, nach der anderen alle südmagnetischen zeigen;
dadurch summieren sich ihre Wirkungen, so daß an den Enden des Stabes
der stärkste Magnetismus auftritt, wie dies ja auch beim gewöhnlichen
Stahlmagneten der Fall ist. Wird der elektrische Strom unterbrochen,
so fallen beim weichen Eisen die Moleküle wieder in ihre ursprüngliche
Lage zurück. Anders dagegen beim Stahl oder auch schon beim gehärteten
Eisen. Wir wollen einmal das Stück von weichem Eisendraht, das, wie wir
vorhin gesehen haben, nur so lange magnetisch blieb, als es vom Strome
umflossen war, härten, indem wir es in glühendem Zustande in kaltes
Wasser tauchen, und dann den Versuch wiederholen. Nun verhält es sich,
wie vorhin die[S. 105] Stricknadel, es behält seinen Magnetismus; glühen wir
es wieder aus, so verliert es ihn wieder. Vollständig verliert dagegen
selbst das weichste Eisen den ihm einmal beigebrachten Magnetismus
nicht; der zurückbleibende Rest wird remanenter Magnetismus
genannt. Darüber werden wir im nächsten Vortrag noch ausführlicher
sprechen.
In dem nächsten Versuch erläuterte Rudi die Beziehung zwischen
Stromrichtung und Magnetpol. Er stellte einen Elektromagneten so
weit von der großen Magnetnadel auf, daß diese gerade noch deutlich
sichtbar abgelenkt wurde. In den Stromkreis der Drahtspule hatte er den
Kommutator eingeschaltet, mit dessen Hilfe er — nachdem er ihn zuvor
kurz beschrieben hatte — die Stromrichtung änderte. Dadurch wurde die
vorhin angezogene Nadelhälfte jetzt abgestoßen, und die andere strebte
nun dem Elektromagneten zu. Rudi wies darauf hin, daß die Bezeichnung
der Pole von der Stromrichtung abhinge und zeigte diese Tatsache auch
an dem Vertikalgalvanoskop, dessen Zeiger bei der einen Stromrichtung
nach rechts, bei der anderen nach links hin ausschlug. An dieser Stelle
erwähnte Rudi auch die Amperesche Schwimmerregel: Denkt man sich in dem
Draht der Magnetisierungsspirale in der Richtung des positiven Stromes
schwimmend, so daß man mit dem Gesicht dem Magnetstab zugewendet ist,
so muß dessen Nordpol zur linken Seite des Schwimmers entstehen.
Über einige praktische Anwendungen des Elektromagneten, wie elektrische
Klingel, Telegraph u. s. w. werden wir im nächsten Vortrage hören;
jetzt wollen wir noch die Wirkungsweise der einzelnen Meßinstrumente
genauer kennen lernen.
Die Wirkungsweise der Messinstrumente.
Das einfache Nadelgalvanoskop ist nichts anderes als eine flache
Drahtspule, durch welche, sobald sie ein Strom durchfließt, Kraftlinien
laufen, die die Magnetnadel in ihre Richtung zwingen. In der gleichen
Weise kommt die Wirkung des Vertikalgalvanoskopes zu stande.
Ebenso verhält sich der Multiplikator; nur daß wir hier eine durch
vier Umstände erhöhte Empfindlichkeit[S. 106] haben. Erstens ist die
Beeinflussung der Erde auf das Nadelpaar sehr herabgesetzt, da die
beiden ungleichnamig übereinanderliegenden Pole nach entgegengesetzten
Richtungen streben. Sie spielen trotzdem in die Nord-Südrichtung ein,
da der Magnetismus der oberen (längeren) Nadel etwas stärker ist.
Zweitens haben wir bei diesem Instrument zwei Drahtspulen,
also mehr Amperewindungen und damit mehr Kraftlinien. Drittens wirken
die Kraftlinien nicht nur innerhalb der Spule auf das Nadelpaar,
sondern auch außerhalb, und zwar auf beide Nadeln in gleicher Weise —
obgleich diese mit den ungleichnamigen Polen übereinanderliegen — da
die Kraftlinien außerhalb der Windungen in entgegengesetzter Richtung
laufen, wie die innerhalb der Windungen. Viertens bietet die Art der
Aufhängung am Kokonfaden der Drehung nur einen sehr geringen Widerstand.
Die Wirkungsweisen der beiden auf Seite 96 bis 99 beschriebenen
Instrumente ist dort schon hinreichend erklärt worden; wir wollen jetzt
nur noch hören, warum das Voltmeter, entgegengesetzt dem Amperemeter,
im Nebenschluß liegen muß. Doch bevor wir das verstehen können, müssen
wir die Spannungsverhältnisse an den verschiedenen Stellen eines vom
Strome durchflossenen Leiters kennen lernen.
Das Spannungsgefälle.
Zu dem Versuch, den wir dabei ausführen, müssen wir schon einen
praktischen Gebrauch von dem im Nebenschluß liegenden Voltmeter machen.
Wir verbinden die Pole eines Bunsenelementes mit einem etwa 1 m
langen, zum Kreise gebogenen Nickelindrahte von 0,5 mm Stärke.
Dann führen wir von den beiden Stellen des Drahtkreises, die den Polen
des Elementes am nächsten liegen, je einen Kupferdraht zu den Klemmen
unseres Voltmeters, das, wenn wir es für diesen Versuch verwenden
wollen, mindestens Zehntelvolt anzeigen muß. Ist unser Instrument nicht
so empfindlich, so müssen wir statt eines 5 bis 10 Elemente
hintereinandergeschaltet oder unser Vertikalgalvanoskop verwenden,
das freilich nur die relativen, nicht die absoluten Spannungsgrößen
angibt. Verwenden wir das Voltmeter, so müssen wir den auf der Rückwand
angebrachten[S. 107] Nebenschlußdraht ausschalten, da der Nickelindraht
nun seine Stelle vertritt. (Für die weiteren Betrachtungen nehmen
wir an, wir hätten das in Abb. 66 dargestellte Vertikalgalvanoskop
verwendet.) Nachdem wir also die genannte Verbindung hergestellt
haben, werden wir einen Ausschlag der Nadel nach rechts etwa bis zur
Ziffer 6 der Skala bekommen. Rücken wir nun die beiden Drahtenden,
die wir um den Nickelindraht herumgebogen haben, von den Polen des
Elementes weg und der Mitte des Drahtes zu, so wird der Ausschlag der
Nadel immer kleiner und kleiner, bis sie auf 0 zur Ruhe gekommen ist.
Jetzt werden die verschobenen Drahtenden noch 10 oder 20 cm
voneinander entfernt sein. Wir schalten, ohne im übrigen etwas zu
verändern, statt des Galvanoskopes unseren Multiplikator ein, der, da
er viel empfindlicher ist, jetzt noch kräftig ausschlägt. Wir schieben
nun die Drahtenden noch weiter zusammen, bis auch dieses Instrument
keinen Strom mehr anzeigt; sie werden dann nur noch wenige Zentimeter
voneinander entfernt sein.
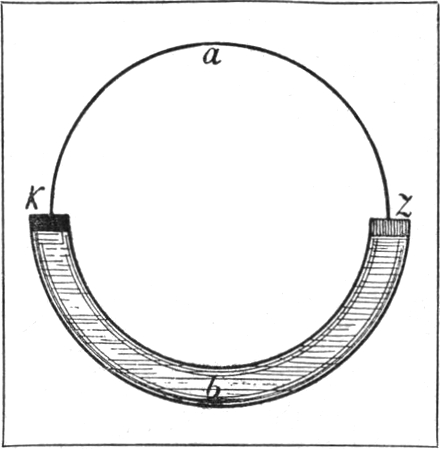
Abb. 84. Schematische Darstellung eines
Stromkreislaufes.
Diese Erscheinung erklärte Rudi an zwei Zeichnungen, die er in
großem Maßstabe ausgeführt hatte und die in den Abb. 84 und 85
dargestellt sind. Eine Glasröhre sei mit verdünnter Schwefelsäure
gefüllt und einerseits mit einer Kupferplatte K,
anderseits mit einer Zinkplatte Z verschlossen, so daß
sie ein Voltasches Element bildet; von Z nach K
führt ein Draht. Wir haben dann einen geschlossenen Stromkreis
K–a–Z–b–K. Bei K haben
wir ½ Volt positiver Spannung; wie wir vorhin gesehen haben, sinkt
diese, je weiter wir uns der Mitte (a) des Drahtes nähern,
bis sie hier auf dem Wert 0 angelangt ist. Gehen wir noch weiter, so
sinkt die positive Spannung noch mehr, das heißt sie geht in eine[S. 108]
negative Spannung über, bis sie bei Z den Wert −½ Volt erreicht
hat. Verfolgen wir nun die Potentiale auch in der Flüssigkeit, so
finden wir, daß bei Z ein plötzlicher Wechsel eintritt: von −½
Volt (der Zinkplatte) steigt die Spannung (der Flüssigkeit) auf +½
Volt, um von da ab wieder bis 0 (bei b) zu sinken, bis sie bei
K wieder den Wert −½ Volt erreicht hat. Den plötzlichen Wechsel
der Potentiale bei K und Z verursacht die elektrische
Scheidekraft, die Kraft, der wir das Entstehen der elektromotorischen
Kraft verdanken. In Abb. 85 sei KZ ein vom Strome
durchflossener Leiter. Bei K hat die Spannung den positiven
Wert KA, bei den Punkten a, b, c,
d sinkt sie ständig (die Längen der Linien aa₁,
bb₁, cc₁, dd₁ u. s. w.), bei
M ist sie gleich 0 und bei Z gleich dem negativen Wert
ZB.
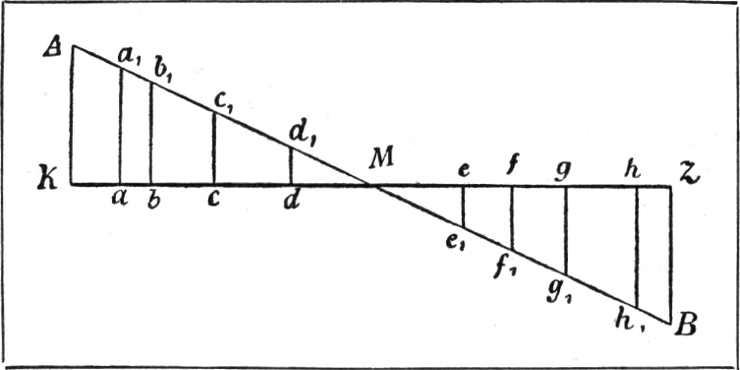
Abb. 85. Schema des Spannungsgefälles.
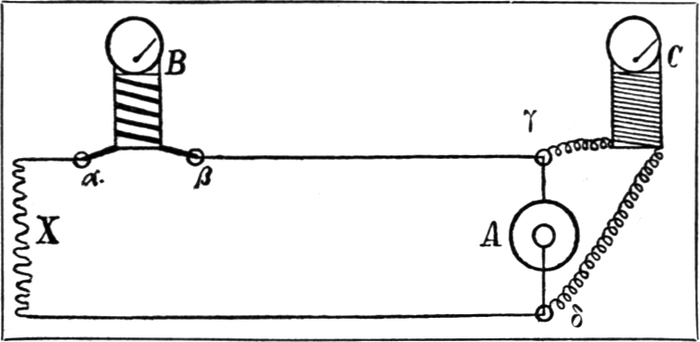
Abb. 86. Schaltungsschema für Volt- und Amperemeter.
Die Voltmeterschaltung.
Jetzt ist auch leicht zu verstehen, warum ein Voltmeter nicht
wie das Amperemeter in den Hauptstromkreis eingeschaltet werden
darf. Betrachten wir das Schema in Abb. 86: A ist eine
Stromquelle, X ein Leitungsnetz, B das in den
Hauptstrom eingeschaltete Amperemeter, das, um dem Strom möglichst
wenig Widerstand zu bieten, aus wenig Windungen eines dicken[S. 109]
Drahtes besteht. Weil der Widerstand des Instrumentes nahezu
gleich 0 ist, besteht auch zwischen den Klemmen α und β fast kein
Spannungsunterschied. Anders verhält sich dies bei den beiden Punkten
γ und δ, an welchen die Zuleitungsdrähte zum Voltmeter C
angeschlossen sind: Hier herrscht die Spannungsdifferenz, die die
elektromotorische Kraft der Stromquelle bei dem Widerstand des
Leitungsnetzes X hervorzurufen im stande ist. Das Voltmeter
besteht aus vielen Windungen eines dünnen Drahtes, damit es der
Hauptleitung nicht zu viel Strom entziehe; denn durch den großen
Widerstand des langen dünnen Drahtes fließt nur ein geringer Bruchteil
des Hauptstromes, dem nur der vielmal kleinere Widerstand X
entgegensteht. Fehlt ein natürlicher Hauptstromkreis bei einer
Stromquelle, deren Spannung gemessen werden soll, so muß er künstlich
hergestellt werden (vergleiche Seite 97).
Widerstandsbestimmung.
Wir haben jetzt gesehen, wie wir Stromstärken und Spannungen messen
können, und wollen nun noch eine einfache Art der Widerstandsbestimmung
kennen lernen.
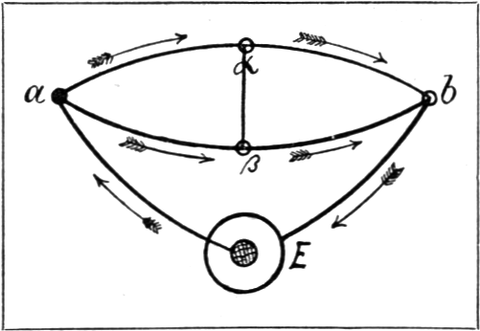
Abb. 87. Wheatstonesche Brücke.
Lassen wir einen elektrischen Strom durch zwei gleiche Drähte
fließen (a, α, b und a, β, b in Abb.
87) und verbinden zwei beliebige Stellen (α und β) dieser Leitungen
miteinander, so wird nur dann ein Strom durch diese Verbindung, die
auch Brücke genannt wird, fließen, wenn die Spannungen an den
beiden Anschlußstellen (α und β) verschieden sind, das heißt, wenn
an den Enden des Verbindungsstückes eine Potentialdifferenz besteht.
Ist diese nicht vorhanden, so kann in αβ auch kein Strom fließen.
Denken wir uns nun das Spannungsgefälle der beiden Drähte a,
α, b und a, β, b graphisch dargestellt, so
bekommen wir zweimal die Abb. 85. Markieren wir hier auf den beiden
Abbildungen zwei Punkte gleicher Spannungen, z. B. e, so ist
das Verhältnis[S. 110] Ke : eZ bei der einen
Abbildung gleich dem Verhältnis Ke : eZ
bei der anderen. Nehmen wir auch an, der Widerstand der beiden
Zweigdrähte sei verschieden, so gilt doch das Gleiche. In Abb. 88
sei I der Zweigdraht mit größerem, II der mit geringerem Widerstand;
die Spannung ist an den Enden beider gleich KA und
ZB, und nur die durch die Länge von KZ
ausgedrückten Widerstände sind verschieden. Zeichnen wir nun hier zwei
Punkte gleicher Spannungen ein, z. B. in I αx und in II
βx, so ist auch hier Kα : αZ
= Kβ : βZ. Das Gleiche gilt auch dann,
wenn wir annehmen, daß einer der Zweigdrähte aus zwei Teilen mit
verschiedenen Widerständen bestehe.
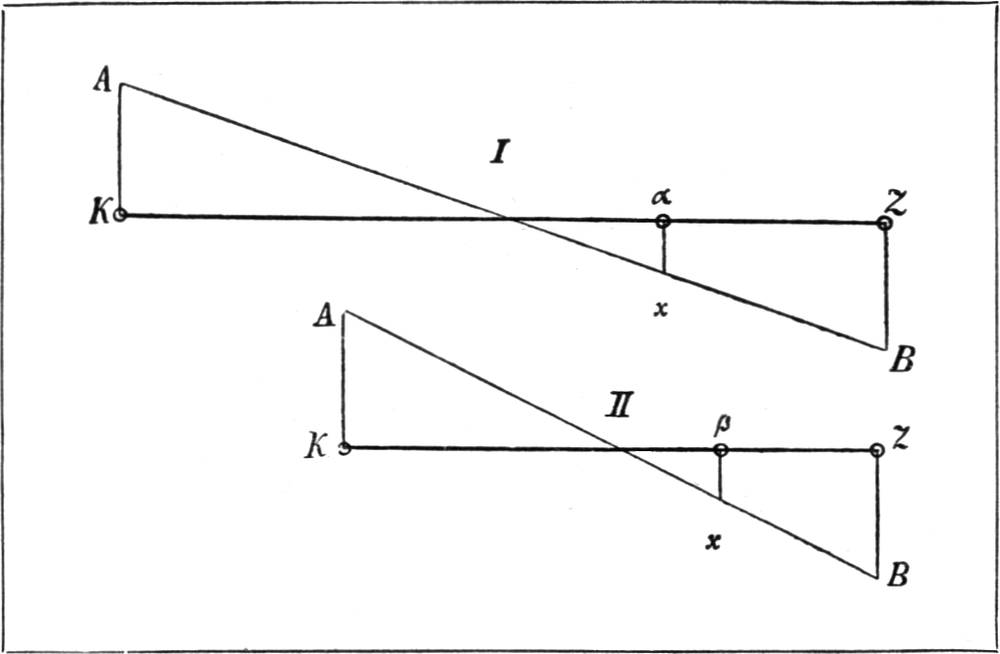
Abb. 88. Spannungsgefälle in zwei verschiedenen
Widerständen.
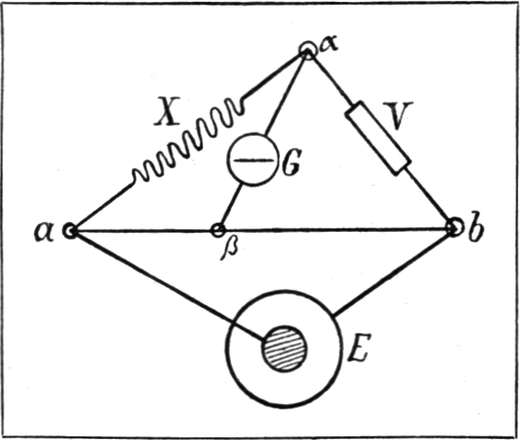
Abb. 89. Wheatstonesche Brücke.
Wir spannen nun einen homogenen, an allen Stellen gleichstarken
Draht gerade aus, wie ab in Abb. 89, und betrachten
ihn als einen Zweig unserer Doppelleitung, die vom Element E
gespeist[S. 111] wird; den anderen Zweig stellen wir zusammen aus einem
unbekannten Widerstande X und einem bekannten V
(Vergleichswiderstand). In die Brücke αβ schalten wir unseren
Multiplikator G. Wenn es nicht der Zufall gerade gewollt hat,
so ist jetzt die Spannung bei α nicht gleich der bei β, weshalb uns
der Multiplikator einen Strom anzeigen wird. Verschieben wir nun das
Drahtende bei β nach rechts oder links, so werden wir leicht die Stelle
finden, die mit α auf gleicher Spannung ist, was wir daran erkennen,
daß der Multiplikator keinen Strom mehr anzeigt. Daß der ausgespannte
Draht ab dem Nickelindraht (a) unserer Meßbrücke
(Seite 100) und das Drahtende β dem Schieber (c) gleichkommt,
braucht nicht näher erwähnt zu werden. Da auf unserer Meßbrücke
ein Maßstab angebracht ist, so können wir leicht das Verhältnis
aβ : βb ablesen; wir wissen aber auch, daß
dies gleich aα : αb ist. Nehmen wir an,
daß der Schieber unserer Brücke, die in 100 Teile (Zentimeter) geteilt
ist, bei 75 steht, ferner daß unser bekannter Widerstand 10 Ohm habe,
so können wir folgende Proportion aufstellen: 75 : 25 = X : 10;
daraus ergibt sich X = 30 Ohm.
Wollen wir genaue Messungen machen, so müssen wir zu den Verbindungen
der einzelnen Apparate möglichst kurze und dicke Drähte verwenden,
damit wir ihre Widerstände vernachlässigen können, ohne dabei einen
merkbaren Fehler zu begehen.
Will man Widerstände bei Anwendung von Wechselströmen (siehe vierter
Vortrag) messen, so können zur Bestimmung der Stromlosigkeit der
Brücke unsere bisher gebrauchten Apparate nicht verwendet werden. Man
bedient sich in diesem Falle des Telephons (siehe Anhang). Wird dieses
von einem Wechselstrom durchflossen, so gerät durch den Wechsel der
Magnetpole die Membrane in Schwingung und gibt einen Ton von sich;
ist es tonlos, so ist es auch stromlos. Hat man kein Telephon zur
Verfügung, so genügt es, einen einfachen kleinen Elektromagneten mit
möglichst vielen Windungen eines dünnen Drahtes in einem Kästchen
einer Membran gegenüber zu bringen, wie das auch bei dem im Anhang
beschriebenen Telephon gemacht ist.

Abb. 90. Rudi hält seinen dritten Vortrag.

D
en dritten Vortrag bestimmte Rudi wieder für solche Hörer, bei denen
er keinerlei Vorkenntnisse, außer solchen, die sie sich in seinem
ersten Vortrag erworben hatten, vorauszusetzen brauchte. Er sprach
deshalb auch hier nochmals, aber kürzer, über die Entdeckung
des galvanischen Stromes und die Beschaffenheit eines
Elementes sowie über die Zusammenstellung mehrerer Elemente zu
einer Batterie. Dann ging er dazu über, an der Hand der bereits
bekannten Experimente den Einfluß des galvanischen Stromes auf
den Magneten zu zeigen und die Beschaffenheit und Wirkung eines
Elektromagneten zu[S. 113] erklären. Dann kam er auf die Beschreibung
der elektrischen Klingel, des Telegraphen und der
Elektromotoren zu sprechen. Um auch das Wesen der Dynamomaschine
erklären zu können, sprach er eingehender über Magnetinduktion
und Induktionsströme, beschrieb die magnetelektrische
Maschine und führte schließlich die Dynamomaschine vor. Die
verschiedenen Ankerkonstruktionen, wie T-, Ring- und
Trommelanker, berührte er nur kurz. Damit hatte er hinreichend
über die Erzeugung des galvanischen Stromes gesprochen und erklärte
nun die elektrische Straßenbahn, die Bogenlampe,
das Glühlicht, elektrisch betriebene Ventilatoren, Heiz-
und Kochapparate u. s. w. Dann ging er zur Beschreibung des
Akkumulators über und sprach noch kurz über Spannungen,
Leitungsnetze, Sicherungen und Kurzschluß, um
mit einer an seine Ausführungen über Induktionsströme anschließenden
Beschreibung des Telephons den Vortrag zu schließen.
Auf dem Bild Seite 112 sehen wir Rudi, wie er nach dieser Disposition
unter Käthes Assistenz die Herstellung der dabei benutzten Apparate und
die mit ihnen ausgeführten Experimente beschreibt.
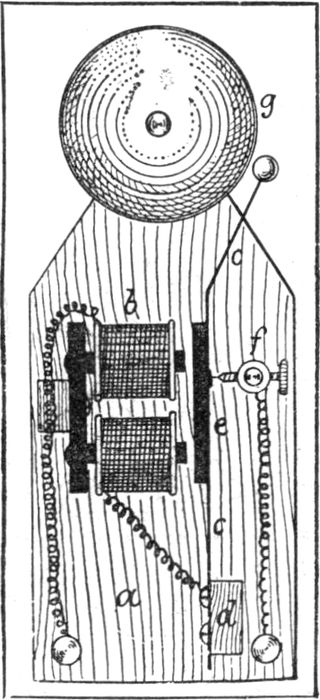
Abb. 91. Die elektrische Klingel.
Die elektrische Klingel.
Eine elektrische Klingel ist sehr einfach herzustellen. Abb. 91 zeigt
uns eine solche im Grundriß. a ist ein Grundbrett von beliebigem
Holz; b ist ein Elektromagnet, den Abb. 92 im Schnitt zeigt:
a ist ein Stück Bandeisen, in das die beiden Magnetschenkel
b₁ und b₂ eingenietet sind. c, c
sind die Drahtspulen. Die Rähmchen für diese drehen wir aus Holz oder
kleben sie aus Karton zusammen. Das Bewickeln von Drahtspulen haben wir
im zweiten Vortrag Seite 93 behandelt. Für eine Drahtrolle verwenden
wir je nach Größe 12 bis 20 m eines 0,4 bis 0,6 mm
starken Kupferdrahtes (für geringere Ansprüche[S. 114] genügen auch 8 bis
10 m eines etwas stärkeren Drahtes). Die Endflächen der
Magnetpole werden mit Papierscheibchen beklebt, weil sonst der Anker
infolge des remanenten Magnetismus ab und zu haften bleiben könnte.
c (Abb. 91) ist ein federnder Blechstreifen, den wir aus
einer alten Uhrfeder oder aus Messingblech herstellen, das wir durch
kräftiges Hämmern auf dem Ambos elastisch machen, daran wird e,
der Eisenanker (ein Stück Bandeisen), angenietet oder angelötet.
Die Magnetkerne und der Anker müssen gut durchgeglüht werden.
d ist ein Holzklotz, an dem das eine Ende der Feder c
befestigt ist, das andere Ende wird mit einem Messinghämmerchen oder
einer Messingkugel versehen; etwa in der Mitte wird ein Stückchen
Platinblech aufgelötet, dem gegenüber die Kontaktspitze f auf
einer kleinen Messingsäule ruht. Es ist gut, wenn man f mit
einem Muttergewinde versieht, durch das eine Schraube eingedreht
werden kann; an dieser lötet man vorn ein kurzes Stückchen Platindraht
auf, das die Kontaktspitze bildet. Am Ende des Brettchens a
wird die Glockenschale g angebracht. Wie die einzelnen Teile
untereinander in leitende Verbindung zu setzen sind, geht aus der
Abbildung hervor. Über dem ganzen kann eine Schutzhülle aus Holz oder
Pappe angebracht werden; die Glocke selbst muß natürlich frei bleiben.
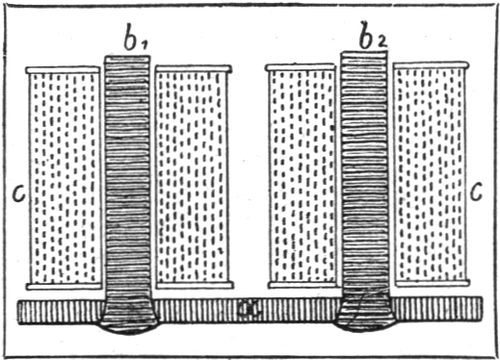
Abb. 92. Elektromagnetkern mit Spulen (Schnitt).
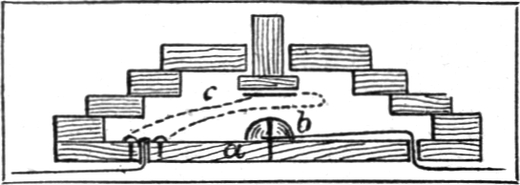
Abb. 93. Schnitt durch den Kontaktknopf.
Der Kontaktknopf.
Wir können uns auch ohne Drehbank recht hübsche Kontaktknöpfe
herstellen: Auf ein rundes Grundbrettchen a (Abb. 93) wird in
der Mitte ein Nagel mit einem breiten Messingkopf b (Reißnagel)
eingeschlagen. Aus gehämmertem Messingblech[S. 115] schneiden wir einen
spiralförmigen Streifen (Abb. 94), den wir so mit dem breiteren
Ende neben b anschrauben, daß das etwas in die Höhe gebogene
schmälere genau über b zu stehen kommt. Die Kapsel stellen wir
uns durch Übereinanderleimen von 3 bis 4 Ringen aus Zigarrenkistenholz
her. (Siehe Abb. 93.)
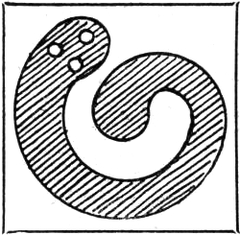
Abb. 94. Feder für den Kontaktknopf.
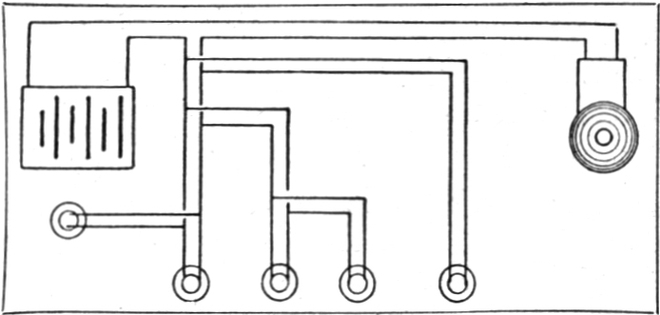
Abb. 95. Schaltungsschema einer Klingelanlage.
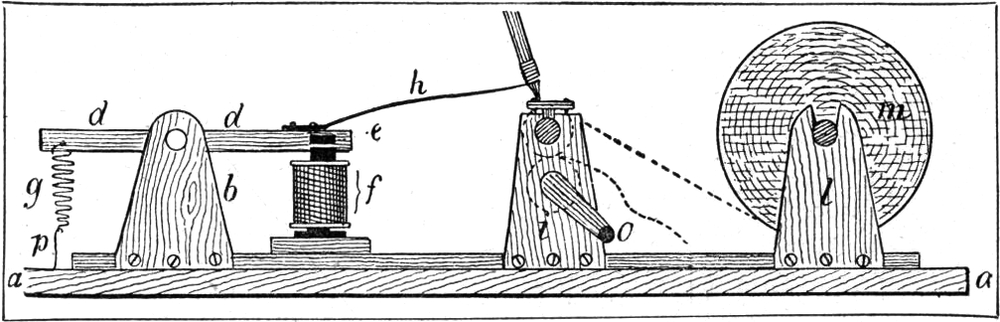
Abb. 96. Der Morseschreiber (Seitenansicht).
Zur Erklärung der Schaltungsweise der elektrischen Hausklingel stellte
Rudi eine Tafel auf, deren Zeichnung Abb. 95 zeigt.
Der Morsesche Telegraph.
Der Morsesche Telegraphenapparat ist nicht so schwer herzustellen,
wie es vielleicht manchem scheinen möchte. Die ganze Konstruktion
ist aus den beiden Abb. 96 (Seitenansicht) und 97 (Grundriß) zu
erkennen. a ist das Grundbrett; b₁ und b₂
sind die Achsenträger für die Achse (c) des gleicharmigen
Hebels d, der aus einem Holzstäbchen mit quadratischem
Querschnitte herzustellen ist. Für c nehmen wir ein Messing-
oder Eisenstäbchen, eventuell einen starken Nagel. Die Achse soll
im Hebel fest sitzen, sich in ihren Lagern in b₁ und
b₂ aber leicht drehen lassen. In das eine Ende des Hebels
wird[S. 116] der Anker, der mindestens 4 mm dick und 1 cm
breit sein soll, eingelassen; das andere Ende wird mit einer Drahtöse
versehen, in welche die Spiralfeder g eingehängt werden kann;
letztere wird aus 0,6 bis 0,7 mm starkem Messingfederdraht durch
Aufwickeln auf ein bleistiftstarkes Metallstäbchen hergestellt. Die
Spannung regulieren wir erst später durch Verlängern oder Verkürzen
des Aufhängehakens p. Statt der Spirale kann auch einfach eine
Gummischnur verwendet werden.
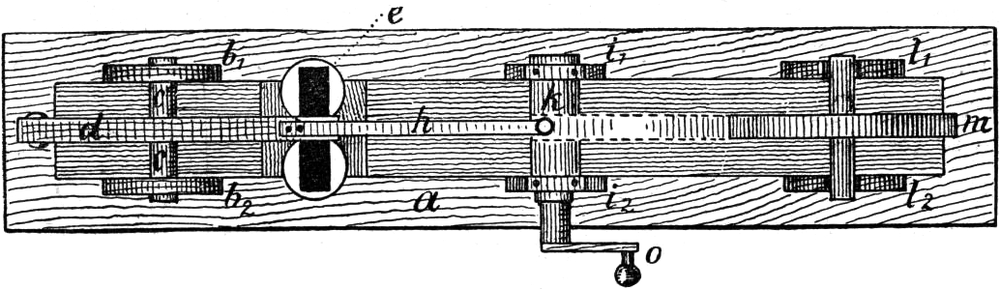
Abb. 97. Der Morseschreiber (Aufsicht).
Der zweispulige Elektromagnet f wird ebenso hergestellt wie der
der elektrischen Klingel; er muß aber etwas größer und stärker sein.
Auf dem Hebel d wird an dem Ankerende ein etwa 1 cm
breiter Blechstreifen aus gehämmertem, 0,5 bis 0,7 mm starkem
Messingblech angebracht. Dieser Streifen soll nahezu so lang sein wie
der Hebel selbst. Das vorderste Ende (1 cm) wird rechtwinkelig
aufgebogen und ein kurzes Stückchen Messingrohr mit etwa 5 mm
lichter Weite, in das wir später einen weichen Bleistift stecken, wird
daselbst festgelötet. In den Lagerträgern i₁ und i₂
sind, wie dies in Abb. 98 zu sehen ist, zwei gedrehte Holzwalzen
(k₁ und k₂) eingelassen, die 1,5 bis 2 cm
dick sind. Der eine Lagerfortsatz der Walze k₂ muß etwas
länger sein, damit wir eine Kurbel an ihm befestigen können.
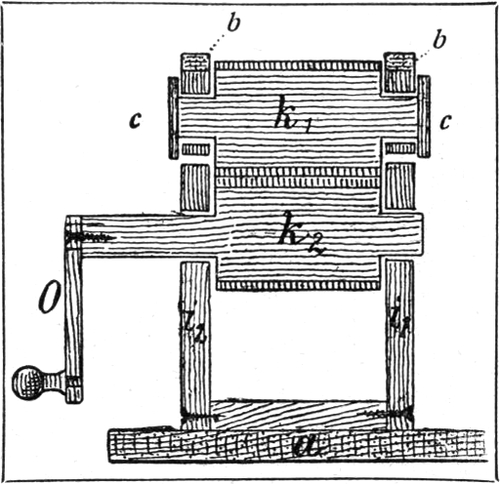
Abb. 98. Rollen zur Bewegung des Papierstreifens
(Schnitt).
[S. 117]
Da beide Walzen stets fest aufeinanderliegen müssen, so sind die Lager
von k₁ so einzurichten, daß sie vermittels zweier Schrauben
niedergedrückt werden können, wie dies aus Abb. 99 zu ersehen ist: Aus
dem oberen Ende des Lagerträgers i wird ein rechteckiges Stück
(a), das die Bohrung für die Rollenachse enthält, herausgesägt
und der dadurch entstandene rechteckige Einschnitt noch etwas vertieft.
Damit a nicht nach außen herausfallen kann, werden die Enden der
Rollenachsen, nachdem die Stückchen a darübergeschoben sind, mit
kleinen Scheibchen (c, Abb. 98) beklebt. Durch Aufschrauben des
Leistchens b (Abb. 98 und 99) wird a niedergedrückt, und
dadurch werden die beiden Rollen, die wir noch je mit einem Stückchen
Gummischlauch überziehen, aufeinandergepreßt. Die Lagerträger i
sind so auf a anzuschrauben, daß k₁ gerade unter das
Messingröhrchen, das wir am Ende von h angelötet haben, zu
liegen kommt. Die beiden Träger l₁, l₂ haben oben
offene Einschnitte, so daß wir den runden Holzstab, auf den wir die
Papierstreifenrolle aufschieben, bequem einsetzen können. Nun führen
wir noch die beiden Drahtenden des Elektromagneten zu zwei Klemmen an
einem Ende des Brettchens a.
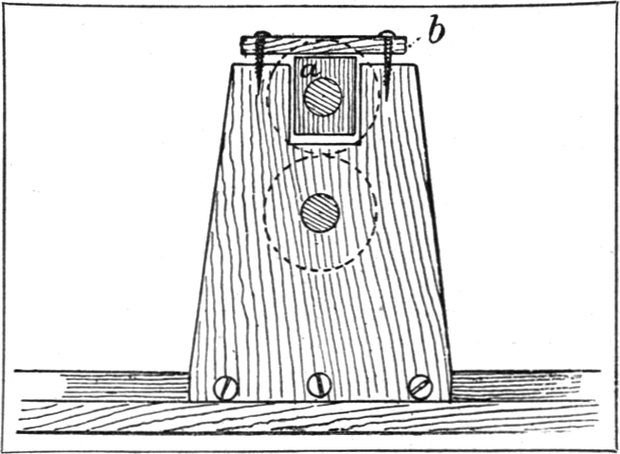
Abb. 99. Rollen zur Bewegung des Papierstreifens
(Seitenansicht).
Wer etwa eine alte Wanduhr, die ihren Zweck als solche nicht mehr
erfüllt, besitzt, kann diese zum maschinellen Antrieb für die Rollen
k benutzen. Alles für diesen Zweck Unnötige wird von der Uhr
entfernt; also Zifferblatt, Zeiger, auch die Zahnradübersetzung 1 : 12
für den Stundenzeiger; ferner wird Pendel, Anker und Ankerrädchen
herausgenommen. Das Rädchen, das zum Antrieb für das Ankerrädchen
gedient hat, wird durch Anlöten zweier Blechplättchen mit Windflügeln
versehen. Die Hauptachse, auf[S. 118] der der Minutenzeiger saß, wird mit
der Rolle k₂ verbunden. Die Uhr selbst wird auch auf dem
Grundbrette befestigt. In dem Werke bringen wir einen Hebel so
verstellbar an, daß er das Flügelrädchen entweder freigibt oder
festhält. Sollte nun die Geschwindigkeit, die die Uhr den Rollen
erteilt, zu groß sein, so können wir, falls der Antrieb mit einem
Gewicht erfolgt, dieses verkleinern. Bei Federantrieb geht das nicht;
wir müssen deshalb das Ankerrädchen wieder einsetzen und an dieses
die Flügel anlöten; durch Verbiegen der letzteren können wir die
Geschwindigkeit noch weiter regeln. War die Geschwindigkeit zu gering,
so müssen wir eben noch ein weiteres Übersetzungsrädchen herausnehmen.
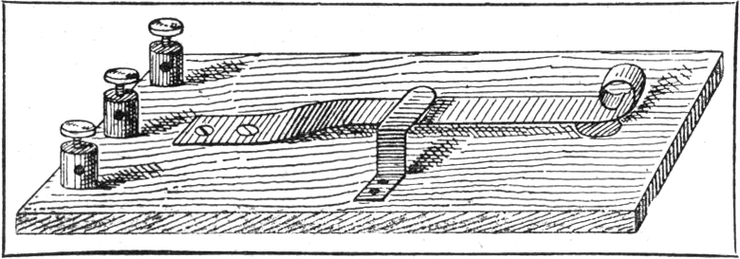
Abb. 100. Morsetaster.
Wir brauchen nun noch den Taster, der in Abb. 100 dargestellt ist. Er
besteht aus einem Grundbrett und einem 1 cm breiten und etwa
7 cm langen Streifen aus federndem Messingblech, ist an einem
Ende auf dem Grundbrett aufgeschraubt und am anderen, wie die Abbildung
zeigt, umgebogen. Unter dem umgebogenen Ende ist ein Nagel mit einem
Messingkopf angebracht. Dieser ist mit der einen, die Feder mit der
zweiten Klemme in leitender Verbindung; mit der dritten Klemme ist ein
Blechstreifen leitend verbunden, der über die Feder reicht und diese,
wenn sie nicht niedergedrückt wird, berührt. Es ist gut, wenn die
Verbindungsdrähte nicht nur eingeklemmt, sondern festgelötet werden.
Um den telegraphischen Verkehr zwischen zwei Stationen zu erläutern,
hatte Rudi sich zwei Apparate gemacht, die er an den beiden Tischenden
aufstellte und mit Batterie und Klingel so schaltete, wie die Abb.
101 zeigt. Hier sind die Apparate der beiden Stationen (I und II)
folgendermaßen bezeichnet: M = Morseapparat, T = Taster,
B =[S. 119] Batterie (3 bis 4 Leclanché-Elemente), g = Glocke
und U = Umschalter. Letzterer ist ähnlich konstruiert wie der
Kommutator (siehe Seite 101); er erlaubt mit einem Handgriff entweder
die Glocke, oder den Morseapparat einzuschalten.
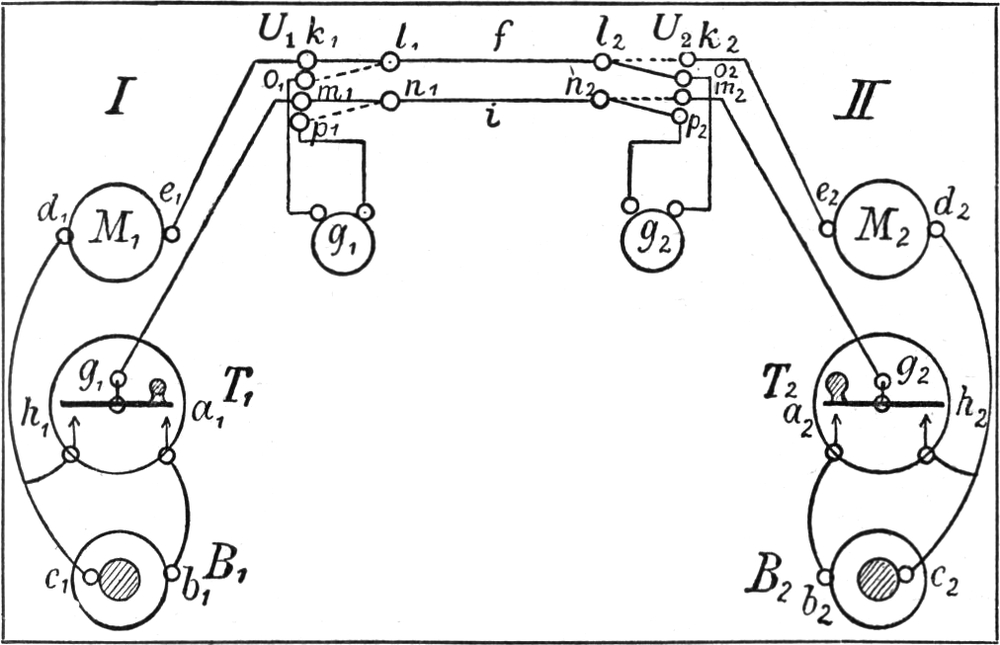
Abb. 101. Schaltungsschema der Morseapparate.
Angenommen, man will von Station I nach Station II telegraphieren, so
hat man folgendes zu tun: Der Umschalter ist so zu stellen, daß der
Morseapparat statt der Glocke eingeschaltet ist; dann wird der Taster
niedergedrückt, wodurch die Glocke bei II ertönt. Dabei macht der
Strom folgenden Weg: in T₁ wird der Kontakt a₁
geschlossen; von da geht der Strom nach B₁, b₁,
c₁, d₁, M₁, e₁, k₁,
l₁, f, l₂, und da hier U₂ noch
auf die Glocke geschaltet ist, nach o₂, durch g₂
hindurch nach p₂, n₂, i, n₁,
m₁, g₁ und a₁. Durch das Glockenzeichen
aufmerksam gemacht, wird nun auf II der Umschalter von g₂
auf den Morseapparat umgeschaltet und zum Zeichen, daß dies geschehen,
der Taster ein paarmal niedergedrückt; dies bemerkt man in I an dem
Aufschlagen des Ankers auf den Elektromagneten. In II wird nun der
Papierstreifen in Bewegung gesetzt und in I der Taster. Drücken wir
diesen längere Zeit nieder, etwa 1 Sekunde, so wird in II ebensolang
der Anker angezogen und dadurch der Bleistift[S. 120] auf das über die Rollen
gleitende Papier gedrückt, wodurch ein Strich aufgezeichnet wird.
Drückt man dagegen den Taster nur ganz kurz nieder, so wird dadurch nur
ein Punkt entstehen. Aus verschiedenen Zusammenstellungen von Punkten
und Strichen hat man ein Alphabet festgesetzt, das hier wiedergegeben
werden soll.
Die Zeichen für die Buchstaben sind:
b – . . .
l . – . .
u . . –
c – . – .
m – –
ü . . – –
f . . – .
ö – – – .
x – . . –
g – – .
p . – – .
y – . – –
h . . . .
q – – . –
z – – . .
Die Zeichen für die Zahlen sind:
1 . – – – –
4 . . . . –
8 – – – . .
2 . . – – –
5 . . . . .
9 – – – – .
3 . . . – –
6 – . . . .
0 – – – – –
Weitere Zeichen sind noch für:
Punkt . . . . .
Komma . – . – . –
Fragezeichen . . – – . .
Ausrufzeichen – – . . – –
Nachdem Rudi seiner Schwester auf diese Weise ein Telegramm über
den Tisch hinüber gesandt und Käthe es übersetzt hatte, erwähnte er
noch, daß man in der Praxis die eine der beiden Leitungen nicht legt,
sondern den Strom durch die Erde leitet. Auch erklärte er, daß man
mit dieser einfachen Einrichtung nicht auf sehr große Entfernungen
telegraphieren könnte, da in dem großen Widerstand des langen Drahtes
der Strom so sehr geschwächt würde, daß er nicht mehr im stande wäre,
einen Morseapparat in Tätigkeit zu setzen. Man bediene sich deshalb der
sogenannten Relais. Rudi beschrieb nur die Einrichtung[S. 121] und Schaltung
des Relais, da er sich keines hergestellt hatte. Er mußte es jedoch
später für die drahtlose Telegraphie anfertigen, und es sei deshalb
schon hier beschrieben.
Das Relais.
Abb. 102 zeigt das Relais im Grundriß. Im wesentlichen ist es
konstruiert wie die elektrische Glocke; nur fehlt die Glockenschale,
und die Kontaktspitze befindet sich auf der Seite des Ankers, auf
der auch der Elektromagnet ist. Der Anker steht höchstens 0,5
mm von den Magnetpolen entfernt, und die Feder darf nicht sehr
stark sein; ihre Spannung kann mit der Stellschraube e reguliert
werden. Man darf nicht vergessen, die Polenden mit Papier zu bekleben.
Die Kontaktspitze ist so zu stellen, daß sie etwa 0,5 mm von
der ihr gegenüberliegenden Verlängerung der Feder absteht. Für normale
Ansprüche genügt hier die gleiche Bewickelung, wie bei der Klingel.
Nehmen wir mehr und etwas dünneren Draht, so wird das Instrument
empfindlicher.
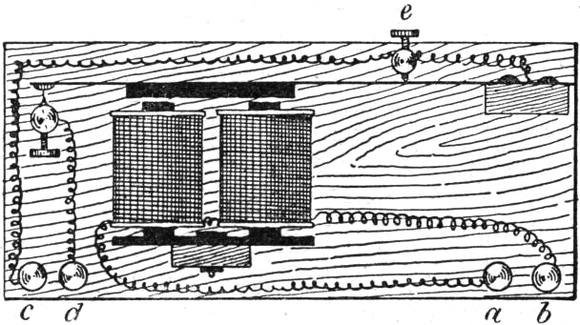
Abb. 102. Relais im Grundriß.
Zum Gebrauche werden die Fernleitungen an die beiden Klemmen a
und b angeschlossen; die Klemme c wird mit der einen
Klemme des Morseapparates, d mit dem einen Pol der Batterie
und die andere Klemme des Apparats mit dem anderen Pole der Batterie
verbunden. Kommt nun durch die Ferndrähte von der anderen Station
ein Strom, so wird er, auch wenn er sehr schwach ist, den Anker des
empfindlichen Relais anziehen; dadurch wird aber der lokale, durch den
Morseapparat gehende Batteriestrom geschlossen und der Schreibstift auf
den Papierstreifen niedergedrückt. Hört der Fernstrom auf, so geht der
Anker des Relais zurück und unterbricht damit auch den lokalen Strom
u. s. w.
Der Elektromotor.
Eine weitere, in der Praxis ungeheuer wichtig gewordene elektrische
Maschine ist der Elektromotor.
Alle die Konstruktionen, nach denen man sich gute Elektromotoren[S. 122]
selbst anfertigen kann, hier zu beschreiben, würde zu weit führen. Es
seien deshalb nur die Haupttypen erwähnt.
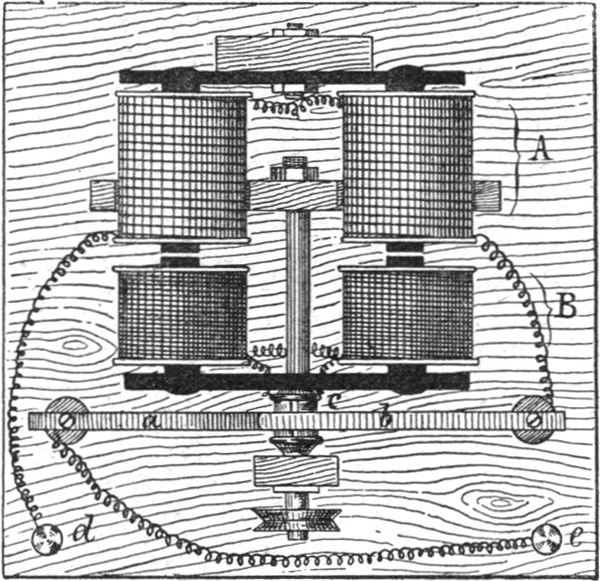
Abb. 103. Elektromotor im Grundriß.
a) Mit zweipoligem Hufeisenanker. Der einfachste
Motor besteht aus zwei einander mit den Polen gegenüberstehenden
Elektromagneten, von denen der eine fest (Feldmagnet),
der andere drehbar ist (Anker). Die Anordnung geht aus
Abb. 103 hervor. A ist der feste, B der bewegliche
Magnet; beide sind im wesentlichen ebenso hergestellt wie die der
elektrischen Klingel, nur müssen hier die beiden Magnetschenkel
weiter auseinanderstehen, da zwischen ihnen die Achse und deren
Lagerträger Platz finden müssen. Das Verbindungsstück des drehbaren
Magneten ist in der Mitte mit einer Bohrung versehen zur Aufnahme der
Achse, die angelötet werden kann. Die Lager werden so hergestellt,
wie es schon früher (siehe Seite 22 u. f.) beschrieben wurde, und
müssen auch hier gleich eingeölt werden. Bei c wird die Achse
mit einer Feile etwas aufgerauht und auf eine Strecke von 1 bis 2
cm in 2 oder 3 Lagen mit Bindfaden umwunden. Dabei ist darauf
zu achten, daß alle Windungen regelmäßig nebeneinander liegen. Der
dadurch entstandene Wulst ist reichlich mit Schellacklösung (siehe
Seite 20) zu bestreichen. Er muß so dick sein, daß wir gerade noch
ein etwa 1,5 cm langes Stückchen Messingrohr darüberschieben
können. Letzteres wird in zwei Halbzylinder zersägt und so auf dem
Wulste befestigt, daß die beiden Hälften einander nicht berühren. Ihre
Befestigung erfolgt dadurch, daß wir sie nahe den äußeren Rändern
mehrmals mit einem starken Seidenfaden umwinden (siehe auch Seite 143,
Abb. 121).[S. 123] Diesen Teil der Maschine nennt man den Kollektor,
obgleich die Bezeichnung hier nicht ganz richtig ist; besser wäre
es, diesen Teil Kommutator zu nennen; denn er bewirkt, daß die
Stromrichtung im Anker im geeigneten Moment geändert wird. Der Ausdruck
Kollektor ist von den Ring- und Trommelankermaschinen übernommen. —
Die Enden der Ankerbewickelung sind an den beiden Halbröhrchen, deren
Stellung zu den Magnetpolen aus Abb. 104 zu erkennen ist, anzulöten.
Der Strom wird dem Anker durch zwei auf dem Kollektor schleifende
Federn aus Kupferblech (a und b) zugeführt. Wie die
einzelnen Drähte zu verbinden sind, geht aus Abb. 103 hervor. Der Strom
tritt bei d ein, geht durch die beiden Spulen des Feldmagneten
zur oberen Schleiffeder (b), durch die Ankerwickelung zur
unteren Schleiffeder (a) und durch e zur Stromquelle
zurück.
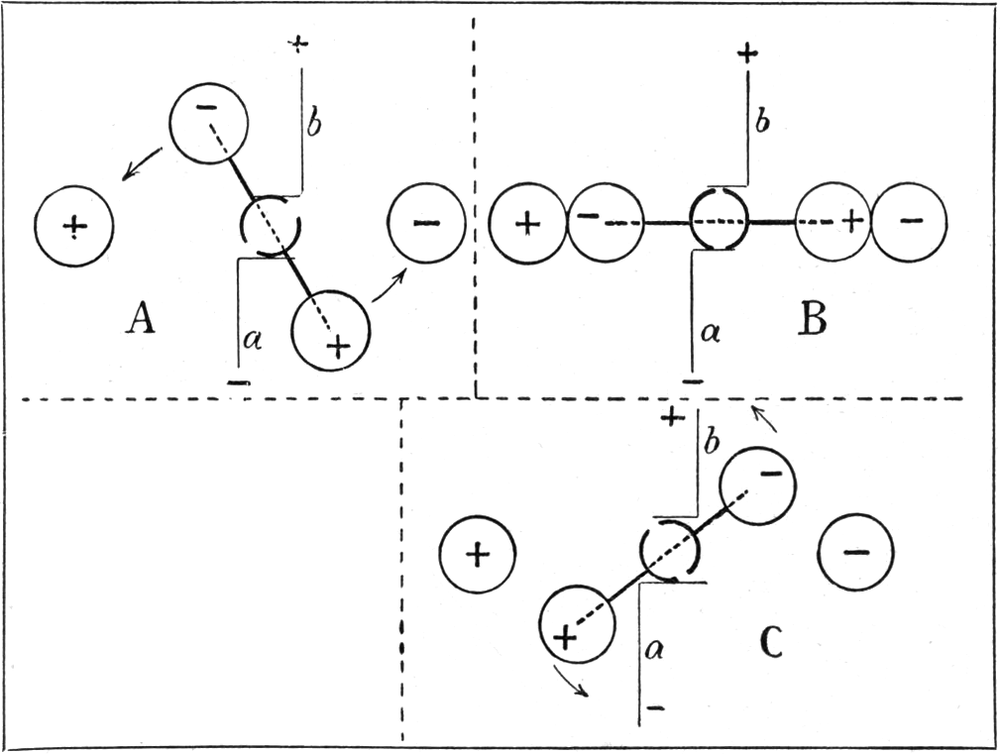
Abb. 104. Wirkungsschema des Elektromotors.
Betrachten wir nun die drei schematischen Bilder der Abb. 104. In
A geht der Strom so durch den Draht, daß die Pole die vermerkten
Vorzeichen erhalten. Die Folge davon ist, daß die Ankerpole von denen
des Feldmagneten angezogen werden, bis sie die in B angedeutete[S. 124]
Stellung erreicht haben. Hier wird nun die Stromrichtung in der
Ankerwickelung gewechselt, da der zur unteren Schleiffeder eintretende
Strom jetzt durch die andere Kollektorhälfte in die Ankerwindungen
eintritt; dadurch werden die einander gegenüberstehenden Pole
gleichnamig magnetisch und stoßen einander ab, wodurch die Stellung
C erreicht wird u. s. w.
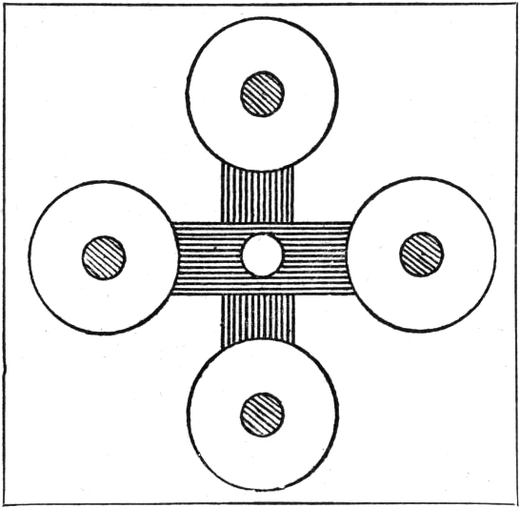
Abb. 105. Vierpoliger Hufeisenanker.
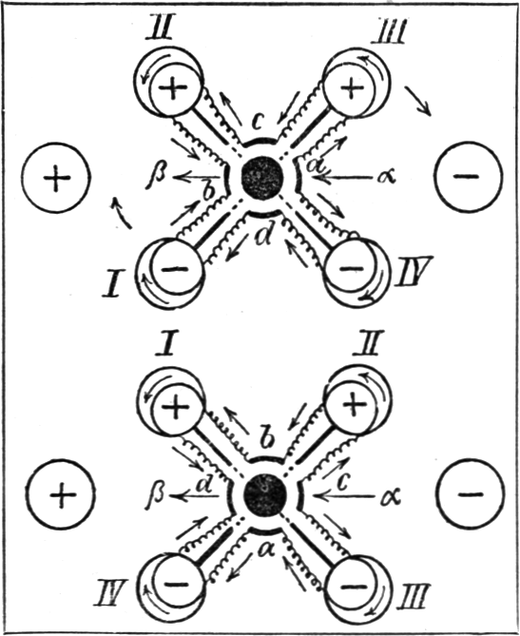
Abb. 106. Verlauf des Stromes beim vierpoligen Anker.
b) Mit vierpoligem Hufeisenanker. Wollen wir die Wirkung
dieses Motors verstärken, so können wir statt eines zweipoligen einen
vierpoligen Anker verwenden, wie ihn Abb. 105 zeigt. Dementsprechend
ist auch der Kollektor vierteilig zu machen, und es sind die Drahtenden
der einzelnen Spulen so mit den vier Kollektorlamellen zu verbinden,
wie das Abb. 106 zeigt. Hier sind die beiden Schleiffedern, das heißt
die Stellen, an denen der Strom ein- und austritt, mit den Pfeilen
α und β bezeichnet. Wie dann der Strom die Magnetpole umkreist, ist
durch kleine Pfeile angedeutet. Wir können uns neben der Ampereschen
Schwimmerregel zur Bestimmung der Magnetpole noch eine andere,
etwas einfachere Regel merken. Sehen wir auf die Polfläche eines
Elektromagneten und lassen den Strom gegen die Richtung der
Uhrzeigerbewegung, also links herum kreisen, so[S. 125] wird der Pol
ein Nordpol; geht dagegen der Strom in gleicher Drehungsrichtung
wie der Uhrzeiger, also rechts herum, so wird der Pol ein Südpol.
Wir können noch weiter gehen und auch den Feldmagnet vierpolig machen.
Dann müssen aber die einander gegenüberstehenden Pole des Ankers
jeweils gleichnamig magnetisch sein und ebenso die Pole des
Feldmagneten. Die Stromumkehr im Anker muß immer dann erfolgen, wenn
Anker und Feldmagnetpole einander gegenüberstehen.
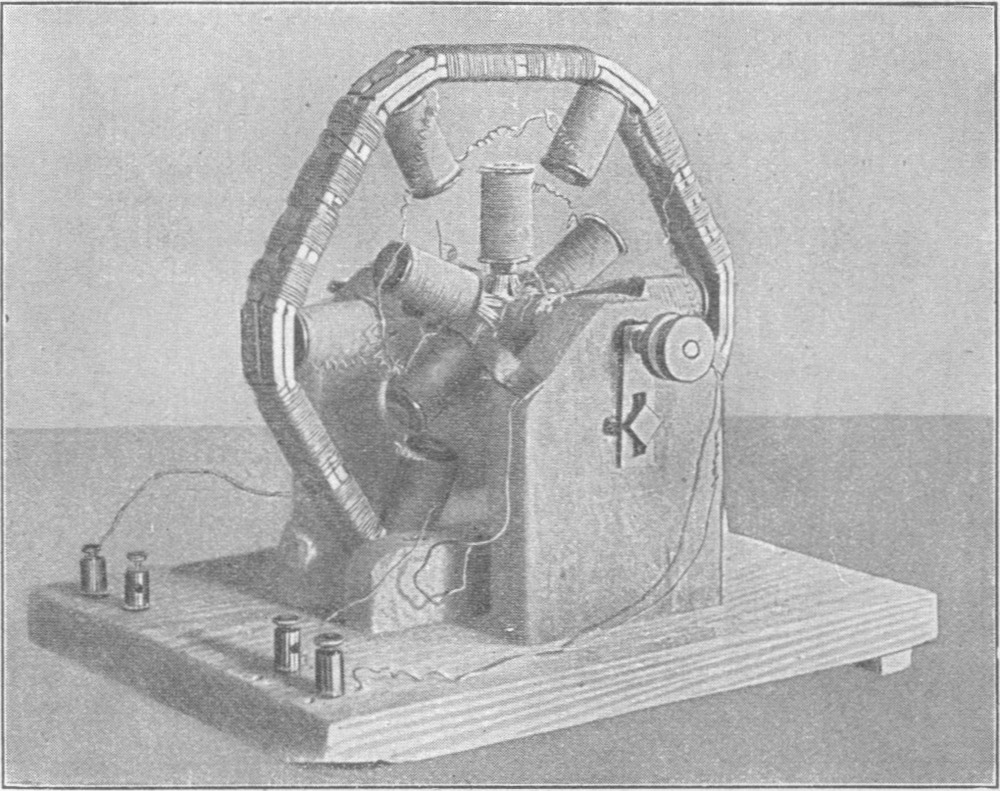
Abb. 107. Sechspoliger Elektromotor.
c) Mit sternförmigem sechspoligem Anker. Abb. 107 zeigt
eine sechspolige Maschine, bei der aber Feldmagnete und Anker etwas
anders angeordnet sind als bei der oben beschriebenen Maschine. Diese
nach einer photographischen Aufnahme wiedergegebene Maschine kann sich
jeder mit sehr geringen Hilfsmitteln anfertigen. Der Anker besteht aus
einem sechsteiligen Stern, der aus geglühtem Eisendraht zusammengesetzt
ist. Jeder Teil dieses Sternes besteht aus einem Drahtbündel, das fest
mit[S. 126] dünnem Bindfaden zu umwinden ist. Durch die Mitte geht eine als
Achse dienende Messingstange, die mit den Drähten verlötet ist. Damit
die Polenden des Ankers alle gleichweit von der Mitte entfernt seien
— und das ist sehr wichtig —, wurden die einzelnen Drähte zuerst
etwas länger genommen und die umwundenen Bündel dann an der richtigen
Stelle abgesägt; denn feilen lassen sich die Enden solcher Drahtbündel
nicht gut. Die einzelnen Schenkel des Feldmagneten sind gleichfalls
aus Drahtstücken hergestellt, die in ein aus vier Bandeisenstreifen
hergestelltes und mit Draht umwundenes Sechseck eingeklemmt sind. In
die vier Eisenbänder wurden an den sechs Stellen der Magnetschenkel
halbrunde Ausschnitte eingefeilt, in welche die runden Drahtbündel
eingeklemmt werden konnten, ohne ihre Form zu verlieren. Die Maschine
ist für zweiphasigen Wechselstrom von 120 Volt gebaut, kann aber
auch für Gleichstrom verwendet werden und dient zum Antrieb für eine
Influenzelektrisiermaschine von 50 cm Scheibendurchmesser.
Der Abstand zweier Sechseckseiten beträgt 20 cm. Werden die
Magnetenden noch mit Polschuhen versehen (siehe unten), so wird die
Wirkung erhöht.
d) Mit Doppel-T-Anker. Die Motoren mit dem
Doppel-T-Anker sind zwar in ihrer Konstruktion sehr einfach,
haben aber den Nachteil, daß wir uns den Anker, wie den Feldmagnet
nicht selbst herstellen können. Wir kommen auf diese Ankerform bei
der magnetelektrischen Maschine (Seite 138 u. f.) nochmals zurück und
gehen darum hier nicht näher darauf ein. Bei all den hier beschriebenen
Maschinen sind die Lager für die Achsen nach der auf Seite 22 u. f.
angegebenen Weise anzufertigen und sofort zu ölen.
e) Mit Ringanker. Rudi erklärte in diesem Vortrag
auch den Grammeschen Ring ziemlich ausführlich. Er hatte sich einen
Ringankermotor gebaut, der ihn allerdings sehr viel Zeit und Arbeit
kostete, wobei er sich aber durch manchen Mißerfolg nicht abschrecken
ließ.
Es möge hier die Herstellung einer solchen Ringmaschine beschrieben
werden; doch es sei vorher erwähnt, daß nur sauberste und sorgfältigste
Arbeit einen guten Erfolg verbürgt.
Zuerst wollen wir jedoch das Wesen des Grammeschen[S. 127] Ringes kennen
lernen, das Rudi mit einem einfachen Experiment seinen Hörern klar
machte. Er umwickelte zwei halbkreisförmig gebogene kleine Eisenstangen
nach der in Abb. 108 angegebenen Weise in wenig Windungen mit je
einem isolierten Kupferdrahte, durch den er dann in einer bestimmten
Richtung den Strom schickte und die dabei entstehenden Magnetpole
durch die Ablenkung der Magnetnadel erkennen ließ. Als er nun die
beiden Halbkreise so mit den gleichnamigen Polen zusammenhielt, daß
ein geschlossener Kreis entstand, wirkte der Ring wie ein einziger,
zweipoliger Magnet.
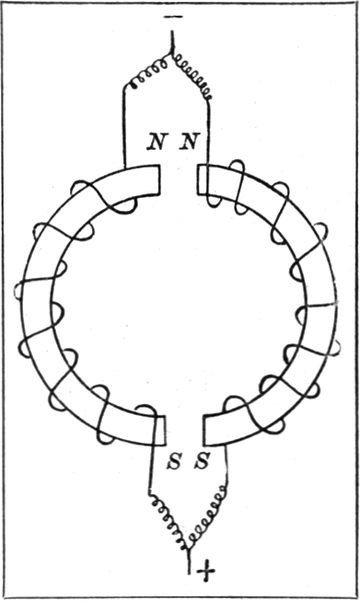
Abb. 108. Entstehung der Pole im Grammeschen Ring.
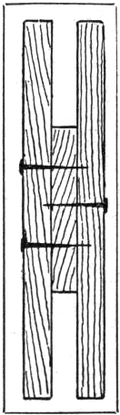
Abb. 109. Form f. d. Grammeschen Ring.
So einfach die Herstellung dieses Modells des Grammeschen Ringes ist,
soviel Mühe und Sorgfalt erfordert der richtige Ringanker.
Der Kern des Ankers, der die Form eines flachen Ringes erhält, wird aus
0,5 mm starkem gut durchgeglühtem Eisendraht hergestellt, indem
wir den Draht auf eine entsprechende Form aufwinden. Den Schnitt durch
diese Form zeigt Abb. 109. Ein rundes Brettchen, dessen Durchmesser
gleich dem der Öffnung des Ringes ist, wird beiderseits mit zwei
größeren Brettchen begrenzt, so daß eine Rinne entsteht, in die der
Draht hineingewickelt wird. (Die Größenverhältnisse der einzelnen Teile
kann man der Abb. 114 entnehmen.) Zwischen die einzelnen Lagen wird
reichlich eine dicke Schellacklösung gegossen, die nach dem Trocknen
den Draht zusammenhält, so daß die runden Brettchen entfernt werden
können.
Der Ring wird nun mit zwölf kleinen Drahtspulen umgeben, wie wir
aus Abb. 110 ersehen können. Um diese Spulen möglichst regelmäßig
anbringen zu können, bezeichnen wir die betreffenden Stellen durch
Papierstreifchen,[S. 128] die wir mit Schellack aufkleben. Jede Spule erhält
drei bis vier Lagen eines gut isolierten Kupferdrahtes. Über die
Drahtstärken wird weiter unten (Seite 134) noch ausführlich gesprochen
werden. Kommt mit Baumwolle umsponnener Draht zur Verwendung, so ist
dieser während des Aufwickelns mit Schellacklösung zu bestreichen.
Bei doppelt mit Seide umsponnenem Draht ist das nicht nötig, es trägt
jedoch zur größeren Festigkeit der Spulen bei. Die Drahtenden werden
von ihrer Isolierung befreit, und jeweils wird der Anfang des Drahtes
der einen Spule mit dem Ende des Drahtes der nächsten zusammengedreht.
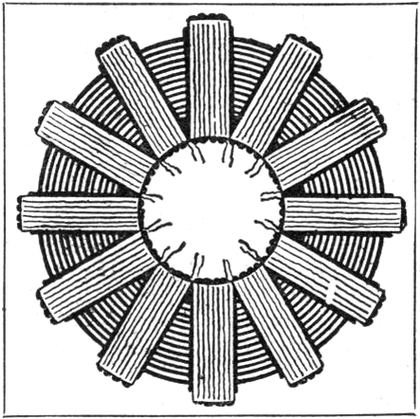
Abb. 110. Der mit 12 Spulen bewickelte Grammesche Ring.
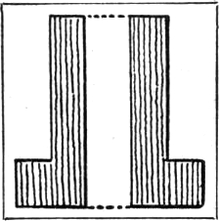
Abb. 111. Holzkern für den Grammeschen Ring (Schnitt).
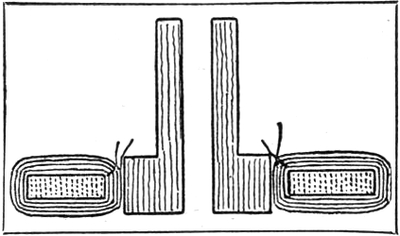
Abb. 112. Schnitt durch Holzkern und Ring.
Um den Anker bequem auf eine Achse montieren zu können, lassen wir uns
einen Holzkern drehen, den Abb. 111 im Durchschnitt zeigt. Der dickere
Teil soll gerade in den bewickelten Ring hineinpassen und der dünnere
einen Durchmesser von mindestens 1,5 cm haben. Abb. 112 zeigt
diesen Kern nochmals im Schnitt mit dem darübergeschobenen Ring, der
an seiner Stelle genau senkrecht zu der Richtung der Längsbohrung fest
sitzen muß. Um den Ring möglichst fest mit dem Holze zu verbinden,
bestreichen wir beide Teile vor dem Zusammenfügen mit Schellackkitt
(siehe Seite 5).
Der dünnere Teil des Holzkerns wird nun in zwölf gleiche Teile
eingeteilt; auf den Teilstrichen sollen Kupferblechstreifen
befestigt werden, die, wie Abb. 113 zeigt, alle an ihrem hinteren
Ende umgebogen sind und an dem dickeren Teil des Kernes anliegen.
Die Streifen (Kollektorlamellen) sollen so breit sein, daß
die Zwischenräume[S. 129] zwischen den einzelnen nur etwa 1 mm
betragen. Um die Lamellen sicher und regelmäßig befestigen zu können,
verfahren wir folgendermaßen: Wir bestreichen den Kern mit sehr dicker
Schellacklösung und drücken die heißgemachten Blechstreifen auf,
wenn der Schellack fast getrocknet ist. Die Streifen müssen sofort
genau an ihre richtige Stelle gebracht werden, da sie nachträglich
nicht mehr verschoben werden können. Um zu verhindern, daß sie beim
Gange der Maschine durch die Zentrifugalkraft abgeschleudert werden,
müssen wir sie nahe dem vorderen und hinteren Ende mit in Schellack
getränktem Bindfaden umwinden (siehe auch Abb. 114). Nun werden die an
dem dickeren Teil des Holzkernes anliegenden Enden der Kupferstreifen
gereinigt und mit den zusammengedrehten Drahtenden der Spulen verlötet.
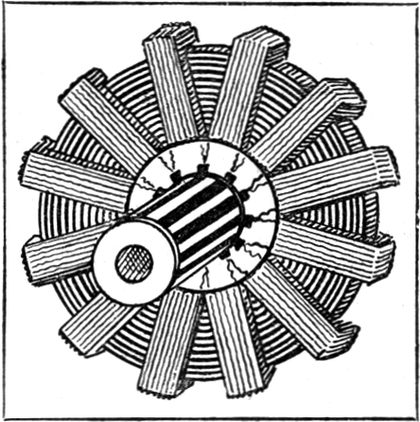
Abb. 113. Ringanker mit Kollektor.
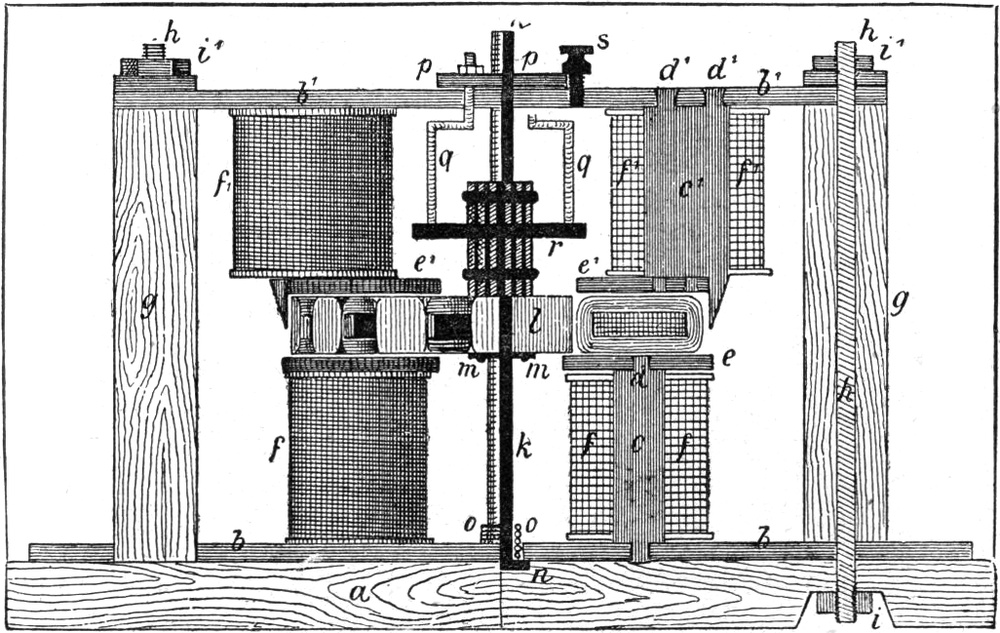
Abb. 114. Fertiger Motor (links Ansicht, rechts
Schnitt).
Die übrigen Teile der Maschine sind alle aus Abb. 114 und 115 zu
erkennen. Die linke Hälfte der Abb. 114[S. 130] ist als Ansicht von
vorne, die rechte als Horizontalschnitt gezeichnet; nur der Kollektor
und das Schleiffedergestell sind nicht geteilt, sondern ganz als
Ansicht gezeichnet.
Zur Erzeugung eines kräftigen magnetischen Feldes, in welchem sich der
Anker drehen soll, dienen zwei starke Elektromagnete. Für geringere
Ansprüche genügt auch einer; es ist dann nur der untere in Abb. 114
auszuführen.
Der untere Magnet wird ähnlich hergestellt, wie der, den wir auf Seite
113 kennen gelernt haben. In ein ziemlich langes Stück Bandeisen
b (Abb. 114) wird in die Mitte ein Loch gebohrt, das später das
Lager für die Achse aufnehmen soll. In einem Abstand von der Mitte,
der sich aus der Figur ergibt, sind zwei starke Stücke Rundeisen
c einzunieten, die die Magnetschenkel bilden. Die Nietfortsätze
(d) sind durch Befeilen oder auf der Drehbank herzustellen.
Wer im Besitze eines Gewindeschneideapparates ist, tut am besten,
alle in der Figur als vernietet gezeichneten Teile zu verschrauben.
Um den Ring auf einer möglichst großen Fläche zu umfassen, werden die
Pole mit sogenannten Polschuhen (e) versehen. Die Form eines
Polschuhes ist aus Abb. 116, sein Größenverhältnis zum Anker an Abb.
115 (e¹) zu erkennen (e¹ sind zwar die Polschuhe
des oberen Magneten; diese aber haben genau dieselbe Form wie die
des unteren). Bevor wir die Polschuhe aufnieten, müssen die fertig
gewickelten Drahtspulen (f) über die Kerne geschoben werden.
(Über Drahtstärken siehe unten.)
Die beiden Schenkel des oberen Magneten sind etwas anders geformt.
Damit die Gestelle der Schleiffedern Platz und Spielraum haben, sitzen
die Kerne, die hier flach sind, weiter außen. b¹ ist ein Stück
Bandeisen von derselben Stärke wie b. Es enthält in der Mitte
ebenfalls eine Bohrung zur Aufnahme des Lagers, ferner zwei Löcher
für die beiden Nietzapfen (d¹) des flachen Kernes c¹;
dieser erhält auf seiner Außenseite einen kurzen Fortsatz (in der Figur
etwas zu lang gezeichnet), der nach unten zeigt und dem Anker, wie dies
aus der Figur zu ersehen ist, möglichst nahe steht. Die übrigen Löcher
in b¹ werden jetzt auch gleich eingebohrt, doch soll erst
später ihre Lage und Weite mitgeteilt werden. Diese Teile können wir
auch in[S. 131] Abb. 115 erkennen. Die einzelnen Stücke sind da mit denselben
Buchstaben bezeichnet wie in Abb. 114. Die linke Hälfte der Abbildung
ist als von oben gesehen gezeichnet; die rechte ist so gedacht, als
wäre die Maschine in Höhe der Kollektormitte durchschnitten und
ebenfalls von oben gesehen. Entsprechend dem flachen Querschnitt der
Kerne c¹ sind auch die Drahtspulen f¹ flach, genau über
den Kern passend herzustellen. Die Polschuhe e¹ werden wie
bei dem unteren Magneten erst dann aufgenietet, wenn die bewickelten
Spulen über die Kerne geschoben sind. Da c¹ weiter von der
Mitte entfernt ist als c, so muß e¹ so an c¹
angenietet werden, daß die Abstände von e, e und
e¹, e¹ gleich sind; denn die Polschuhe sollen nachher
beim Montieren der Maschine genau übereinander liegen.
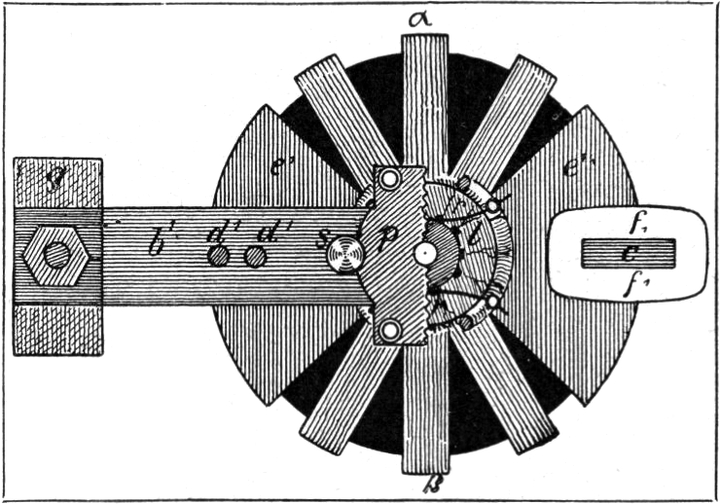
Abb. 115. Motor von oben gesehen (rechts Schnitt).
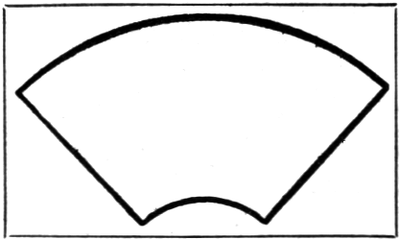
Abb. 116. Gestalt eines Polschuhes.
Jetzt richten wir uns ein starkes Grundbrett (a) aus hartem
Holze her, ferner zwei starke rechteckige Holzsäulen (g), die
ihrer ganzen Länge nach zu durchbohren sind. Die Höhe der beiden
Säulen muß folgender Summe genau gleich sein: der Entfernung
der unteren Seite von b bis zur oberen Fläche von e plus
1 mm plus der Dicke des bewickelten Ankers plus 1 mm
plus der Entfernung der unteren Fläche von e¹ bis zur unteren
Seite von b¹. Durch die Längsbohrung von g und durch
entsprechend einzubohrende Löcher in b, b¹ und a
wird eine an ihren Enden[S. 132] mit Gewinden versehene Messingstange
(h) gesteckt, und durch Aufschrauben der Muttern i und
i¹ werden die einzelnen Teile fest zusammen gezogen. Es ist
vorteilhaft, für die Mutter i in dem Grundbrett eine Versenkung
einzubohren. Auf der Unterseite von g ist ein Einschnitt
einzusägen, in den der Bandeisenstreifen b genau hineinpaßt,
so daß die Säule nicht auf b sondern auf a aufsteht;
natürlich darf der Einschnitt nur so groß sein, daß auch b noch
genügend fest gehalten wird.
Für die Achse (k) des Ankers wählen wir eine je nach der Größe
der Maschine 5 bis 10 mm starke Messingstange. Nach ihrer
Dicke muß sich die Weite der Bohrung durch den Holzkern (l)
des Ankers richten. Letzterer wird dadurch an der Achse befestigt,
daß wir ihn an einem an dieser angelöteten Messingblechscheibchen
(m) anschrauben. Das untere Ende der Achse ist ein wenig
abzurunden und zuerst mit gröberer, dann mit feinerer und schließlich
mit allerfeinster Schmirgelleinwand abzureiben. Unter der mittleren
Bohrung von b ist ein starkes Glasplättchen (n) in
a einzulassen; es dient der Achse als Auflager. Die beiden
Lager (o) in b wie in b¹ werden auf die bekannte
Weise mit Kupferdraht hergestellt und in den betreffenden Bohrungen
eingelötet (siehe Seite 22 u. f.). Die Lager sind sofort
einzuölen.
Sind nun die einzelnen Teile in der angegebenen Weise montiert, so muß
sich der Anker ohne zu streifen zwischen den Polschuhen, von denen er
höchstens 1 mm Abstand haben darf, drehen lassen.
Es wären nun noch die Schleiffedern anzubringen. Sie sollen so den
Kollektor berühren, daß die Magnetpole an den Punkten α und β (Abb.
115) entstehen. Wie aus dem Schema Abb. 108 erhellt, entstehen die
Pole da, wo der Strom ein- und austritt. Die Verbindungslinie der
Berührungspunkte müßte also senkrecht stehen zu der Verbindungslinie
der Mitten der Magnetkerne. In Wirklichkeit aber ist die günstige Lage
der Berührungspunkte etwas im Sinne der Ankerdrehung verschoben. Da
wir diese Lage nur durch Probieren herausfinden können, müssen wir die
Schleiffedern an einem drehbaren Gestelle anbringen.[S. 133] Die günstige
Stellung können wir daran erkennen, daß beim Gang der Maschine die auf
dem Kollektor auftretenden Funken kleiner sind, als bei jeder anderen
Lage. Eine Platte aus dünnem Holz (Ahorn) oder besser aus Vulkanfiber
oder Hartgummi, deren Form aus Abb. 115 p — p zeigt
nur die eine Hälfte — hervorgeht, ist in der Mitte durchbohrt und
wird so auf b aufgelegt, daß die Achse durch diese Bohrung
hindurchgeht. In jeder Ecke dieser Platte wird ein in Abb. 114 mit
q bezeichneter 2 bis 3 mm starker Kupferdraht befestigt.
An je zweien auf der gleichen Seite sich befindenden Drähten wird ein
federnder Kupferstreifen r angelötet. r ist so zu biegen
und die zweimal rechtwinkelig umgebogenen Drähte q sind so zu
stellen, daß die Schleiffeder unter gelindem Druck auf dem Kollektor
aufliegt. Hart neben p ist ein Loch in b¹ einzubohren
und mit einem Gewinde zu versehen, in das die Metallschraube s
(mit breitem Kopf) hineinpaßt. Indem wir nun p während des
Ganges der Maschine um die Achse drehen, können wir, wie bereits
erwähnt, die günstigste Berührungsstelle für die Schleiffedern
ausfindig machen und sie in dieser Lage durch Anziehen der Schraube
s fixieren.
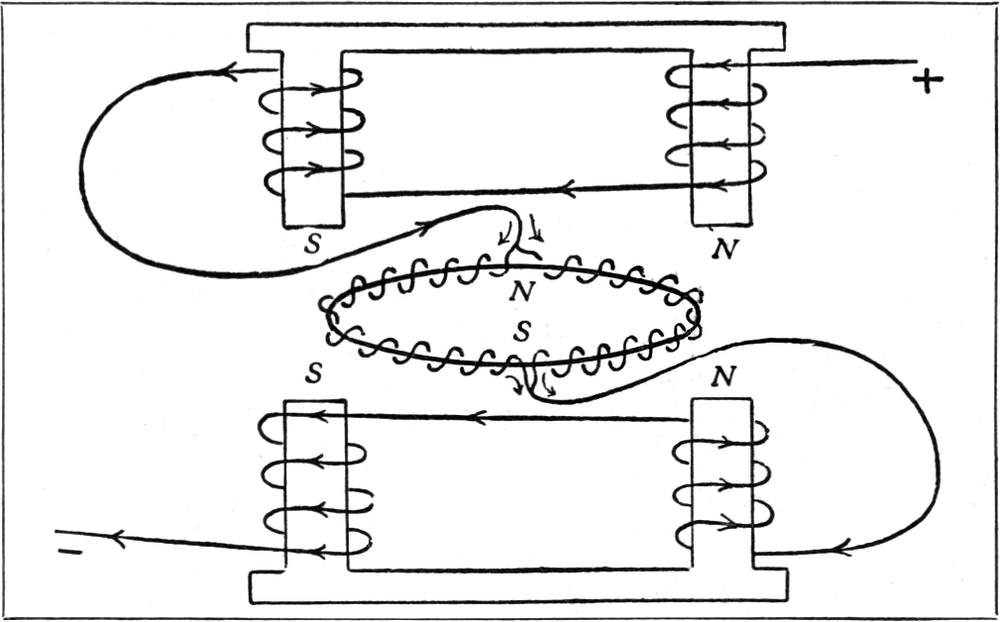
Abb. 117. Bewickelungsschema.
Wie die Spulen zu bewickeln und untereinander zu verbinden sind, geht
aus dem Schema Abb. 117 hervor.
[S. 134]
Bestimmung der Drahtstärken.
Jetzt wollen wir noch sehen, wie wir die Stärken und Längen der Drähte
für unsere Bewickelungen bestimmen können. Man beachte folgende Punkte:
1. Der Widerstand der Bewickelung des Feldmagneten soll stets etwas
größer sein als der der Ankerwickelung (Feldmagnet = 35, Anker = 25). Der
Widerstand eines Drahtes ist proportional seiner Länge und umgekehrt
proportional seinem Querschnitte. Der Querschnitt q berechnet
sich aus dem Durchmesser des Drahtes nach der Formel: q = π ·
(d2)², worin π = 3,14 ist. (Man benutze auch die Tabellen am
Schlusse des Buches.)
2. Der Widerstand in einem Ringanker ist gleich ¼ des Widerstandes im
ganzen Ankerdraht, da dem Strom zwei Wege, die nur halb so lang sind
als die genannte Ankerwickelung, offenstehen.
3. Bauen wir einen Motor mit Rücksichtnahme auf eine bestimmte
Stromquelle, so kann er um so größer ausgeführt werden, je mehr
elektrische Energie uns zur Verfügung steht. Die Energie eines Stromes
wird in Watt gemessen und ist gleich dem Produkt aus Spannung und
Stromstärke. 1 Watt gleich 1 Volt mal 1 Ampere (siehe auch zweiter
Vortrag S. 84 u. f.). Haben wir bei gegebener Energie verhältnismäßig
hohe Spannung und geringe Stromstärke, so ist es nach dem Ohmschen
Gesetze (S. 86 u. f.) vorteilhafter, längere und dünnere Drähte für
die Bewickelung zu verwenden, als wenn wir eine geringe Spannung und
eine große Stromstärke haben. Um einen Anhaltspunkt für die absoluten
Maße zu geben, sei folgendes gesagt. Ist der Feldmagnet eines Motors
an Größe dem Magnet einer mittelgroßen elektrischen Klingel gleich
und steht uns eine Batterie von etwa 3 bis 6 Leclanché-Elementen zur
Verfügung, so mag die Bewickelung des Feldmagneten gleich der der
betreffenden elektrischen Klingel sein, also für jede Spule etwa 20
m eines 0,5 mm starken Kupferdrahtes.
4. Schalten wir die Magnet- und Ankerwickelung hintereinander[S. 135]
(Hauptstrommaschine), das heißt so, daß der Strom zuerst
die Magnetschenkel umkreist, dann durch den Ankerdraht fließt und
schließlich wieder zur Stromquelle zurückkehrt (siehe auch Abb. 125),
so ist der Gesamtwiderstand der Maschine größer, als wenn wir die
beiden Wickelungen nebeneinander (Nebenschlußmaschine) schalten,
also so, daß sich der Strom beim Eintritt in den Motor teilt und
einerseits um den Feldmagnet, anderseits um den Anker fließt, um beim
Austritt aus der Maschine sich wieder zu vereinigen und zur Stromquelle
zurückzukehren (Abb. 126). Wollen wir einen Motor von vornherein als
Nebenschlußmaschine bauen, so ist der Widerstand der Ankerdrähte
eben so groß oder etwas kleiner zu wählen, als der der Drähte des
Feldmagneten. Näheres über die Unterschiede dieser Schaltungsweisen ist
bei der Beschreibung der Dynamomaschine ausgeführt (S. 148).
5. Um aus den hier gegebenen Anhaltspunkten die Drahtmaße für eine
der hier beschriebenen Maschinen berechnen zu können, vergleichen wir
zuerst den für den Motor zur Verfügung stehenden Strom mit dem, den
die unter 3. erwähnten 3 bis 6 Leclanché-Elemente liefern. Den inneren
Widerstand des oben erwähnten Motors berechnen wir mit Hilfe der
Widerstandstabelle (im Anhang) und erhalten für die Bewickelung des
Ankers 3,2 Ohm, dies sind 2⁄5 des gesamten Widerstandes: es kommen auf
den Feldmagneten 3⁄5, also 4,8 Ohm, so daß wir im ganzen einen Widerstand
von 8 Ohm erhalten. Haben wir einen Strom, der die doppelte Anzahl von
Watt liefert wie die 3 bis 6 Elemente, so sind die Dimensionen des
Motors etwa 1,5mal so groß auszuführen; der gesamte Widerstand (8 Ohm)
hat aber gleich zu bleiben für den Fall, daß auch das Verhältnis von
Spannung zu Stromstärke gleichgeblieben ist. Wollen wir dagegen den
Motor für einen Strom bauen, der zwar dieselbe Energie besitzt wie die
Leclanchébatterie, aber bei geringerer Stromstärke eine höhere Spannung
hat, so ist der Gesamtwiderstand der Maschine dadurch größer zu
machen, daß man mehr Windungen macht, also längeren und dünneren Draht
verwendet.
6. Sind wir nun über die Dimensionen und die Drahtwiderstände der
herzustellenden Maschine im klaren, so[S. 136] schätzen wir mit Hilfe der
Widerstandstabelle Länge und Stärke des Drahtes, der auf eine Spule
kommen soll, ungefähr ab. Um erkennen zu können, ob der Draht die
gegebene Spule auch ausfüllt oder auf ihr hinreichend Platz findet,
müssen wir den inneren Spulendurchmesser (also die Kerndicke) zu
dem äußeren Spulendurchmesser addieren — die Maße sind immer in
Millimetern auszudrücken — die Summe mit 2 dividieren und das Resultat
mit π (π = 317) multiplizieren. Wir erhalten dadurch die mittlere Länge
einer Windung. Um die Zahl der Windungen festzustellen, müssen wir die
Dicke des Drahtes mit der Isolierung kennen.
Nehmen wir zum Beispiel an, der Kerndurchmesser sei 1 cm, der
äußere Spulendurchmesser 3 cm, die Spulenlänge 5 cm, der
Widerstand des Drahtes 1 bis 1,5 Ohm und die Drahtdicke hätten wir auf
0,5 mm, mit der Isolierung also auf 0,7 mm, geschätzt. Wir
wollen nun die erforderliche Länge und den Widerstand berechnen.
Spulendurchmesser = 30 mm,
Kerndurchmesser = 10 mm,
somit mittlere Länge einer Windung
10 + 302 · π =
20 · 227 = 62,9 mm,
rund 6,3 cm.
Wieviel Windungen haben auf der 50 mm langen Spule eines mit der
Isolierung 0,7 mm starken Drahtes Platz?
50 : 0,7 = 71,4 Windungen.
Wieviel Lagen gehen auf die Spule, wenn ihr Halbmesser 15 mm,
der Halbmesser des Kernes 5 mm beträgt?
15 − 5 = 10 mm; 10 : 0,7 = 14,3 Lagen.
Somit ergeben sich 71,4 · 14,3 = 1021,02 Windungen. Jede Windung
hat eine durchschnittliche Länge von 6,3 cm, also ergibt sich
für die Gesamtlänge
rund 1021 · 6,3 cm = 64,32 m.
Da die Dicke des Drahtes ohne die Umspinnung 0,5 mm beträgt, so
ergibt sich nach der Tabelle ein Widerstand von
64,32 · 0,08 = 5,1 Ohm.
[S. 137]
Wir haben also nicht sehr gut geschätzt; der Widerstand ist etwa 4mal
zu groß. Wir müssen deshalb die gleiche Rechnung nochmals für einen
etwas stärkeren Draht durchführen. Nehmen wir zum Beispiel für den
nackten Draht 0,7, für den umsponnenen 1 mm an, so brauchen wir
davon 31,5 m, deren Widerstand sich auf etwa 1,25 Ohm beläuft.
7. Die hier angegebenen Verhältnisse brauchen nur dann berücksichtigt
zu werden, wenn wir von dem Motor unter größtmöglicher Ausnützung
der vorhandenen elektrischen Energie Arbeit verlangen. Soll die
Maschine nur ein Spielzeug sein, das sich dreht, wenn man einen Strom
hineinleitet, so sind wir daran nicht gebunden und können die Maße für
die Bewickelungsdrähte ganz willkürlich wählen.
Induktionsströme.
Nachdem Rudi seine verschiedenen Motoren vorgeführt und erklärt hatte,
ging er dazu über, soviel über Induktionsströme zu sprechen, als
unbedingt zum Verständnisse der magnetelektrischen Maschine und der
Dynamomaschine nötig war. An einigen kurzen Experimenten zeigte er
zuerst die Haupterscheinungen der Magnetinduktion und dann die der
Elektroinduktion.
Magnetinduktion.
Zur Demonstration der Entstehung von Induktionsströmen hatte sich
Rudi eine große hohle Drahtspule gemacht, auf der nahezu 80 m
eines 0,5 mm starken Drahtes aufgewickelt waren. (Es genügen
für diesen Versuch aber auch kleinere Spulen.) Eine größere Anzahl
von Stricknadeln hatte er einzeln magnetisiert (Magnetisieren siehe
Seite 90 u. 140) und dann so zu einem Bündel zusammengebunden, daß
alle gleichnamigen Pole auf derselben Seite waren. Dadurch war ein
starker Stabmagnet entstanden. Die Drahtenden der Spule verband Rudi
mit seinem Vertikalgalvanoskop. Sobald er dann den Stabmagnet in die
Spule hineinschob, schlug die Nadel des Instruments einen Augenblick
nach der einen Seite aus; als er ihn herauszog, geschah der Ausschlag
nach der anderen Seite. Das gleiche Experiment wiederholte er, indem er
den Magnet viel rascher hineinsteckte und herauszog; dabei wurden die
Ausschläge des Galvanoskopes größer als vorher.
Nach diesem Versuche schob Rudi eine kurze Betrachtung über die
Kraftlinien ein, über die er ja schon im[S. 138] zweiten Vortrag eingehend
gesprochen hatte. Er erklärte fernerhin, daß, wenn ein Leiter der
Elektrizität von Kraftlinien durchschnitten wird, in ihm elektrische
Ströme auftreten. In einem beliebig geformten Leiter sind die Ströme
ungeordnet und kommen nicht zur Geltung. Geben wir aber dem Leiter die
Form eines langen, zur Spule aufgewickelten Drahtes, so summieren sich
die kleinsten Stromimpulse zu einem durch seine Wirkungen erkennbaren
elektrischen Strome. Ein Strom wird nur so lange erzeugt, als die
Kraftlinien in Bewegung sind. Je rascher sie sich bewegen, desto
stärker ist der Strom. Der Strom, der beim Eintritte von Kraftlinien in
einem Leiter entsteht, ist in seiner Richtung dem Strom, der durch die
austretenden Kraftlinien hervorgerufen wird, entgegengesetzt.
Elektroinduktion.
Ähnlich wie ein Stahlmagnet wirkt eine von einem Strome durchflossene
Spule. Um auch das zu zeigen, hatte sich Rudi eine kleinere Spule
gemacht, die in die größere eingesteckt werden konnte. Auch die
kleinere Spule war hohl, so daß es möglich war, einen Eisenkern in sie
hineinzuschieben. Rudi führte den Versuch zuerst ohne, dann mit dem
Eisenkern aus. In letzterem Falle war die Wirkung bedeutend stärker, da
durch die Gegenwart des Eisens die Zahl der Kraftlinien sehr vergrößert
wurde.
Der dritte Versuch bestand darin, daß Rudi die kleine Spule mit dem
Eisenkern in der großen stehen ließ und den Strom zur kleinen plötzlich
ein- und ausschaltete. Beim Einschalten des Stromes erhielt er den
Ausschlag des Galvanoskopes nach derselben Seite wie beim Eintauchen
des Magneten; das Ausschalten entsprach in dieser Beziehung seinem
Herausnehmen.
Nach diesen einleitenden Versuchen ging Rudi zur Erklärung der
Wirkungsweise der magnetelektrischen Maschine über. Er hatte sich
selbst eine solche gefertigt, und wir wollen nun sehen, wie man dabei
zu Wege gehen muß, um zu einem sicheren und guten Ergebnisse zu
gelangen.
Die magnetelektrische Maschine.
Um eine gutgehende magnetelektrische Maschine herstellen zu können,
bedürfen wir vor allem eines[S. 139] starken Stahlmagneten, dessen Form von
der des Ankers abhängt. Von den drei uns schon bekannten Ankerformen
kommen nur die beiden in Abb. 118 dargestellten in Betracht.
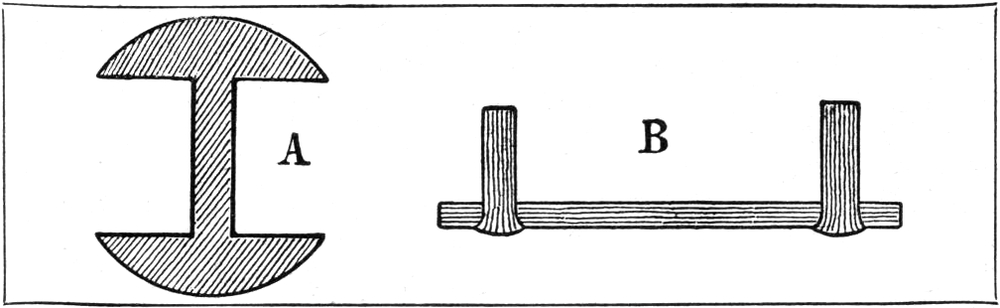
Abb. 118. Ankerformen für magnetelektrische Maschinen.
Für die Stahlmagnete eignet sich der dänische Stahl am besten; für
unsere Zwecke jedoch genügt gewöhnlicher Werkzeugstahl, der in 50
bis 70 cm langen Stäben als Rund- und Bandstahl von den
verschiedensten Querschnittdimensionen in den Handel kommt. Es können
auch Sägeblätter verwendet werden.
Die Doppel-T-Anker sind für solche Maschinen geeigneter als die
sogenannten Hufeisenanker, haben aber den Nachteil, daß wir sie nicht
selbst herstellen können. Man kann sie dagegen bei jedem Mechaniker
kaufen.
Der Werkzeugstahl kommt meist in weichem, geglühtem Zustand in den
Handel; trotzdem ist es vorteilhaft, ihn vor der Bearbeitung nochmals
durchzuglühen. Da es sich hier um ziemlich starke Stücke handelt, wird
allerdings in den meisten Fällen selbst ein guter Bunsenbrenner nicht
mehr genügen, die Eisenstäbe richtig zum Glühen zu bringen.
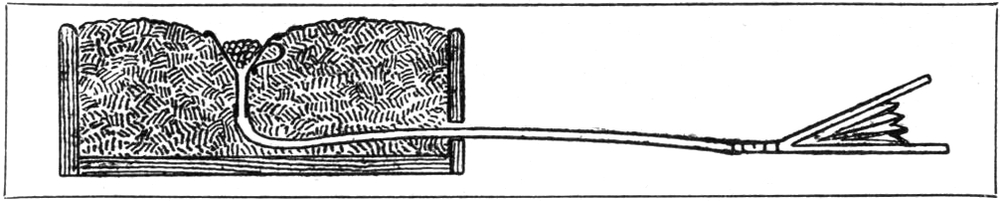
Abb. 119. Die improvisierte Schmiedeesse (Schnitt).
Die Schmiedeesse.
Wir müssen uns deshalb rasch eine kleine Schmiedeesse
anfertigen. An das eine Ende eines Gummischlauches stecken wir einen
alten Trichter aus Eisenblech, an das andere einen Blasebalg. Der
Trichter wird mit der Öffnung nach oben in eine[S. 140] mit Sand gefüllte
Kiste gesteckt und der Schlauch zu einem in die Seite eingebohrten
Loche hinausgeleitet. Die Trichteröffnung wird etwa zur Hälfte mit
etwas mehr als nußgroßen Kieselsteinen angefüllt. Den Schnitt durch
diese Einrichtung zeigt Abb. 119.
Nehmen wir nun an, unser Anker habe einen Durchmesser von 25 mm
und eine Länge von 30 mm, so brauchen wir ein 60 cm
langes, 12 mm breites und 3 mm dickes, ferner ein 18
cm langes, 15 mm breites und 3 mm dickes Stück
Bandstahl. Ersteres wird in zehn, je 6 cm lange, letzteres
in vier, je 4,5 cm lange Stäbe zerlegt. Wie diese später zu
einem Magnetstock angeordnet werden, geht aus Abb. 120 hervor. Um den
Anker an einer möglichst großen Fläche nahe zu umschließen, müssen
in den einander gegenüberstehenden Magnetschenkeln der Ankerkrümmung
entsprechende Aushöhlungen angebracht werden (siehe Abb. 120 A).
Um die einzelnen Stäbe zu einem festen Ganzen zusammenzuhalten, müssen
die längeren an dem dem Ankerausschnitt entgegenliegenden Ende, die
kürzeren an beiden Enden durchbohrt werden. Es erübrigt nun noch,
alle Kanten, mit Ausnahme derer der Ankerausschnitte, mit Feile und
Schmirgelpapier wohl abzurunden.
Je dünner die einzelnen Stäbe sind, desto besser lassen sie sich
magnetisieren, weshalb sich Sägeblätter sehr gut eignen. Auch können
wir dann das Magnetisieren in Ermangelung eines starken Stromes durch
Streichen mit einem Stahlmagneten bewerkstelligen (siehe unten). Zum
Ausfeilen der Rundung für den Anker klemmen wir dann eine größere
Anzahl solcher Blätter zusammen in den Schraubstock und befeilen sie
mit der halbrunden Eisenfeile.
Härten und Magnetisieren
von Stahlstäben.
Jetzt müssen die Stahlstäbe gehärtet werden. In einem Holzkohlenfeuer,
das wir auf unserer Schmiedeesse entfachen, werden sie einzeln bis auf
helle Rotglut erhitzt und dann direkt aus dem Feuer heraus in kaltes
Wasser geworfen. Nachdem so alle Stäbe gehärtet sind, werden sie mit
Schmirgelleinwand von der durch das Glühen entstandenen Oxydschicht
etwas befreit und müssen dann magnetisiert werden. Zu diesem Zweck
stellen wir uns[S. 141] eine Drahtspule her, in die die Stahlstäbe gerade
hineinpassen. Die Bewickelung muß so gewählt werden, daß mit der uns
zur Verfügung stehenden Stromquelle ein möglichst starker
Gleichstrom durch möglichst viele Windungen fließt. Mit Hilfe
des Ohmschen Gesetzes (Seite 86 u. f.) ist es nicht schwer, das
festzustellen. Ist unsere Stromquelle überhaupt schwach, so müssen wir
den Strom entsprechend länger wirken lassen, was jedoch den Mangel an
Intensität bei weitem nicht ersetzen kann. Es ist weit vorteilhafter,
12 Ampere 2½ Minuten wirken zu lassen, als z. B. 1 Ampere 30 Minuten.
Nach einem andern Verfahren, das aber auch einen starken Strom
erfordert, verfährt man folgendermaßen: Man windet sich aus 2 bis 2,5
mm starkem, isoliertem Kupferdraht eine Spule, die aber für die
kürzeren Magnetstäbe nicht länger als 2 cm, für die längeren
nicht länger als 2,5 bis 3 cm sein darf. In diese Spule bringen
wir den zu magnetisierenden Stab so, daß die Spule genau über seiner
Mitte liegt; erst jetzt wird ein möglichst starker Strom durch die
Windungen geschickt und der Stab so in der Spule etwa 15 bis 20 mal
hin und her geschoben, daß das Stabende der einen Seite immer nur bis
zum Spulenende der gleichen Seite geführt wird. Man hört wieder in der
Mitte auf und zwar so, daß jede Stabhälfte gleich oft durch die Spule
gegangen ist; dann wird der Strom abgestellt. Steht uns kein starker
Strom zur Verfügung, so tun wir gut daran, das Magnetisieren von einem
zuverlässigen Mechaniker besorgen zu lassen. Stehen uns gute, starke
Stahlmagnete zur Verfügung, so können wir unsere Stäbe auch durch
Streichen magnetisch machen. Das einfachste Verfahren, wozu wir auch
nur einen Magneten brauchen, besteht darin, daß man erst den
einen, z. B. den Nordpol des Strichmagneten, in der Mitte auf den zu
magnetisierenden Stab aufsetzt, ihn unter starkem Aufdrücken nach dem
Ende zu führt, da hochhebt, in der Luft im Bogen zurückgeht, wieder
in der Mitte aufsetzt u. s. f. 10 bis 20 mal; dann wiederholt man
das gleiche Verfahren mit dem anderen Pol nach der anderen Seite des
Stabes. Bessere Resultate gibt folgendes Verfahren: Wir legen zwischen
2 Stabmagnete ein Holz, das so dick[S. 142] wie die Magnete und 1 bis 2
cm kürzer als die zu magnetisierenden Stäbe ist; rechts liegt
der Nordpol, links der Südpol am Holz an. Darauf wird der Stahlstab so
gelegt, daß seine Enden auf den Magnetpolen aufliegen. Zwei weitere
Stabmagnete werden, durch ein 5 mm dickes Hölzchen getrennt, so
in der Mitte des Stabes aufgesetzt, daß sie mit diesem Winkel von 45°
bilden und daß rechts der Nord-, links der Südpol aufliegt. Nun fährt
man erst an das eine Ende (nicht darüber hinaus!), dann über die Mitte
weg nach dem anderen u. s. f. 10 bis 20 mal und hört so in der Mitte
auf, daß man gleich oft über jede Hälfte gefahren ist.
Es ist besonders darauf zu achten, daß die eine Hälfte, also
fünf Stück, der längeren Stahlstäbe an dem mit dem Ausschnitt
versehenen Ende + (nord-) magnetisch, die andere Hälfte der Stäbe
an dem ausgeschnittenen Ende − (süd-) magnetisch werden. Mit einer
freischwebenden Magnetnadel stellen wir die Nord- und Südpole der
einzelnen Magnete genau fest und bezeichnen sie deutlich mittels
Tinte mit den Zeichen + und −. Nun werden diese Magnete in der aus
Abb. 120 hervorgehenden Anordnung zusammengestellt. Zwei Eisenstäbe,
die an beiden Enden mit Gewinden versehen sind, werden durch die
Löcher geschoben, und mit je zwei Muttern werden die Magnete fest
zusammengepreßt. Sollten an den Berührungsflächen der einzelnen
Magnete infolge des Glühens oder eines anderen Umstandes Unebenheiten
aufgetreten sein, so müssen diese durch Schleifen, was aber vor dem
Magnetisieren auszuführen ist, mit Schmirgel beseitigt werden, feilen
läßt sich gehärteter Stahl nicht mehr!
Den so gewonnenen Magnetstock können wir dadurch verstärken, daß wir
uns noch Magnete von passender Größe herstellen, mit denen wir die
Zwischenräume zwischen den einzelnen Stäben ausfüllen, natürlich unter
richtiger Berücksichtigung der Pole.
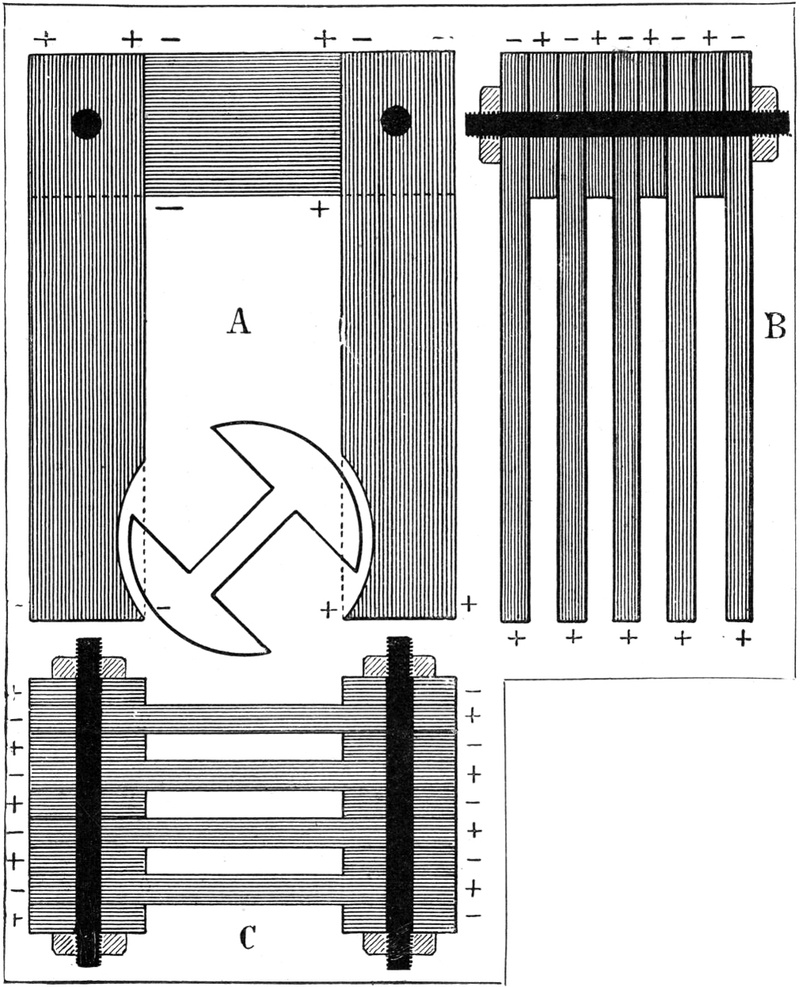
Abb. 120. Der aus einzelnen Stäben zusammengesetzte
Magnetstock.
[S. 143]
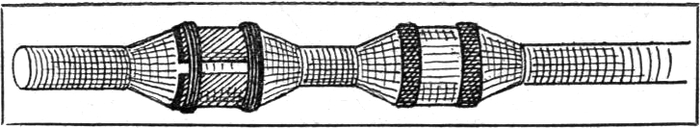
Abb. 121. Gleich- und Wechselstromabnehmer auf einer
Achse.
Wir kommen nun zur Bewickelung des Ankers. Je länger und dünner der
Draht ist, den wir verwenden, desto höher ist die Spannung und desto
geringer die Stromstärke. Für eine Maschine in den hier angegebenen
Dimensionen dürfte ein 0,3 bis 0,5 mm starker Draht die besten
Resultate ergeben. Die Drahtenden werden zu einem Kollektor geführt,
wie er schon auf Seite 123 beschrieben worden ist. Die Stellung der
Schleiffedern ist hier genau dieselbe wie dort. Außer diesem Kollektor,
der den in den Spulen induzierten Wechselstrom in Gleichstrom
umwandelt, können wir auch einen solchen zur Abnahme von Wechselstrom
auf der Achse anbringen. Er besteht einfach aus zwei nebeneinander
liegenden, aber[S. 144]
voneinander isolierten Metallringen. Abb. 121 zeigt
beide Kollektoren nebeneinander auf einer Achse. Die Drahtenden der
Spule, die zu dem äußeren der beiden Kollektoren führen, müssen
natürlich unter dem inneren hindurchgehen.
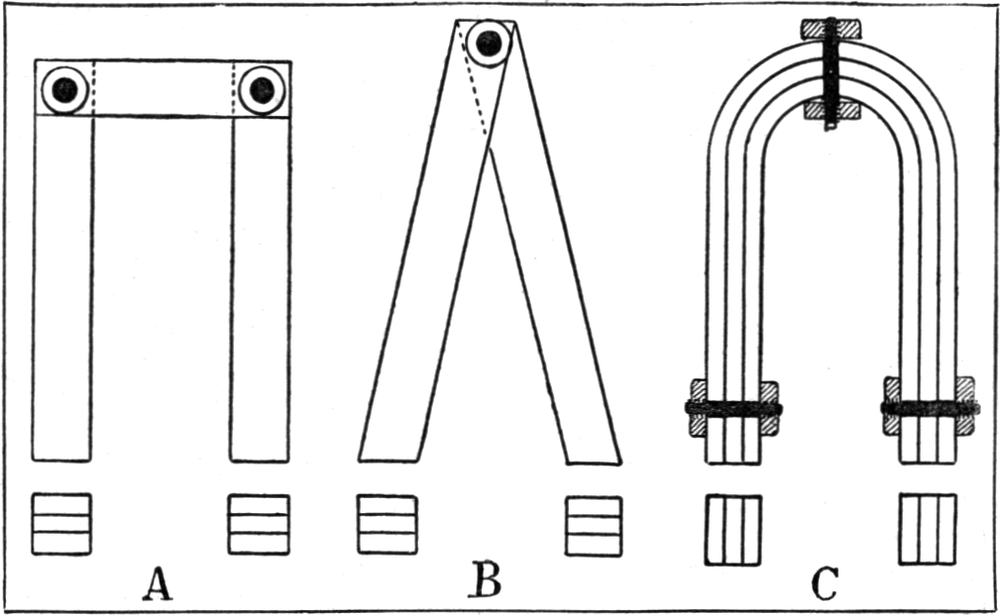
Abb. 122. Verschiedene Formen für Feldmagnete.
Verwenden wir statt des Doppel-T-Ankers den in Abbildung 118
B abgebildeten, so ist der dazu nötige Stahlmagnet etwas
einfacher herzustellen. Abb. 122 zeigt drei verschiedene Formen.
Für die Verwendung von Sägeblättern dürfte die Form C am
geeignetesten sein; natürlich müssen dann mehr als drei Streifen
zusammengelegt werden. Die Stirnfläche des Feldmagneten soll mindestens
1 qcm groß sein.
Abb. 123 zeigt den Anker mit den Spulen (d) und deren Stellung
zum Feldmagnet (a) im Schnitt; c ist die Achse,
b der Ankerkern, e der Kollektor. Diese Teile sind
den entsprechenden des auf Seite 123 beschriebenen Elektromotors in
jedem Punkte gleich. Für die Bewickelung gilt das nämliche wie beim
Doppel-T-Anker.
Der Anker der magnetelektrischen Maschine muß, um einen elektrischen
Strom zu liefern, ziemlich rasch gedreht werden. Wir befestigen deshalb
auf der Achse eine aus Hartholz gedrechselte Welle, über die wir einen
Riemen oder eine Schnur zu einem Schwungrade leiten. Wir können dazu
das Schwungrad einer Nähmaschine mit Fußbetrieb[S. 145] verwenden, wenn wir
die Nähmaschine von dem Tischchen abheben. Wir können uns aber auch
ein Schwungrad folgendermaßen selbst herstellen: Wir sägen uns aus
einem breiten Brett, das wir eventuell aus anderen zusammenleimen,
eine runde Scheibe. Auf ihre beiden Seiten kleben wir je einen Ring
aus starkem Pappendeckel, der so groß ist, daß er den Rand der Scheibe
um etwa 0,5 cm überragt. Dadurch wird eine Rinne gebildet, in
der eine Schnur laufen kann, ohne abzugleiten. Es ist nun noch eine
Kurbel anzubringen und die Scheibe auf einer Achse an einem Gestelle zu
befestigen. Dessen Konstruktion ausfindig zu machen, überlassen wir der
Phantasie des jungen Bastlers.
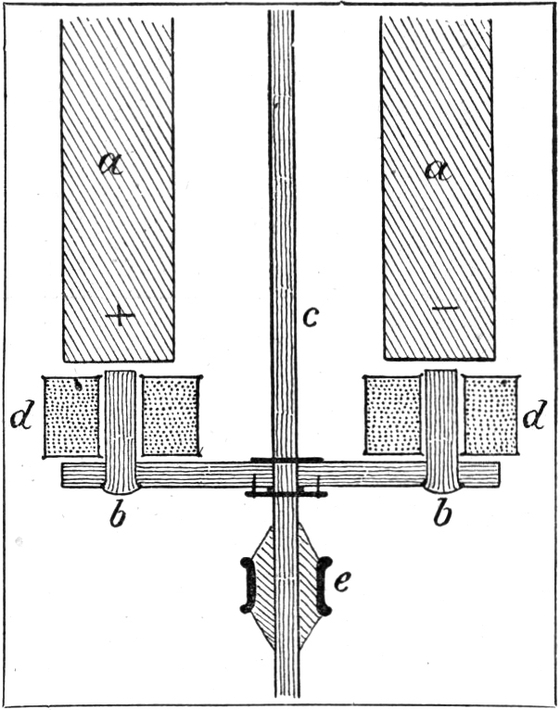
Abb. 123. Schnitt durch die magnetelektrische Maschine
mit Hufeisenanker.
Wirkungsweise der magnetelektrischen Maschine.
Die Wirkungsweise der magnetelektrischen Maschine erklärte Rudi im
Anschluß an die Experimente über Magneto- und Elektroinduktion. Dort
haben wir gesehen, daß in einem Leiter elektrische Ströme entstehen,
sobald Kraftlinien sich in ihm bewegen. Dabei konnten wir beobachten,
daß das Ein- oder Austreten der Kraftlinien für die
Stromrichtung bedingend war. Maxwell hatte eine Regel aufgestellt, die
uns gestattet, die Richtung des Induktionsstromes sicher festzustellen.
Betrachten wir die Abb. 124, die die Kraftlinien eines Magnetstabes
NS darstellt; wir sehen an den eingezeichneten Pfeilen, daß
diese Linien, vom Nordpol nach allen Seiten ausstrahlend, sich nach
dem Südpol hin bewegen. Die Maxwellsche[S. 146] Regel heißt: Betrachtet
man eine Drahtspule, die sich in einem magnetischen Felde[5] bewegt,
in der Richtung der Kraftlinien, so bringen eintretende Kraftlinien
einen Strom hervor, der der Uhrzeigerbewegung entgegengesetzt ist,
austretende dagegen einen solchen, der dieselbe Drehungsrichtung hat
wie der Uhrzeiger.
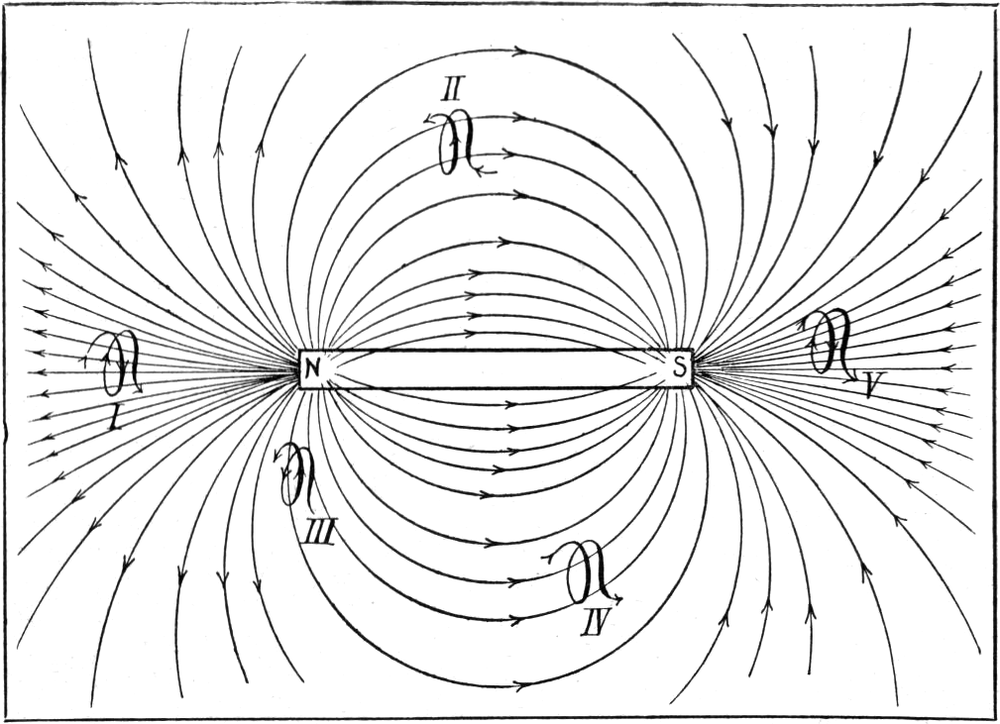
Abb. 124. Drahtringe, die sich in einem magnetischen
Feld bewegen.
In Abb. 124 sind fünf Drahtringe eingezeichnet. Nehmen wir an, daß sich
I und II von links nach rechts bewegen und III, IV und V von rechts
nach links, so werden die induzierten Ströme in der eingezeichneten
Richtung fließen.
Betrachten wir nun die Verhältnisse bei unserer magnetelektrischen
Maschine mit dem Hufeisenanker in der in Abb. 123 dargestellten Lage,
so gehen die Kraftlinien im Bogen vom +-Pol des Stahlmagneten durch
den Anker hindurch zum −-Pol. Dabei treten sie in die linke Drahtrolle
von vorn, in die rechte von hinten ein, da sie in einem Bogen von
einem Pol zum anderen gehen. Wird[S. 147] der Anker so gedreht, daß die linke
Spule gewissermaßen nach oben aus der Bildfläche heraustritt und die
rechte sich abwärts bewegt, so treten aus beiden Spulen Kraftlinien
so lange aus, bis der Anker eine Drehung von 90° gemacht hat.
Wird er dann weiter gedreht, so dringen Kraftlinien ein, aber
von der anderen, der hinteren Seite her, bis die Pole des Ankers,
nachdem er sich um 180° gedreht hat, vor denen des Magneten stehen.
Wir wollen die Richtung der während der halben Umdrehung in den beiden
Spulen induzierten Ströme feststellen. Dabei soll „von vorn gesehen“
jedesmal die Richtung vom Anker zum Feldmagneten, „von hinten
gesehen“ die umgekehrte Richtung angeben. Zuerst, während sich die
linke Spule nach oben bewegt, treten von hinten kommende Kraftlinien
aus ihr heraus, oder, wie man sich auch ausdrücken kann, die Zahl der
von hinten in die Spule eindringenden Kraftlinien wird ständig
geringer; der Strom wird also von hinten gesehen im Sinne
der Uhrzeigerbewegung durch die Spule fließen. Beginnt die Spule nach
einer Drehung von 90° sich wieder abwärts zu bewegen, so wird die Zahl
der von vorn eindringenden Kraftlinien beständig größer.
Betrachten wir nun wie vorhin die Spule von hinten, so fließt
der induzierte Strom immer noch im Sinne der Uhrzeigerbewegung.
Jetzt wollen wir sehen, was unterdessen in der anderen Drahtrolle
— die ursprünglich rechts stand — vor sich gegangen ist. Hier
sind zuerst die von vorn kommenden Kraftlinien aus der Spule
ausgetreten, dann — nach einer Viertelumdrehung — die von
hinten kommenden eingetreten, also gerade umgekehrt
wie bei der zuerst betrachteten Drahtrolle. Hier fließt demnach der
Induktionsstrom von hinten gesehen entgegen dem Sinne der
Uhrzeigerbewegung. Daraus folgt, daß der Strom in den Spulen, die
sich oberhalb der Bildebene bewegen, in der einen, in denen, die
sich unterhalb der Ebene bewegen, in der anderen Richtung fließt.
Verbinden wir die Drahtenden der Spulen so wie bei einem gewöhnlichen
Elektromagnet, bei welchem der Draht um den einen Magnetschenkel
rechts, um den anderen links herum aufgewickelt ist, so
werden sich die in[S. 148] den beiden Drahtrollen induzierten Ströme nicht
entgegenfließen, sondern addieren; dagegen werden sie die Drähte
während der ersten halben Umdrehung in der einen, während der zweiten
in der anderen Richtung durchfließen, da ja in beiden Spulen in dem
Augenblick, in dem sie die Pole des Feldmagneten passieren, der
Induktionsstrom seine Richtung ändert.
Führen wir die Drahtenden der Ankerspulen zu zwei ganzen, voneinander
isolierten Ringen auf der Achse und leiten mittels zweier Schleiffedern
den Strom in einen Draht, so durchfließt er diesen unter fortwährender
Änderung seiner Richtung. Davon können wir uns überzeugen, wenn wir das
Vertikalgalvanoskop mit den Schleiffedern verbinden und die Maschine
ganz langsam in Gang setzen: nach je einer halben Ankerumdrehung wird
die Nadel des Instrumentes zuerst nach der einen, dann nach der anderen
Seite ausschlagen. Drehen wir aber den Anker sehr rasch, so bekommen
wir überhaupt keinen Ausschlag, weil die einzelnen Impulse, die ständig
ihre Angriffsrichtungen auf die Nadel ändern, so rasch nacheinander
eintreffen, daß die Trägheit der Nadel und des Magneten diesen nicht
erlauben, den Impulsen zu folgen. Wir können dagegen mit einer kleinen
Glühlampe das Vorhandensein eines Stromes nachweisen, denn der
Kohlenfaden wird in der gleichen Weise erhitzt, ob der Strom in der
einen oder anderen Richtung ihn durchfließt.
Um von der magnetelektrischen Maschine Gleichstrom abnehmen zu können,
haben wir auch den zweihälftigen Kollektor auf der Achse montiert. Daß
dieser als Kommutator, als Stromwender wirkt, haben wir schon auf Seite
123 gesehen.
Die Dynamomaschine.
Sich selbst eine Dynamomaschine, die wirklich als Generator zu
gebrauchen ist, anfertigen zu wollen, ist ein Unternehmen, das meistens
daran scheitert, daß eben eine solche Maschine in allen ihren Teilen
ganz genau berechnet sein will. Wer sich nach den Berechnungsangaben
auf Seite 134 u. f. einen größeren Motor gebaut hat, kann unter
Umständen das Glück haben — es wäre ein Zufall —, daß derselbe auch
als Generator zu verwenden ist. Unter den beschriebenen[S. 149] Motoren kann
in dieser Beziehung am meisten von den vierpoligen mit Hufeisenanker
oder von solchen mit Doppel-T-Anker erwartet werden. Wie wir die
Maschinen auf ihre Fähigkeiten dieser Art hin zu prüfen haben, wird am
Ende des Abschnittes erwähnt. Jetzt wollen wir zuerst hören, was Rudi
in seinem Vortrag über das Prinzip der Dynamomaschine ausführte.
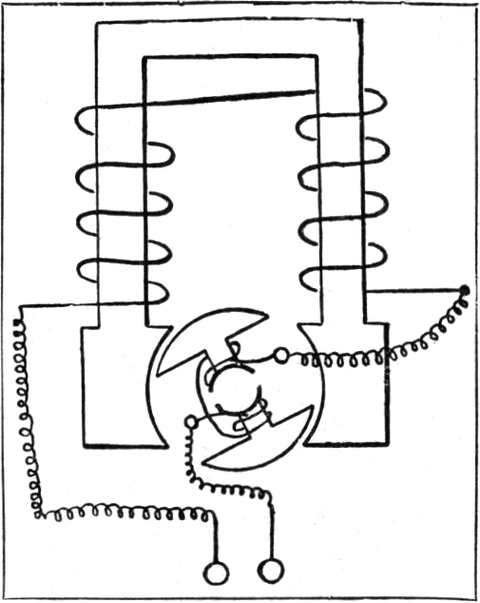
Abb. 125. Schema einer Hauptstrommaschine.
Wir haben gesehen, daß, wenn sich ein Drahtkreis in einem magnetischen
Felde bewegt, in diesem — dem Drahtkreis — ein elektrischer Strom
erzeugt wird. Der Strom ist umso stärker, je stärker das magnetische
Feld ist. Nun ist es eine bekannte Tatsache, daß wir ein Stück weiches
Eisen mit Hilfe eines elektrischen Stromes zu einem viel stärkeren
Magnet machen können als ein gleich großes Stück Stahl. Es lag deshalb
der Gedanke nahe, für magnetelektrische Maschinen statt Stahlmagnete
Elektromagnete zu verwenden und den Strom für diese entweder einer
Batterie, oder einer kleineren magnetelektrischen Maschine zu
entnehmen. Werner v. Siemens kam zuerst (i. J. 1867) auf den Gedanken,
den Ankerstrom selbst zur Erregung der Feldmagnete zu verwenden. Auch
das weichste Eisen, wenn es einmal magnetisch gemacht war, behält eine
Spur von Magnetismus, die genügt, einen wenn auch sehr kleinen Strom im
Anker zu erzeugen. Dieser kleine Strom wird um den Feldmagnet geleitet
und macht ihn ein wenig stärker, wodurch auch der induzierte Strom
wieder stärker wird und den Feldmagnet noch stärker macht u. s. f., bis
die Grenze der Magnetisierungsfähigkeit des Eisens erreicht ist. Zur
besseren Veranschaulichung dieses Vorganges stellte Rudi eine Tafel mit
der in Abb. 125 dargestellten Figur auf.
[S. 150]
Diese Tafel zeigt die sogenannte Hauptstrom- oder
Serienschaltung, weil der Hauptstrom, das ist der ganze im
Anker erzeugt werdende Strom, durch die Windungen des Feldmagneten
fließt. Anders verhält sich das bei der in Abb. 126 dargestellten
Schaltungsweise, der sogenannten Nebenschlußschaltung. Hier
liegen die Feldmagnete im Nebenschluß zu dem im Anker erzeugten
und durch das Leitungsnetz (X) fließenden Strom. Diese
Schaltungsweise ist die gebräuchlichere, da durch einen bei R
(Abb. 126) eingeschalteten Rheostaten (siehe Anhang) die Spannung
bequem reguliert werden kann. Mache ich den Widerstand in R
größer, so sinkt die Spannung, mache ich ihn kleiner, so steigt sie.
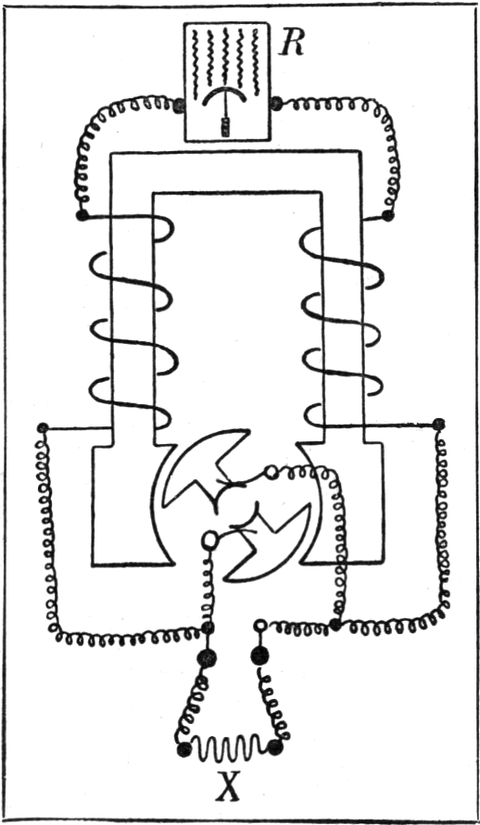
Abb. 126. Schema einer Nebenschlußmaschine.
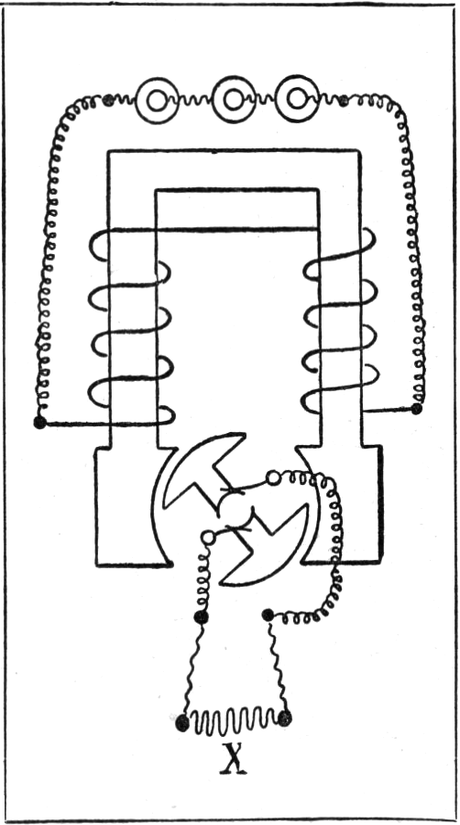
Abb. 127. Schema einer Maschine mit Fremderregung.
Es können auch beide Schaltungsweisen kombiniert werden (Verbund-
oder Compoundmaschine), doch ist hier nicht der Platz, auf all diese
Einzelheiten einzugehen; wir wollen uns lieber nur mit solchen
Experimenten beschäftigen,[S. 151] die den Verhältnissen unseres einfachen
Laboratoriums angepaßt sind.
So wollen wir z. B. sehen, wie wir einen Elektromotor zur
magnetelektrischen Maschine machen können: Wir verbinden die Drahtenden
der Feldmagnetwickelung mit einer Batterie und können dann, wenn
der Anker gedreht wird, von den Schleiffedern Strom abnehmen. Diese
Schaltungsweise zeigt Abb. 127.
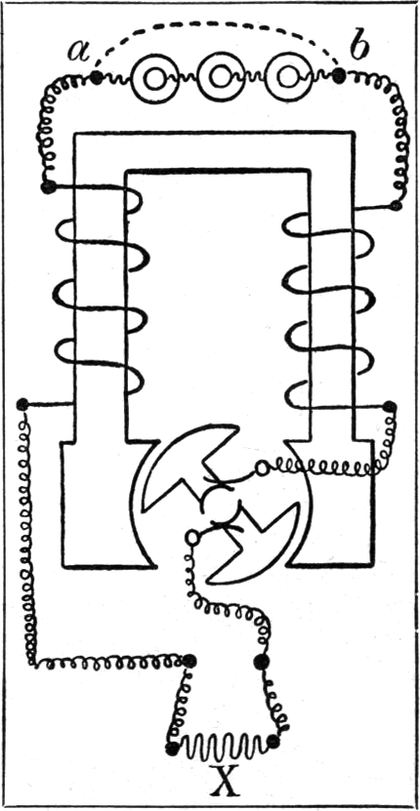
Abb. 128. Einschaltung eines Hilfsstromes in den
Stromkreis der Dynamo.
Wollen wir mit einem unserer Motoren unser Glück probieren, ob er auch
als Generator zu verwenden ist, so müssen wir folgendermaßen verfahren:
Wir schalten Anker und Feldmagnet hintereinander (Serienschaltung), in
den Stromkreis des Feldmagneten eine Stromquelle und in den äußeren
Stromkreis ein Amperemeter X ein, wie aus Abb. 128 ersichtlich
ist. (Die Elemente können natürlich auch an einer anderen Stelle des
Stromkreises eingeschaltet werden.) Dieser Hilfsstrom braucht nicht
stärker zu sein, als daß er den Motor gerade noch in langsame Rotation
versetzt. Drehen wir nun den Anker gewaltsam in entgegengesetzter
Richtung, als er durch den Batteriestrom gedreht wurde, so wird er
einen Strom erzeugen, der gleichgerichtet mit dem der Elemente ist.
Während die Maschine im Gang ist, verbinden wir zuerst die beiden
Punkte a und b (Abb. 128) durch einen kurzen Kupferdraht
und schalten dann die Batterie aus. An dem angeschlossenen Amperemeter
können wir jetzt sehen, ob das Glück uns hold war und unseren Motor
auch als Generator arbeiten läßt.
Nachdem Rudi die wichtigsten theoretischen Dinge über Motoren und
Generatoren besprochen hatte, ging er dazu[S. 152] über, seinen aufmerksamen
Zuhörern die praktische Anwendung dieser Maschinen im Großbetriebe zu
erklären.
Die elektrische Lokomotive.
Zuerst führte er eine kleine elektrische Lokomotive vor. Er hatte sie
sich aus einer Spielzeugeisenbahn, an deren Maschine die Betriebsfeder
gebrochen war, hergestellt, indem er einen kleinen Elektromotor so
auf der Lokomotive, von der er Kessel und Uhrwerk entfernt hatte,
befestigte, daß die Welle des Motors unmittelbar auf dem oberen Rande
des Lokomotivenrades auflag. Um die Reibung zwischen diesen beiden
Rädern zu vergrößern, legte er in die Furche der Motorwelle einen
kleinen Gummiring.
Das Geleise der Bahn, das ein großes Oval bildete, befestigte er auf
einem entsprechend großen Pappendeckel, den er, um ihm mehr Halt zu
geben, auf der Unterseite mit Holzleistchen benagelte. In Abständen von
etwa 10 cm stellte er Tragmasten aus Weidenholzstäbchen auf und
verband je zwei, die einander gegenüber standen, während das Geleise
zwischen ihnen hindurchlief, mit einer Schnur. An dieser wurde die aus
1 mm starkem Kupferdraht bestehende „Oberleitung“ befestigt.
Damit die Unterseite, an welcher der stromabnehmende Schleifbügel
entlanggleiten sollte, auch an den Befestigungsstellen völlig glatt
sei, lötete er auf der Oberseite Drahthäkchen an, die in Schlingen
der Aufhängeschnüre eingehängt wurden. Der Schleifbügel war in der
Form gebogen, wie wir sie an unseren Straßenbahnen sehen, isoliert von
dem übrigen Gestell auf der Lokomotive befestigt und mit der einen
Polklemme des Motors verbunden. Die andere Klemme wurde mit dem Gestell
der Maschine und außerdem mit einer auf der Radachse aufliegenden
Schleiffeder in leitende Verbindung gebracht. Die einzelnen Schienen
des Geleises waren untereinander verlötet. Der Strom eines kleinen
Akkumulators, der durch die Oberleitung in den Motor eintreten und
durch die Räder und Schienen wieder zurückfließen konnte, ließ
unsere elektrische Lokomotive ohne Schwierigkeiten eine stattliche
Anzahl kleiner Wagen mit ziemlich großer Geschwindigkeit hinter sich
herziehen.
[S. 153]
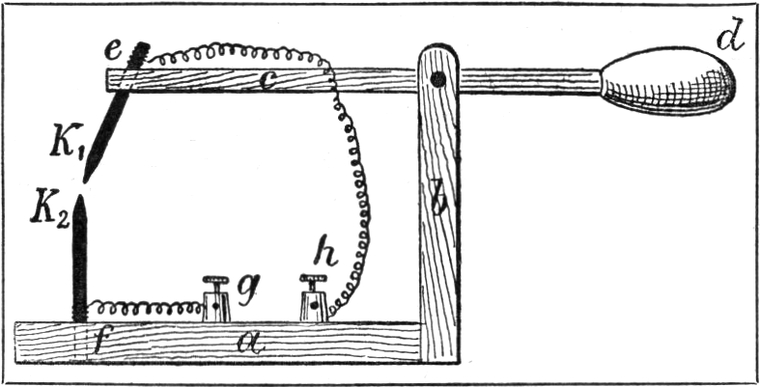
Abb. 129. Einfache Bogenlampe.
Die Bogenlampe.
Auch eine kleine Bogenlampe fertigte sich Rudi. Abb. 129 zeigt ihre
Einrichtung: Auf dem Grundbrett a ist die Säule b
errichtet, in welcher der Hebel c mit dem Griff d
befestigt ist. Der Hebel ist aus Holz und darf sich nicht zu leicht um
seine Achse drehen, damit er in jeder Lage, in die wir ihn bringen,
stehen bleibt. Er hat bei e ein Loch, in welchem die Kohle
K₁ festgesteckt werden kann; für denselben Zweck ist in
a, bei f ein Loch. Für
K₁ und K₂
verwenden wir möglichst dünne Bogenlampenkohlen, die wir, wenn wir nur
einen schwachen Strom zur Verfügung haben, mit dem Messer sehr fein
zuspitzen. Um die Kohlen wickeln wir blanke Kupferdrähte, die zu den
Klemmen g und h führen. Um den Lichtbogen zu erzeugen,
verbinden wir die beiden Klemmen mit unserer stärksten Stromquelle,
bringen die beiden Kohlespitzen zuerst miteinander in Berührung und
rücken sie dann ein paar Millimeter auseinander, in welchem Augenblicke
der Lichtbogen entsteht. Dies wird bei unserem einfachen Apparat aber
nur kurze Zeit dauern, da die Kohlespitzen abbrennen; wir müssen
deshalb von Zeit zu Zeit K₁, durch Verstellen des Hebels
tiefer rücken. Bei großen Bogenlampen werden die Kohlenstifte durch ein
selbsttätig wirkendes Uhrwerk auf dem richtigen Abstand erhalten.
Der Kurzschluss.
Um das Wesen des berüchtigten Kurzschlusses zu erklären, hatte
Rudi für den Vortrag eine kleine Spielerei hergerichtet. Er klebte
sich aus Packpapier ein kleines Häuschen und malte Fenster, Türen
u. s. w. auf. An beiden Giebeln ließ er zwei weiße Isolierknöpfe sehen.
Rechts und links vom Hause, den Giebeln gegenüber stellte er je eine
Telegraphenstange[S. 154] auf. Von den Isolierknöpfen am linken Giebel des
Hauses führten zwei starke Kupferdrähte über die Telegraphenstange nach
der Akkumulatorenbatterie. Diese Leitungen setzte er mit zwei dünnen
Eisendrähten durch das Haus hindurch über die Isolierknöpfe am rechten
Giebel bis zu der zweiten Telegraphenstange fort, an welcher eine
Leiter lehnte, auf der ein aus Papier geschnittener Arbeiter stand.
Der Arbeiter schien an einer Glühlampe zu arbeiten, die an die beiden
Eisendrähte angeschlossen war und glühte. In dem Papierhaus legte Rudi
auf die Leitung leicht zusammengeballtes mit wenig Tropfen
Petroleum beträufeltes Seidenpapier.
Er erklärte, daß hier von einer starken Stromquelle in einer durch das
Haus führenden Leitung der Glühlampe Elektrizität zugeführt werde.
Die Glühlampe biete dem Strom einen sehr großen Widerstand, so daß er
eine gewisse Stärke nicht überschreiten könne. Wenn nun aber der an
der Leitung arbeitende Mann aus Unachtsamkeit ein Werkzeug, z. B. eine
Zange fallen ließe, und sie würde so auf die beiden Leitungsdrähte zu
liegen kommen, „wie dieses Stückchen Draht hier“ — dabei legte er ein
Stückchen Kupferdraht auf die beiden Eisendrähte —, so würde auch im
großen das gleiche Ereignis eintreten wie hier im kleinen. Kaum hatte
er das Kupferdrahtstückchen auf die Leitung gelegt, als diese anfing
glühend zu werden und durchschmolz; einen Augenblick später stand das
Haus in Flammen. Dadurch, daß der Strom, statt den schwierigen Weg
durch die Glühlampe nehmen zu müssen, durch das Drahtstückchen kurz
geschlossen — daher das Wort „Kurzschluß“ — war, wurde er
so stark, daß die Leitungsdrähte zu glühen anfingen und das auf ihnen
liegende Papier im Hause entzündeten. In Wirklichkeit liegt zwar kein
Seidenpapier auf den Leitungsdrähten, diese sind aber meist mit leicht
entzündlichen, sehr stark brennenden Materialien wie Pech, Wachs,
Guttapercha u. s. w. isoliert.
Die Sicherungen.
Mit obigem Versuch kann man gleichzeitig auch noch einen zweiten
verbinden, der zeigt, in welcher Weise die Sicherungen wirken. Zu
diesem Zweck unterbrechen wir den einen der Zuleitungsdrähte[S. 155] zu dem
Häuschen und überbrücken die Unterbrechung mit einem dünnen Streifchen
von Stanniolpapier, das so viel Strom durchläßt, daß das Lämpchen noch
hell leuchtet, aber doch so dünn ist, daß es sofort schmilzt,
wenn die Leitung kurz geschlossen wird. Wir machen den Versuch dann
zuerst mit der Sicherung, die so rasch durchschmilzt, daß der Strom
unterbrochen wird, bevor der dünne Eisendraht im Häuschen zum Glühen
kommen kann. Darauf verbinden wir die unterbrochene Stelle direkt und
stellen den Kurzschluß noch einmal her, wobei nun wie vorhin das Haus
in Flammen aufgehen wird.
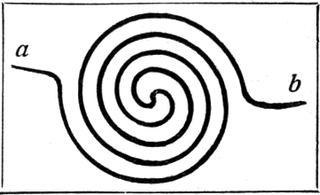
Abb. 130. Drahtschnecke für den Zigarrenanzünder.
Der elektrische Zigarrenanzünder.
Rudi erwähnte nun noch die Verwendung der Elektrizität zu Heizzwecken,
doch konnte er dazu keine Apparate oder Experimente vorführen, obgleich
ein hierher gehöriger Apparat, zu dessen Betrieb nur ein paar kleine
Akkumulatorenzellen nötig sind, nicht schwer herzustellen ist. Es ist
der elektrische Zigarrenanzünder. Wir stellen durch einige Versuche
fest, wie stark ein etwa 7 bis 10 cm langer Eisendraht sein muß,
damit er von dem ungeschwächten Strome unserer Akkumulatorenbatterie
bis zur Weißglut erhitzt wird, ohne aber durchzuschmelzen. Der Draht
wird zu einer Schnecke zusammengebogen, wie Abb. 130 zeigt. Dann
besorgen wir uns — bei einem Mechaniker wird das zu haben sein —
ein kleines Stückchen Asbestpappe, von der wir ein rundes Scheibchen
abschneiden, das so groß ist, daß es unsere Drahtschnecke reichlich
überdeckt. Ein zweites Scheibchen von derselben Größe muß durch
Spalten möglichst dünn gemacht werden. Nunmehr richten wir uns
einen runden Holzstab her von etwa 10 cm Länge und mit einem
Durchmesser, der dem der Asbestscheibchen gleich ist. Ferner brauchen
wir noch einen mit mehreren Löchern versehenen Ring aus Messingblech,
dessen äußerer Durchmesser ebenfalls gleich dem der Scheibchen und
dessen innerer etwas größer als der der Drahtschnecke ist. Auf die
eben abgefeilte Stirnseite des Holzstabes wird zuerst[S. 156] die dicke
Asbestscheibe gelegt, dann die Drahtschnecke so, daß ihre Enden
a und b (Abb. 130) rechts und links heraussehen, darauf
kommt die dünne Asbestscheibe, und schließlich wird das Ganze durch
Aufnageln des Messingringes zusammengehalten. Die freien Drahtenden
löten wir an zwei dicken isolierten Kupferdrähten an; diese führen wir
in Rinnen, die in den Holzstab geschnitten werden, nach dessen unterem
Ende, wo sie an zwei Klemmschrauben enden. Den einen dieser Drähte
können wir auch durch eine Kontaktfeder ersetzen, deren Befestigung
aus der den ganzen Apparat darstellenden Abb. 131 hervorgeht. Wird ein
hinreichend starker Strom durch die Drahtschnecke geleitet, so fängt
diese an zu glühen, und dadurch wird auch die dünne Asbestscheibe
glühend, an welcher dann die Zigarre angezündet werden kann. — Für die
Drahtschnecke Platindraht statt Eisendraht zu verwenden, ist,
von dem hohen Preis des Platins abgesehen, natürlich weit vorteilhafter.
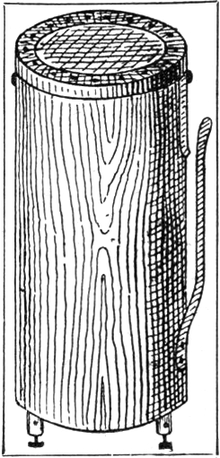
Abb. 131. Der Zigarrenanzünder.
Schluss.
Zum Schluß seines Vortrages erklärte Rudi noch kurz das wichtigste vom
Akkumulator und vom Telephon. Bei der Erklärung des Akkumulators führte
er ein einfaches Experiment aus: Er stellte in ein mit verdünnter
Schwefelsäure (1 : 10) angefülltes Standglas zwei Bleiblechstreifen,
die er kurz vorher mit einem Messer blank geschabt hatte. Durch diese
Zelle leitete er den Strom von zwei Akkumulatoren, worauf die eine
der Platten sich bräunte, die andere ihren Glanz verlor und grau
wurde. Bevor er die Bleiplatten an den Akkumulator anschloß, brachte
er sie mit dem Vertikalgalvanoskop in Verbindung, welches keinen
Strom anzeigte; nachdem dann die eine Platte stark gebräunt war, tat
er dasselbe nochmals, wobei nun die Nadel des Instrumentes so weit
ausschlug, als es ihr möglich war.
Endlich sprach Rudi noch über das Telephon. Dieser Apparat wird im
nächsten Vortrag ausführlich behandelt werden.
Schon
im dritten Vortrag haben wir die grundlegenden Begriffe über
Induktionsströme und ihr Entstehen kennen gelernt. In diesem Vortrage
nun behandelte Rudi die schwierigeren Induktionserscheinungen, nämlich
die Selbstinduktion und die Wirbelströme.
Wir haben gesehen, daß, wenn wir in einer hohlen Drahtspule eine
zweite von einem Strome durchflossene bewegen, in der äußeren Ströme
induziert werden, deren Richtung wir mit Hilfe der Maxwellschen Regel
(Seite 146)[S. 158] bestimmen können, wobei es natürlich einerlei ist, ob
die induzierte Spule die äußere und die induzierende die innere
ist, oder umgekehrt. Wir wollen nun auch noch sehen, wie sich die
elektromotorische Kraft des induzierten (sekundären) Stromes zu der
Intensität des induzierenden (primären) Stromes und der außerdem noch
mitwirkenden Größen verhält.

Abb. 132. Rudi mit den Vorversuchen für seinen Vortrag:
„Wechselströme höherer Frequenz“ beschäftigt.
Regeln zur Bestimmung der elektromotorischen
Kraft des
Induktionsstromes.
1. Je stärker der induzierende Strom (oder Magnet) ist, umso größer
ist unter sonst gleichen Verhältnissen die elektromotorische Kraft des
induzierten Stromes.
2. Je größer die Anzahl der Windungen des sekundären Stromkreises
ist, umso größer ist die elektromotorische Kraft in diesem.
3. Je rascher die Entfernung des primären Stromes (oder Magneten)
von der sekundären Spule geändert wird, oder je plötzlicher der
primäre Strom geschlossen oder geöffnet wird, umso größer ist die
elektromotorische Kraft des Induktionsstromes.
Aus diesen drei Regeln können wir folgendes allgemeine Gesetz ableiten.
Je größer die Zahl der Kraftlinien ist, die während der Zeiteinheit
in die mit Drahtwindungen erfüllte Flächeneinheit ein- oder austreten,
umso größer ist die elektromotorische Kraft des Induktionsstromes.
Selbstinduktion.
Schon im vorigen Vortrag wurde erwähnt, daß ein- und austretende
Kraftlinien in jedem Leiter der Elektrizität, von welcher
Beschaffenheit oder Gestalt er auch sei, Induktionsströme hervorrufen.
Wird eine Drahtspule von einem Strome durchflossen, den wir abwechselnd
öffnen und schließen, so werden in ihr die Kraftlinien, die eine der
vielen Windungen aussendet, die benachbarten Windungen treffen und
dadurch in diesen Induktionsströme hervorrufen. Es fließt also hier der
induzierende und der induzierte Strom in einem und demselben Drahte.
Dabei ist die Richtung des[S. 159] induzierten Stromes, wie wir mit Hilfe der
Maxwellschen Regel feststellen können, beim Schließen des primären
Stromes diesem entgegengesetzt, beim Öffnen mit ihm gleichgerichtet.
Diese Tatsachen können wir durch ein sehr einfaches Experiment
erläutern. Wir verbinden den einen Pol einer Stromquelle mit
einer Blechplatte, den anderen mit einem spitzen Nagel, den wir
zur bequemeren Handhabung durch das vordere Ende eines Holzstabes
geschlagen haben. Wir drücken abwechselnd den Nagel auf das Blech und
heben ihn wieder ab. In dem Augenblick, in welchem sich die Spitze von
dem Blech entfernt, können wir das Auftreten eines kleinen Fünkchens
beobachten. Diese Erscheinung wird etwas verstärkt, wenn wir einen
der Verbindungsdrähte, statt ihn ausgestreckt zu lassen, auf einen
Bleistift aufwickeln; noch mehr verstärkt wird sie, wenn wir die
Drahtspulen z. B. eines Elektromagneten in den Stromkreis einschalten.
Der beim Schließen des Stromes entstehende Induktionsstrom ist, wie
man auch schon an dem viel kleineren Funken erkennt, schwächer —
da er dem Hauptstrom entgegenfließt — als der beim Öffnen
entstehende. Die beim Schließen und Öffnen auftretenden Funken nennt
man Schließungs- und Öffnungsfunken.
Diese Art von Induktion nennt man Selbstinduktion, die dabei
auftretenden Ströme Extraströme. Sie entstehen nicht nur beim
Öffnen und Schließen des Hauptstromes, sondern bei jeder Veränderung in
seiner Stärke oder Richtung.
Wirbelströme.
Wir wollen jetzt sehen, wie sich diese Ströme in Leitern verhalten, die
nicht die Gestalt eines Drahtes haben, z. B. in den Eisenankern von
Dynamomaschinen. Hier wären massive Eisenmassen der Induktionswirkung
derartig stark ausgesetzt, daß die darin auftretenden Induktionsströme,
die in diesem speziellen Fall Wirbelströme genannt werden, die
größten Verluste verursachen würden, weil sich dabei die zur Drehung
des Ankers aufgewandte Energie zum großen Teil statt in Elektrizität
in Wärme verwandeln würde. Es werden deshalb bei größeren Maschinen
die Anker nicht aus einem Stücke hergestellt, sondern quer zu der
Richtung der Wirbelströme[S. 160] unterbrochen, indem sie aus vielen dünnen
Eisenblechplättchen, die durch Papierscheiben voneinander isoliert
sind, zusammengesetzt werden.
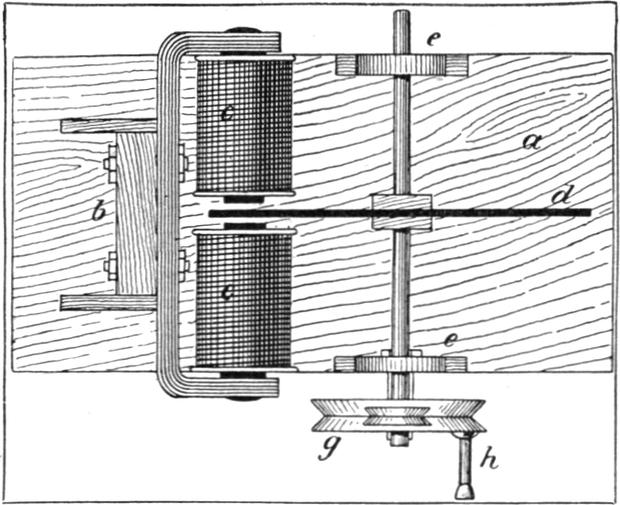
Abb. 133. Apparat zur Demonstration der Wirbelströme
(von oben gesehen).
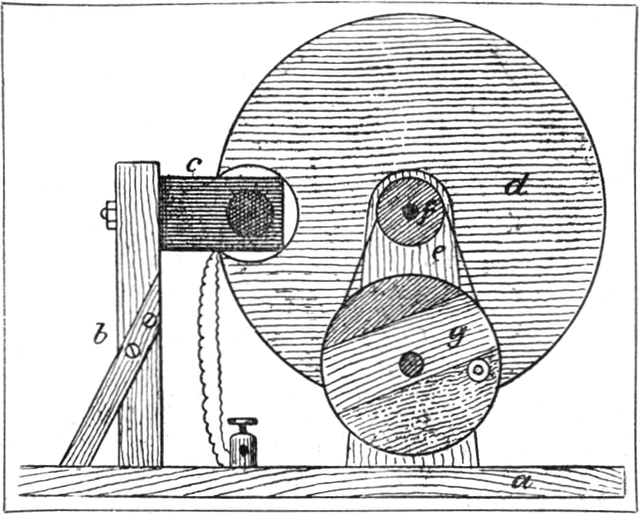
Abb. 134. Derselbe von der Seite gesehen.
Um zu zeigen, wie stark die Erwärmung von Leitern durch Wirbelströme
werden kann, können wir uns einen Apparat herstellen, den Abb. 133
von oben, Abb. 134 von der Seite zeigt. a ist ein starkes
Grundbrett; auf diesem ist an dem Gestell b der starke
Elektromagnet c befestigt. Die Form des Elektromagneten,
dessen Pole sich einander unmittelbar gegenüberstehen müssen, geht
zur Genüge aus der Abbildung hervor. Es sei nur erwähnt, daß der die
beiden Schenkel verbindende Bügel, da er ziemlich lang ist, recht stark
sein muß. Die Polenden sollen 4 bis höchstens 5 mm voneinander
abstehen. Zwischen den Polen soll sich der Rand einer 2 mm
starken Kupferscheibe d bewegen. Wir können auch ein anderes
Metall verwenden als Kupfer, das ziemlich teuer ist; nur Eisen ist
ungeeignet, da es von dem Magneten angezogen wird; wir[S. 161] müßten es ganz
genau in der Mitte zwischen den beiden Polen drehen, was aber nur sehr
schwer zu erreichen ist, da man selten eine völlig ebene Blechplatte
bekommen wird. Die Scheibe wird von einer Achse getragen, die in
Lagern auf den beiden Lagerträgern (e) ruht. Die Lager sind
wie üblich herzustellen (siehe Seite 22). An dem einen Ende der Achse
wird eine kleine Welle (f) angebracht und darunter ein großes
Übersetzungsrad (g), das mit einer Kurbel (h) versehen
wird und um eine in dem Lagerträger befestigte Achse gedreht werden
kann. Über das große und das kleine Triebrad wird eine starke Schnur
oder ein runder Riemen gelegt, der sehr straff angespannt sein muß.
Schicken wir nun durch den Elektromagneten einen starken Strom und
lassen die Scheibe rotieren, so werden wir zuerst wahrnehmen, daß die
Scheibe unserer Kraft einen umso größeren Widerstand entgegensetzt, je
rascher wir sie drehen wollen. Erhalten wir die Kupferscheibe längere
Zeit in möglichst rascher Rotation, so wird sie sich so stark erhitzen,
daß daraufgegossenes Wasser laut zischend verdampft.
Dämpfung.
Ein zweiter Versuch zeigt, daß diejenigen Ströme, die in einem sich
in einem magnetischen Felde bewegenden Leiter entstehen, stets so
gerichtet sind, daß sie diesen Leiter in der entgegengesetzten Richtung
zu bewegen streben. Dieses Gesetz ist zuerst von Lenz ausgesprochen
und nach ihm das Lenzsche Gesetz genannt worden. Um den Versuch
auszuführen, nehmen wir die Schnur von dem Triebrad und der kleinen
Welle herunter und versetzen, bevor der Elektromagnet erregt ist, die
Scheibe in rasche Rotation, indem wir das freie Achsenende zwischen
Daumen und Zeigefinger drehen. Wir werden jetzt längere Zeit warten
müssen, bis die Scheibe wieder zur Ruhe kommt; darauf drehen wir sie
nochmals an und schließen dann den Strom, der den Elektromagneten
erregt; fast sofort wird die Scheibe zur Ruhe kommen.
Diese Tatsache wird dazu benutzt, um die großen Schwingungszeiten der
Nadeln von empfindlichen Meßinstrumenten zu dämpfen, indem die
z. B. auf eine Drahtspule reagierenden Magnete sich zwischen massiven
Kupferplatten[S. 162] bewegen müssen, in denen sie bei ihrer Bewegung Ströme
induzieren, die sie — die Magnete — in entgegengesetzter Richtung zu
bewegen bestrebt sind. Dadurch wird ein zu langes Hin- und Herschwingen
verhindert.
Einfache Elektrisiermaschine.
Wir haben gesehen, daß in einer einfachen Drahtspule beim Öffnen und
Schließen des Stromes Induktionsströme entstehen, die so hoch gespannt
sind, daß sie sogar einen kleinen Luftwiderstand unter Bildung eines
Funkens überwinden können. Daß ein solcher Strom, wenn er durch den
menschlichen Körper geleitet wird, in diesem deutlich gefühlt werden
muß, ist ziemlich klar.
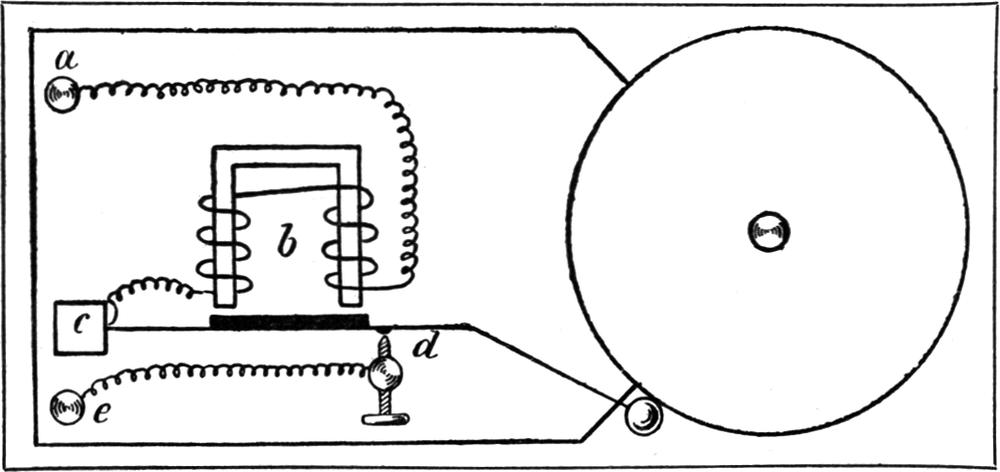
Abb. 135. Schema einer elektrischen Klingel.
Wir wollen nun sehen, wie wir eine einfache elektrische Klingel als
Elektrisiermaschine gebrauchen können. Wir verbinden die Klingel unter
Einschalten eines Kontaktknopfes wie üblich mit einer Stromquelle. Um
unnötiges Geräusch zu vermeiden, stopfen wir die Glockenschale mit
Papier aus. Die Stellschraube an der Kontaktfeder stellen wir so, daß
der Hammer sich möglichst rasch hin und her bewegt. Betrachten wir das
Schema einer elektrischen Klingel in Abb. Abb. 135, so fließt der Strom von
der Klemme a durch die Windungen des Elektromagneten b
nach c und durch die Feder und den Anker zur Kontaktspitze
d, von wo er über e zur Batterie zurückkehrt. Wird nun
der Anker angezogen und dadurch der Strom unterbrochen, so entsteht
bei d ein Öffnungsfunke; in diesem[S. 163] Augenblick muß also die
Spannungsdifferenz zwischen c und d sehr groß gewesen
sein. Schließen wir den Strom, so daß der Hammer ständig hin und her
schwingt, und berühren wir mit der einen Hand c, mit der anderen
d, so wird der Öffnungsstrom lieber den geringeren Widerstand
unseres Körpers als den großen Luftwiderstand bei d überwinden
und deshalb zum größten Teil unseren Körper durchfließen.
Wir können uns, um nicht immer c und d anfassen zu
müssen, aus zwei Messingrohrstücken Handeln machen. An dem einen
Ende des Rohres löten wir einen etwa 1 m langen isolierten
Kupferdraht fest und treiben auf der gleichen Seite einen Holzzapfen,
der als isolierender Griff dienen soll, in die Röhre. Die freien Enden
der Drähte werden dann mit c und d verbunden. Wollen wir
für weitere Versuche die Stärke des elektrisierenden Stromes verändern,
so müssen wir den Hauptstrom entsprechend regeln.
Der Induktionsapparat.
Der einfache Induktionsapparat dient dazu, Ströme niederer Spannung
in solche hoher Spannung umzuwandeln. Man kann deshalb auch einen
derartigen Apparat als Transformator bezeichnen.
Im wesentlichen kennen wir den Apparat schon aus dem vorigen Vortrag.
Er besteht aus einer inneren Drahtspule mit wenig Windungen eines
dicken Drahtes und aus einer äußeren mit sehr viel Windungen eines
dünnen Drahtes. Da, wie wir gesehen haben, die elektromotorische
Kraft des Induktionsstromes mit von der Zahl der Kraftlinien abhängt,
die ihn erzeugen, so wickeln wir den inneren, den primären Draht auf
einen Eisenkern auf. Damit in diesem keine schädlichen Wirbelströme
auftreten können, fertigen wir ihn nicht aus einem massiven Stück,
sondern setzen ihn aus einzelnen Drahtstücken zusammen. Wir verwenden
geglühten, oxydierten Eisendraht von 0,5 bis 1,5 mm Stärke.
Bevor wir den Draht in einzelne Stücke zerschneiden, müssen wir ihn
strecken, da sonst, wenn die Stäbchen verbogen und verbeult sind, in
dem Kerne unnütze Hohlräume entstehen. Zu diesem Zwecke befestigen
wir in einem langen Zimmer oder im Korridor etwa an[S. 164] einer Türklinke
das eine Drahtende; am anderen Ende des Raumes wickeln wir den Draht
einige Male um einen etwa fingerstarken Holzstab und ziehen nun, den
Stab mit beiden Händen umfassend, so lange und so stark an dem Draht,
bis er an irgend einer Stelle reißt. Man ziehe vorsichtig, daß man
beim Riß nicht zu Boden stürze. Den nun völlig geraden Draht läßt man
ausgestreckt am Boden liegen und schneidet ihn hier in die einzelnen
Stäbchen auseinander. Letztere werden mit dünner Schellacklösung
bestrichen, nach dem Trocknen zu einem Bündel zusammengelegt und fest
mit Leinenfaden in regelmäßig aneinanderliegenden Windungen umbunden.
Unmittelbar auf den Eisenkern, der auf beiden Seiten höchstens 0,5
mm frei bleiben soll, wird der primäre Draht in zwei bis vier
Lagen (genaueres über Drahtmaße siehe Seite 134 u. f.) und in einer
Stärke von 0,8 bis 2 mm möglichst regelmäßig aufgewunden. Das
Anbringen von Randscheiben ist gänzlich überflüssig und hindert nur
nachher beim Wickeln der sekundären Spule.
Nachdem die Enden des primären Drahtes durch Anbinden vor dem Aufrollen
bewahrt sind, wird die Spule mit zwei bis drei Lagen eines starken in
Schellack getränkten Papiers umgeben. Der Rand der Papierhülle soll auf
beiden Seiten genau mit der untersten Drahtlage abschneiden.
Sobald der Schellack getrocknet ist, können wir mit dem Wickeln
der sekundären Spule beginnen. Am geeignetsten ist ein möglichst
dünner mit Seide umsponnener Kupferdraht. Verwenden wir einen mit
Baumwolle isolierten Draht, so muß dieser während der Bewickelung mit
Schellacklösung bestrichen werden. Die einzelnen Windungen müssen
sauber und genau nebeneinander gelegt und jede Lage muß, bevor die
nächste darüber gewickelt wird, mit einem dünnen, in Schellack oder
heißes Paraffin getauchten Papier umgeben werden. Alle Lagen sollen
gleichviel Windungen haben, damit sie alle gleich lang sind. Die
dazwischen gelegten Papiere sollen auf jeder Seite 1 mm über die
äußerste Windung hinaussehen. Sollte beim Wickeln der Draht reißen,
oder werden von vorneherein[S. 165] mehrere Drähte verwendet, so dürfen die
Verbindungsstellen, die zu verlöten sind, nicht mitten in der Lage
sein, sondern sind an ihren äußersten Rand zu verlegen. Wir müssen
also den Draht, wenn er nicht zufällig aufgeht, da abschneiden, wo er
eine Lage beendet hat. Bei kleinen Apparaten, an die wir keine großen
Anforderungen stellen, braucht dieser Umstand nicht berücksichtigt zu
werden, und man kann den Draht sparen.
Die Spulmaschine.
Das Bewickeln führt man am besten mit der Hand aus. Es ist ein
zeitraubendes und mühsames Geschäft, namentlich wenn der Draht sehr
dünn ist; wir können es aber, die nötige Geduld vorausgesetzt, mit
der Hand pünktlicher machen, als mit einer Spulmaschine, die freilich
den großen Vorteil der Zeitersparnis für sich hat. Abb. 136 zeigt
eine solche Einrichtung. Die Spule, auf die wir aufwickeln, ist mit
c bezeichnet und sitzt fest auf einer aus starkem Eisendraht
hergestellten Kurbel. b ist die Rolle, von der der Draht
abgenommen wird; damit er immer straff gespannt bleibt, wird b
durch die Feder a gehemmt. Je breiter die Spule c, desto
größer muß ihr Abstand von b sein.
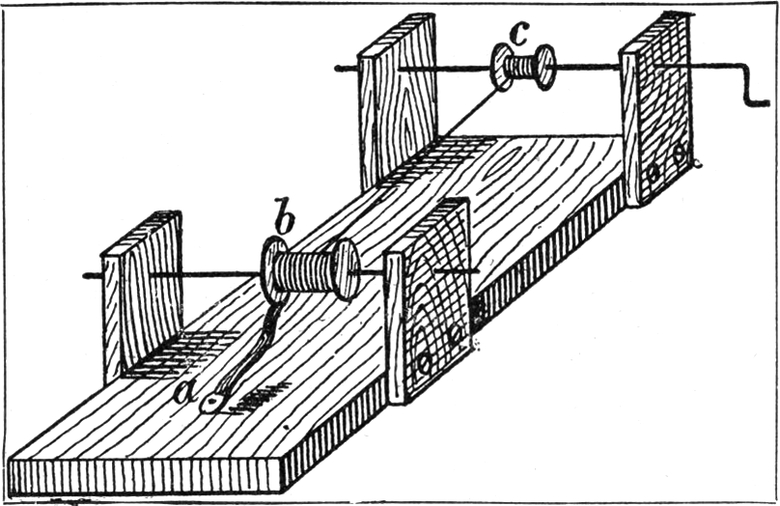
Abb. 136. Spulmaschine.
Ist auch die sekundäre Spule fertig gewickelt, so werden ihre beiden
Drahtenden vorläufig in der Mitte über der Rolle zusammengedreht.
Dann können die Randscheiben aus dünnem Holz oder aus schellackierter
Pappe angebracht werden. Diese Scheiben sitzen an den freien Enden des
Drahtkernes fest auf. Der etwa noch vorhandene[S. 166] Zwischenraum zwischen
ihnen und der Spule wird mit Paraffin ausgegossen. Ist dies erkaltet,
so umgeben wir die ganze Rolle mit einer Schutzhülle aus Karton, die
mit den Randscheiben abschneidet. Die Enden des die Hülle bildenden
Kartonstreifens werden zusammengeleimt oder durch Umwickeln mit einer
Lage Bindfaden zusammengehalten. Die Drahtenden der sekundären Spule
werden durch zwei Löcher in der Kartonhülle herausgeleitet.
In zwei quadratische Brettchen sägen wir je einen runden Ausschnitt,
der gerade so groß ist, daß wir die fertige Spule hindurchschieben
können. Auf einem Grundbrett von passender Größe werden diese beiden
Brettchen so befestigt, daß die durch die beiden Löcher geschobene
und hier angeleimte Spule auf beiden Seiten etwa 1 cm frei
herausragt. Auf den beiden Brettchen bringen wir zwei Klemmschrauben
an, mit denen wir die freien Enden des sekundären Drahtes verbinden.
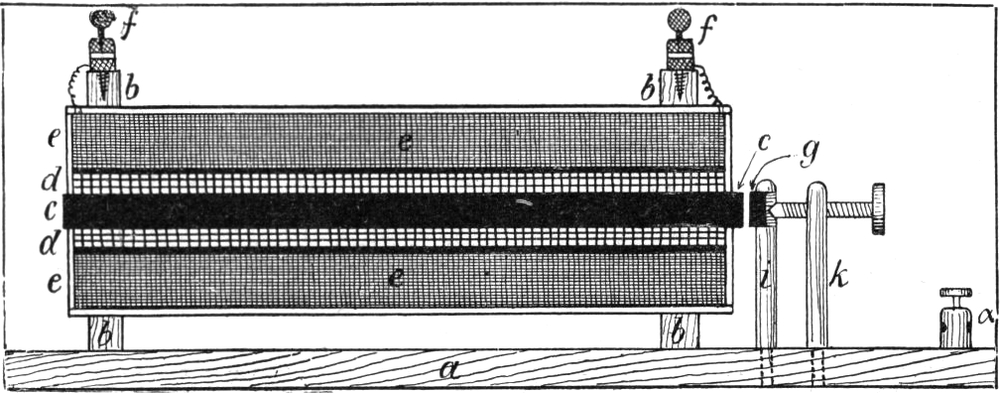
Abb. 137. Schnitt durch einen einfachen
Induktionsapparat.
Die Abb. 137 und 138 veranschaulichen diese Anordnung im Schnitt und
im Grundriß. a zeigt das Grundbrett, b die quadratischen
Brettchen, in deren runden Löchern die Spule ruht. c ist der
Eisenkern, d die primäre, e die sekundäre Wickelung und
mit f sind die beiden Klemmen bezeichnet.
Daß wir Induktionsströme erzeugen können, indem wir den primären
Strom abwechselnd schließen und öffnen, haben wir bereits gesehen.
Wir bringen deshalb an unserem Apparat eine Vorrichtung an, die
die Unterbrechung in regelmäßigen, sehr rasch aufeinanderfolgenden
Intervallen selbsttätig ausführt. Eine solche Einrichtung kennen[S. 167]
wir schon von der elektrischen Klingel her (Seite 113). Die von der
Klingelkonstruktion kaum abweichende Form des Unterbrechers
an unserem Induktionsapparat ist aus den beiden Figuren zu erkennen:
g ist ein Eisenanker, der an der Feder h angelötet ist;
letztere ist an der Messingsäule i so befestigt, daß g
gerade vor dem Eisendrahtkern steht, und zwar in einem Abstande von 2
bis 3 mm. k ist die in einer Messingsäule verschraubbare
Stellschraube, die mit einer Kontaktspitze aus Platin versehen ist.
Wie die Enden des primären Drahtes mit den Klemmen α und β verbunden
werden, ist aus der Abb. 138 ersichtlich.
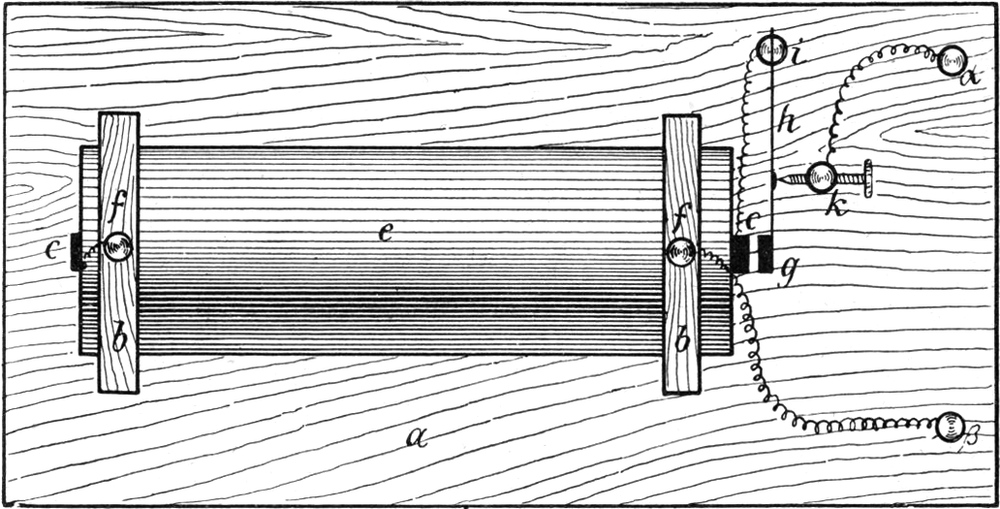
Abb. 138. Einfacher Induktionsapparat von oben gesehen.
Bei diesem Apparat können wir die Stärke des Induktionsstromes nicht
unmittelbar regeln. Da es jedoch oft von Vorteil ist, diese je nach
Bedarf ändern zu können, so sei weiterhin noch eine andere Form der
Elektrisiermaschine beschrieben, die auch für die Ausführung der oben
schon beschriebenen Versuche (Seite 137 u. f.) sehr praktisch ist.
Der Hauptunterschied gegenüber dem zuvor angeführten Apparat besteht
darin, daß die sekundäre Spule beweglich ist. In Abb. 139 bezeichnen
die gleichen Buchstaben wieder die gleichen Teile wie in den beiden
vorhergehenden Abbildungen. Der Eisenkern c ist nach rechts
1,5 bis 2 cm länger als die primäre Spule d, mit der
er links eben abschneidet. Er ist in dem starken Brettchen b
so befestigt, daß er mit seiner[S. 168] Bewickelung nach links hinausragt.
Die sekundäre Spule e wird auf eine Kartonhülle aufgewickelt,
die glatt über d paßt. Sie wird wie oben mit Randscheiben und
einer Schutzhülle aus Karton versehen und auf dem Brettchen l
angeleimt, das so dick ist, daß, wenn es auf a aufliegt, die
darauf befestigte sekundäre Spule über die primäre geschoben werden
kann. Rechts und links von dem Brettchen l sind Leistchen auf
a anzunageln, damit es in der dadurch entstandenen Rinne Führung
hat und ohne Beschädigung der Spulen hin und her geschoben werden kann.
Der Unterbrecher wird hergestellt, wie oben schon beschrieben.
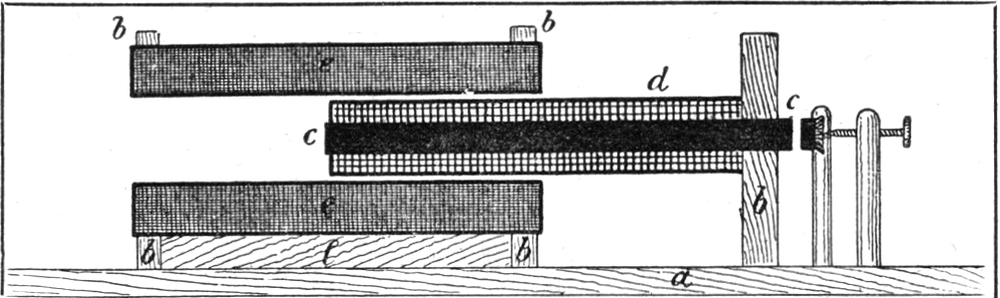
Abb. 139. Induktor mit verschiebbarer sekundärer Rolle.
Es ist klar, daß der Induktionsstrom umso schwächer wird, je weiter
wir die sekundäre Spule herausziehen; wir können also durch ihr Hin-
und Herschieben die Stärke des sekundären Stromes ohne Abänderung des
primären regeln.
Schrauben wir die Stellschraube des Unterbrechers so weit nach vorn,
daß der Anker am Eisenkern fest anliegt, so kann keine Unterbrechung
des Stromes mehr stattfinden. Bewegen wir jetzt die sekundäre Spule hin
und her, so erhalten wir, wie wir schon im dritten Vortrag (Seite 137
u. f.) sahen, ebenfalls Induktionsströme.
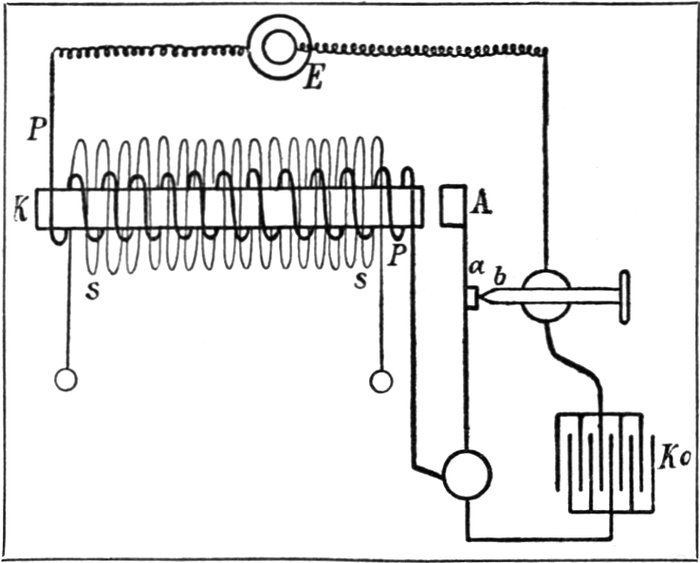
Abb. 140. Schaltungsschema des Kondensators.
Der Funkeninduktor.
Der Kondensator.
Wir wissen, daß die Spannung des Induktionsstromes mit von der
Geschwindigkeit abhängt, mit welcher der erregende Strom unterbrochen
wird. Ferner wissen wir, daß an der Unterbrechungsstelle jeweils ein
Funke auftritt, wenn der Strom geöffnet wird. Das Auftreten des Funkens
zeigt uns aber, daß der Strom nicht plötzlich unterbrochen wird, das
heißt nicht in der kurzen Zeit von seinem normalen Wert auf 0
[S. 169]
herabsinkt, in der die tatsächliche Trennung des Leiters erfolgt,
sondern daß er infolge der Selbstinduktion den Luftzwischenraum anfangs
überwindend, nur allmählich schwächer wird, bis er ganz unterbrochen
ist. Wollen wir also die Wirkung eines Induktionsapparates verstärken,
so müssen wir danach trachten, den Funken an der Unterbrecherstelle
möglichst zu verkleinern. Wir betrachten das Schema Abb. 140, in
welchem K den Eisenkern, P die primäre, s die
sekundäre Wickelung, E die Stromquelle, A den Eisenanker
und ab die Unterbrecherstelle bezeichnet. Wenn wir den
zwischen a und b entstehenden Funken verkleinern wollen,
so müssen wir die Spannungsdifferenz dieser Punkte verringern, was
wir dadurch erreichen, daß wir ihre Kapazität vergrößern, indem wir
einen Kondensator (Ko) an sie anschließen, wie das auf der Abb.
140 zu ersehen ist. Der Kondensator muß eine große wirksame Fläche
haben und wird deshalb aus einzelnen Stanniolblättern hergestellt,
die durch Papier voneinander isoliert sind. Er wird in einem Kasten
untergebracht, der zugleich die Grundlage für die Induktorrolle
bildet, und von der Größe dieser hängen auch die Maße des Kastens
ab. Die isolierenden Papierblätter schneiden wir aus nicht zu dünnem
Seidenpapier (oder dünnem Paraffinpapier) so groß, daß sie mit etwa 0,5
cm Spielraum in dem Kasten Platz finden. Die Stanniolblätter
müssen 1 bis 2 cm kleiner sein als die Papiere und auf einer
Seite einen 4 bis 5 cm langen Fortsatz haben (siehe Abb. 141).
Um die Isolierfähigkeit[S. 170] der Seidenpapiere zu erhöhen, werden sie in
Schellacklösung gebadet. In ein flaches Gefäß, etwa eine hinreichend
große Entwicklungsschale, wie sie in der Photographie gebraucht
werden, gießen wir den Schellack. Die zugeschnittenen Seidenpapiere
werden dann einzeln durch die Lösung durchgezogen und mit je zwei
Stecknadeln an einer ausgespannten Schnur zum Trocknen aufgehängt.
Danach werden die Stanniolblätter, durch die schellackierten Papiere
voneinander getrennt, so aufeinandergelegt, daß beim ersten der
Fortsatz nach rechts, beim zweiten nach links, beim dritten wieder
nach rechts u. s. w. herausragt, wie dies in Abb. 141 zu sehen ist.
Den fertigen Kondensator zeigt Abb. 142 A. Um die Fortsätze
der Stanniolblätter fest zusammenzuhalten und gut mit einem Draht
verbinden zu können, biegen wir uns aus Messingblech eine Klammer
a (Abb. 142 B) und versehen sie mit einem Muttergewinde
und einer Schraube b. Damit sich letztere beim Zusammenklemmen
der Fortsätze nicht in das Stanniol einbohrt, wird das Blechstückchen
c dazwischen gelegt.
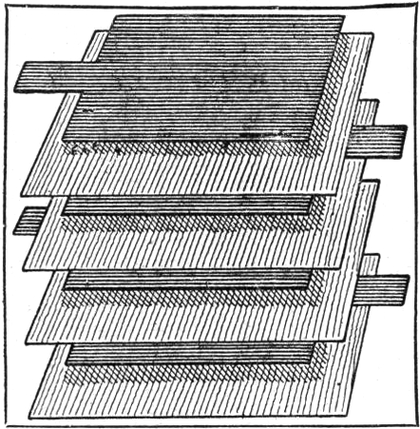
Abb. 141. Lage der Stanniolblätter mit ihren Ansätzen.
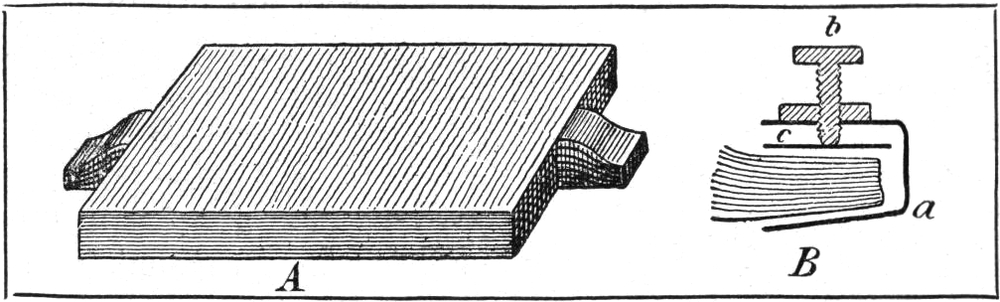
Abb. 142. Der fertige Kondensator.
Da der Kondensator aber nicht nur die Unterbrecherfunken abzuschwächen,
sondern auch oszillatorische Schwingungen zu erzeugen hat, muß die
Größe seiner Kapazität in einem bestimmten Verhältnis zu der Größe
des ganzen Apparates stehen; die günstigste Bemessung findet man,
wenn man zuerst nur wenig Blätter in den Kondensator legt und die
damit erzielte[S. 171] Funkenlänge des Induktors mißt. Darauf legt man einige
Blätter mehr ein und mißt — natürlich unter sonst gleichen Bedingungen
— wieder die Funkenlänge. Ist sie größer geworden, so legt man noch
mehr Blätter ein u. s. f., bis die Länge der Funken wieder abnimmt.
Als Anhaltspunkt mag folgendes dienen: nehmen wir an, die Länge der
Stanniolblätter verhielte sich zur Breite wie 3⁄5 zu 2⁄5 und sie seien
jeweils so lang wie die Induktorrolle, so mögen für kleine Apparate 30
bis 40 Blätter genügen, für größere wird sich deren Zahl auf 200 bis
250 belaufen. Wie der Kondensator einzuschalten ist, wurde oben schon
besprochen.
Solche Induktionsapparate, die mit Kondensatoren versehen sind, nennt
man Funkeninduktoren, da man ziemlich starke Funken mit ihnen erzeugen
kann; häufig werden sie auch mit dem Namen ihres ersten Erbauers
Ruhmkorff bezeichnet.
Je größer wir die Funkeninduktoren bauen, desto mehr Sorgfalt ist auf
die Isolierung der einzelnen Windungen und besonders der einzelnen
Lagen zu verwenden. Denken wir uns einen Leiter, der gewissermaßen
selbst elektromotorisch tätig ist, wie z. B. ein Element, so ist die
Spannungsdifferenz zweier seiner Punkte um so größer, je weiter die
Punkte von der Mitte entfernt sind (siehe Seite 106 u. f.). Ein solcher
Leiter ist z. B. der sekundäre Draht eines Induktionsapparates. Ein
Punkt des Drahtes in einer Lage ist von dem direkt über ihm liegenden
Punkt des Drahtes in der nächsten Lage nur um einen Bruchteil eines
Millimeters durch das jede Lage bedeckende Papier getrennt; da sich
zwischen zwei solchen Punkten eine große Anzahl wirksamer Windungen
befindet, so kann je nach der Größe des Apparates eine recht
beträchtliche Potentialdifferenz zwischen diesen Punkten auftreten, die
unter Umständen stark genug ist, die Isolierung zu durchschlagen und
damit den Apparat sehr zu schädigen. Wir müssen deshalb bei Induktoren,
deren Spulenmaße 10 bis 12 cm in der Länge und 5 cm
im Durchmesser übersteigen, schon stärkeres Papier, das tüchtig mit
Schellack oder heißem Paraffin zu bestreichen ist, zur Isolierung der
einzelnen Lagen anwenden. Bei größeren Apparaten soll zur Isolierung
ausschließlich reines Paraffin, das in sauberen Gefäßen
flüssig zu machen ist, angewendet werden.
[S. 172]
Sollen die Funkeninduktoren für eine Funkenlänge von zehn oder noch
mehr Zentimeter gebaut werden, so genügt diese einfache Art der
Isolierung auch nicht mehr. In diesem Falle müssen wir die Spule in
zwei Teilen herstellen, die durch einen mehrere Zentimeter breiten
Zwischenraum voneinander getrennt sind. Abb. 143 zeigt den Schnitt
durch die Rolle eines solchen Apparates. Die Drahtenden der beiden
Spulen e₁ und e₂ sind natürlich so miteinander zu
verbinden, daß ein die Windungen durchfließender Strom den Kern stets
in gleicher Richtung umkreist.
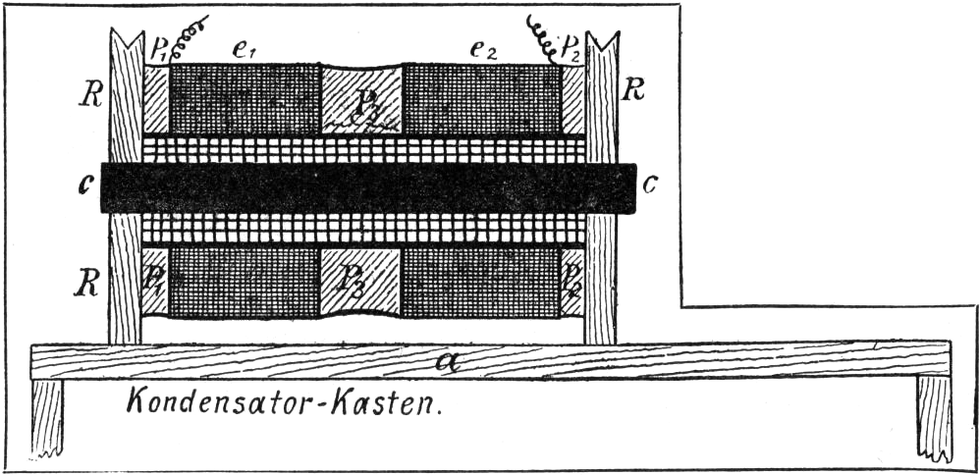
Abb. 143. Schnitt durch die Rolle eines Funkeninduktors.
Ferner dürfen wir bei diesen größeren Induktoren die Befestigung der
Spule nicht mehr in der oben beschriebenen Weise mit den Holzrähmchen
(b) bewerkstelligen, sondern wir müssen, wie aus Abb. 143
hervorgeht, unter entsprechender Verlängerung des Eisenkerns die
Randscheiben R aus Holz herstellen. Sie müssen fest auf dem
Kern aufsitzen und mindestens 5 mm von der Spule abstehen. Ihr
Durchmesser sei um 2 cm größer als der der Spule.
Es müssen jetzt noch die Zwischenräume, die in Abb. 143 mit P
bezeichnet sind, mit Paraffin ausgegossen werden. Wir legen um die
Spule herum einen Kartonstreifen, der so groß ist, daß er beiderseits
fest an den Randscheiben R anliegt, aber die Spule nicht ganz
umschließt, sondern oben einen 1 cm breiten Spalt freiläßt,
durch welchen das Paraffin in die Hohlräume P₁, P₂
und P₃ eingegossen wird. Nach Erkalten des Gusses wird
der Karton wieder entfernt, da bei diesen größeren Apparaten die
Schutzhülle aus einem besser isolierenden Material hergestellt werden
muß. Am[S. 173] geeignetsten ist ein Überzug aus gutem Seidenstoff oder aus
einer dünnen Hartgummiplatte, die in kochendem Wasser weich gemacht
und dann solange als sie noch heiß und biegsam ist, um die Spule
herumgelegt wird. Entlang der zusammenstoßenden Ränder der Ebonitplatte
werden schon vor ihrem Erhitzen mit einem glühenden Nagel Löcher
eingebrannt, durch die jetzt ein Seidenband genestelt wird, damit es
die Hülle zusammenhält.
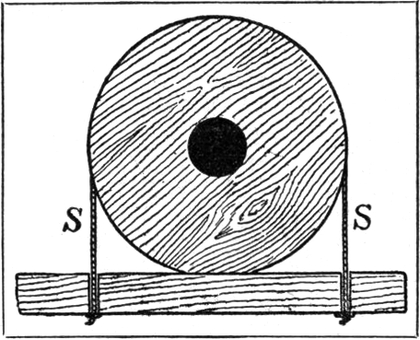
Abb. 144. Befestigung der Induktorrolle.
Wie schon erwähnt, bildet der Kasten, in dem der Kondensator
untergebracht wird, zugleich die Grundlage für die Induktorrolle. Um
dieser einen sicheren Halt zu geben, werden die hölzernen Randscheiben
(R) auf der Unterseite etwas abgeflacht und von der Innenseite
des Kastens angeschraubt. Für sehr große und schwere Apparate dürfte
sich die in Abb. 144 dargestellte Befestigungsart am meisten empfehlen.
Die Randscheiben erhalten auf ihrem Umfange eine Furche, wie auch auf
Abb. 143 ersichtlich, durch die eine starke Saite läuft (S
in Abb. 144); diese geht durch entsprechende Löcher in dem Deckel
(a) des Kastens hindurch und wird innen verknotet.
Isoliermethode bei grösseren Induktoren.
Für Apparate, die Funken von 15 cm Länge und mehr liefern
sollen, genügt es nicht, die sekundäre Wickelung in zwei oder
vielleicht auch drei Spulen zu trennen, sondern wir müssen uns etwa
20 bis 30 einzelne ganz flache Spulen herstellen, die die Form von
Scheiben mit einer Dicke von 0,5 bis 1 cm und einen Durchmesser
von 8 bis 16 cm haben. Zum Wickeln der Scheiben müssen wir uns
eine besondere Einrichtung herstellen. Zuerst fertigen wir auf der
Drehbank eine Holzwalze, deren Durchmesser gleich dem der mit starkem
Papier umwickelten primären Spule ist. Zwei Holzscheiben, die je auf
einer Seite völlig eben sein müssen — man stellt sie am besten auf
der Drehbank her — sind in der Mitte durchbohrt, so[S. 174] daß sie knapp
passend auf die Holzwalze aufgeschoben werden können. Jetzt schneiden
wir uns einen Kartonstreifen, der 5 mm breit und so lang ist,
daß seine Enden, wenn er um die Holzwalze herumgelegt wird, gerade
zusammenstoßen. Mit einem Papierstreifen leimen wir die Enden des
Kartons zusammen und achten darauf, daß dieser selbst nicht an der
Walze kleben bleibt. Nun werden die beiden Scheiben von rechts und
links auf die Walze geschoben, so daß der Kartonring zwischen sie zu
liegen kommt; die Scheiben werden fest an ihn angepreßt und mit ein
paar in die Walze geschlagenen Nägeln oder mit Klammern festgehalten.
Vorher mußten wir jedoch noch in jede Scheibe möglichst nahe des
mittleren großen Loches ein kleines von 1 bis 2 mm Weite bohren.
Bevor wir nun die zweite Scheibe auf die Holzwalze schieben, führen
wir das Ende des aufzuwindenden Drahtes durch dieses kleine Loch, so
daß ein Stück von etwa 10 cm Länge herausragt und mit einem
Reißnagel an der Holzwalze befestigt werden kann. Die Spulmaschine
ist ähnlich herzustellen wie die auf Seite 165 abgebildete; die
abgeänderte Einrichtung ist aus Abb. 145 zu erkennen, wo mit a
das Grundbrett, mit b das Lagerbrett, das oben mit einem
Einschnitt für die Holzwalze versehen ist, mit c der Träger der
Spule d, von der der Draht abgenommen wird, mit e die
Holzscheibe, und mit f die an d schleifende Bremsfeder
bezeichnet ist. Eine Kurbel ist überflüssig, da wir die dicke Holzwalze
bequem selbst anfassen und drehen können.
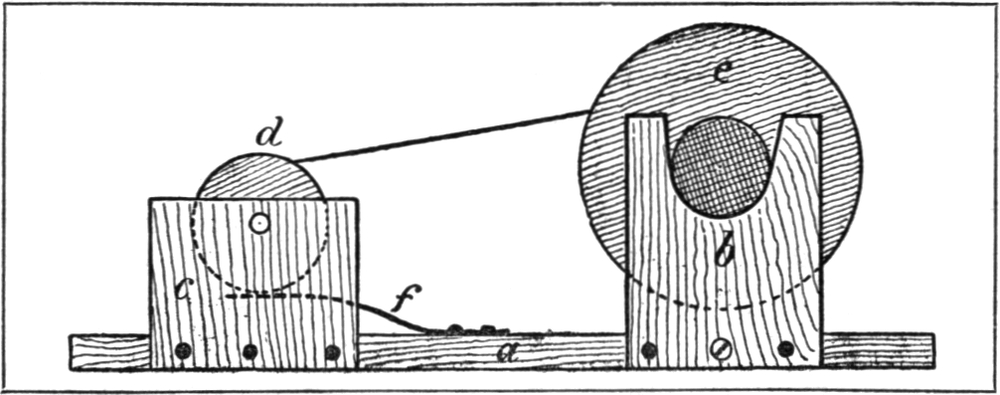
Abb. 145. Spulmaschine für den Funkeninduktor.
Wenn wir mit dem Bewickeln beginnen wollen, so[S. 175] stellen wir auf einen
Spiritusbrenner ein Gefäß mit siedendem Paraffin hart neben die
Spulmaschine und richten uns einen Pinsel her, der so schmal und lang
ist, daß man mit ihm zwischen den beiden Holzscheiben bis auf die
Holzwalze reichen kann. Mit diesem Pinsel tragen wir Paraffin auf den
zwischen den Scheiben liegenden Ring auf, doch nicht zu viel, damit die
Unterlage für die erste Wickelung nicht uneben wird. Jetzt beginnen wir
mit dem Aufspulen des Drahtes. Jede Lage, die aus 20 bis 30 Windungen
bestehen wird, soll mit einer dünnen Schicht von heißem Paraffin
überstrichen werden. Nach jeweils fünf oder sechs Lagen, so lange die
Windungen dem Kern noch nahe und somit klein sind, bei den mittleren
Windungen nach je drei, bei den äußersten nach je einer Lage, schalten
wir einen Streifen dünnen, paraffinierten Papiers ein.
Wie aus Abb. 150 zu ersehen ist, soll der Durchmesser der nach den
Spulenenden zu liegenden Scheiben kleiner sein, als der der in der
Mitte liegenden. Ist eine Spule fertig gewickelt, so wird zuletzt
noch soviel Paraffin aufgestrichen, daß die oberste Drahtlage noch 1
mm hoch überdeckt ist.
Sollten sich während des Bewickelns durch das Bestreichen mit Paraffin
Unebenheiten einstellen und die einzelnen Windungen nicht mehr genau
nebeneinander legen lassen, so braucht uns das weiter keine Sorge zu
machen; wir wickeln dann regellos unter reichlicher Zugabe von Paraffin
einige Lagen auf, winden einen paraffinierten Papierstreifen mehrmals
darüber, wickeln wieder einige Lagen, schalten wieder Papier ein und
so fort. Das sorgfältige, regelmäßige Wickeln hat nur den Vorteil
einer geringen Raumersparnis, den wir mit einem recht beträchtlichen
Zeitverlust ziemlich teuer bezahlen müssen. Bei schlecht isolierten
Drähten, z. B. solchen, die nur einmal mit Baumwolle umsponnen sind,
ist es freilich doch sehr zu empfehlen, die Bewickelung möglichst
regelmäßig auszuführen, da sich sonst einige Kurzschlußstellen bilden
und bei größerer Zahl dem Apparat recht schädlich werden könnten.
Nach Erkalten des letzten Paraffingusses werden die Holzscheiben
entfernt. Sollte dies mit Schwierigkeiten verbunden[S. 176] sein, so kann
man durch Beklopfen mit dem Hammer etwas nachhelfen. Dem Übelstande
des Haftenbleibens können wir auch dadurch vorbeugen, daß wir die
Innenseiten der Holzscheiben mit passenden, in Schellacklösung
getränkten und gut getrockneten Papierscheiben belegen. An der Spule
bleibt dann das Papier haften, während sich das Holz leicht löst; aber
auch das Papier muß dann wieder sorgfältig, eventuell durch Befeuchten
mit reinem Alkohol entfernt werden.
In dieser Weise werden alle Spulen hergestellt. Dabei ist aber auf
eines besonders zu achten. Bei der einen Hälfte aller Drahtscheiben
beginnen wir mit der ersten Windung auf der rechten Seite,
lassen also das Drahtende zu dem kleinen Loch der rechten
Scheibe heraussehen und hören mit der letzten Windung auf der
linken Seite auf; diese Spulen werden im folgenden mit I
bezeichnet. Bei den Spulen der anderen Hälfte, die mit II bezeichnet
sind, beginnen wir links und hören rechts auf.
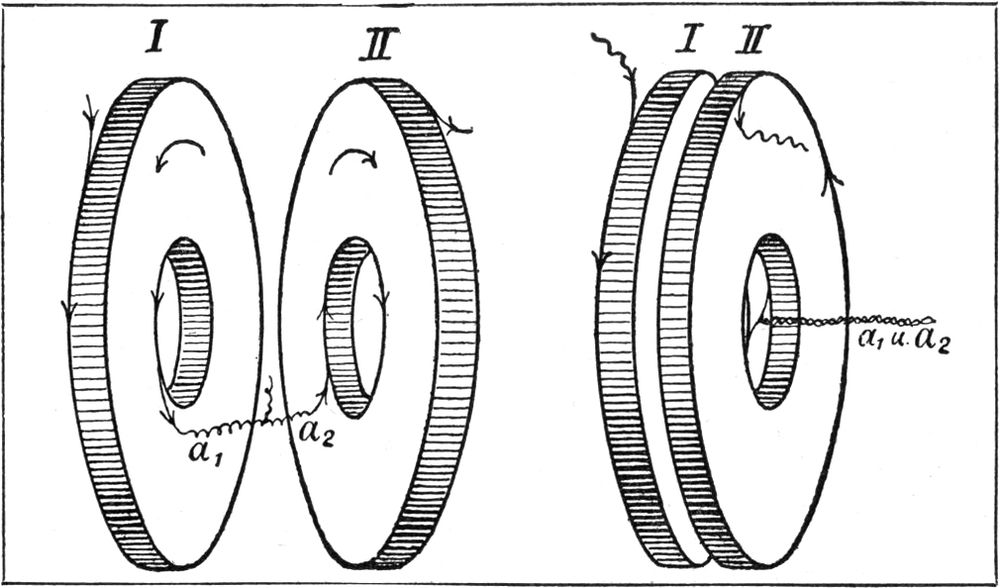
Abb. 146. Abb. 147
Verbindung der einzelnen Spulen.
Es handelt sich nun darum, alle die einzelnen Spulen auf die primäre
Rolle aufzuschieben und ihre Drahtenden in gute leitende Verbindung zu
bringen. Wir legen je eine Spule I und eine Spule II so aufeinander
(siehe Abb. 146), daß die inneren Drahtenden a₁ und
a₂, die[S. 177] vorher vollständig von ihrer Isolierung befreit
wurden, aufeinander zu liegen kommen; die Enden selbst führen wir, wie
Abb. 147 zeigt, nach rechts zu dem Loche der Spule hinaus und drehen
sie so weit fest zusammen, daß wir die Drahtscheiben nachher
noch 3 bis 5 mm voneinander entfernen können. Darauf wird
der überschüssige Draht abgeschnitten, so daß die zusammengedrehten
Enden, die noch verlötet werden müssen, nur ein kleines Stümpfchen
bilden. Letzteres wird mit einem kleinen Tropfen Lötwasser, das völlig
säurefrei sein muß — man setze zur Vorsicht noch etwas Salmiaksalz
zu — versehen; ein kleines Stückchen Lötzinn, das wir papierdünn
gehämmert haben, wird auf die Drahtenden gelegt und mit einem 3 bis 4
mm dicken glühenden, auf Salmiak von der Oxydschicht gereinigten
Kupferdraht berührt, worauf es zwischen den Drähten verfließt. Das
verlötete Ende wird zwischen den Spulen so nach außen gerichtet, wie
das aus Abb. 148 ersehen ist. In gleicher Weise werden sämtliche
Spulen I und II miteinander verbunden, und dann die einzelnen Paare
auf die primäre Rolle aufgeschoben, alle freien Drahtenden nach
oben gerichtet. Jede der Spulen soll von der nächsten einen 3 bis
5 mm breiten Abstand haben, und die dadurch entstehenden
Hohlräume müssen mit Paraffin ausgegossen werden, nachdem die hölzernen
Randscheiben in der oben beschriebenen Weise befestigt wurden (Seite
172).
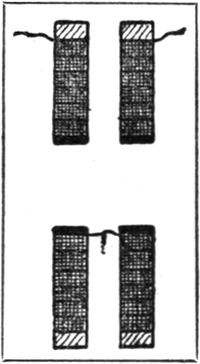
Abb. 148. Verbindung zweier Spulen.
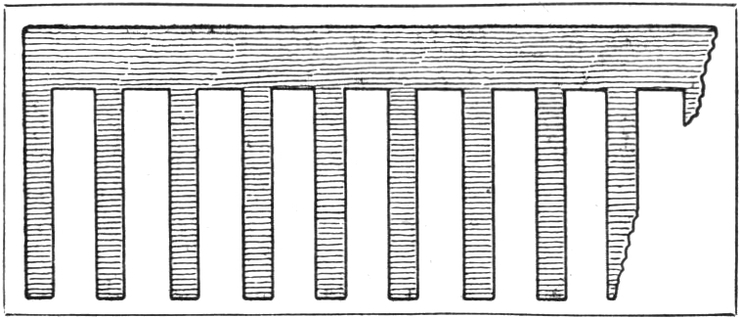
Abb. 149. Kartonkamm zum Einrichten der Spulen.
Um diese Arbeit genau ausführen zu können, fertigen wir uns ein
kammartiges Gebilde aus starkem Karton oder Pappendeckel (Abb. 149),
dessen Zähne eine Breite von 5 mm und eine Länge haben, die
gleich dem Durchmesser[S. 178] der Drahtscheiben ist; die Zwischenräume
zwischen den Zähnen sind gleich der Dicke der Drahtscheiben. Ferner
richten wir uns einen Karton, der so groß ist, daß er, um die Rollen
herumgelegt, an den hölzernen Randscheiben fest anliegt, aber oben
nicht schließt, sondern einen zum Eingießen des Paraffins genügend
breiten Spalt frei läßt. Bevor wir jedoch diesen Kartonmantel
befestigen, legen wir die Zähne unseres Kammes zwischen die
Drahtrollen, so daß alle genau in gleichem Abstande und parallel
nebeneinander liegen. Dann erst wird der Karton herumgelegt und mit
einer Schnur mehrfach fest umwickelt. Die Drahtenden müssen alle zu dem
freigelassenen Spalt heraussehen. Jetzt kann der Kamm herausgenommen
und das Paraffin eingegossen werden. Nach dem Erkalten des Gusses wird
der Kartonmantel abgenommen, die freien Drahtenden werden verlötet und
im übrigen wird verfahren, wie oben (Seite 172) schon beschrieben wurde.
Für größere Induktoren seien außer dem Gesagten noch einige besondere
Winke gegeben. 1. Da das Verhältnis der sekundären Rollenlänge zur
Länge des Eisenkernes mit der primären Wickelung nicht einerlei ist, so
ist es ratsam, sich die im Verhältnis zur übrigen Arbeit kleine Mühe
zu machen, etwa 3 bis 5 verschieden lange Primärrollen herzustellen.
Die Sekundärspule wird dann am besten auf ein Hartgummi-, eventuell auch
Glasrohr aufmontiert, in das die Primärspulen gerade hineinpassen.
Die beste Wirkung wird ausprobiert. Ist dann die größte oder die
kleinste Spule die beste, so machen wir uns noch eine größere resp.
kleinere. Als Ausgang für die Bemessungen dienen die in Abb. 150
dargestellten Verhältnisse. (In Abb. 150 sind die einzelnen Scheiben
der Deutlichkeit wegen dicker und daher in etwas geringerer Anzahl
gezeichnet.) Als Ergänzung für die allgemeine Tabelle auf Seite 182
dienen die folgenden Angaben speziell für die oben beschriebene
Wickelungsart. Endlich muß bei solchen Apparaten die Isolation noch
sorgfältiger hergestellt werden. Als isolierende Masse genügt auch
hier reines Paraffin; besser ist es, wenn man 4 Teile Kolophonium
schmilzt und darin 4 Teile Bienenwachs und 2 Teile Guttapercha löst.
An Stelle des oben beschriebenen[S. 179] Kartonmantels wird jetzt ein ganz
geschlossener Blechmantel gelegt; die Längsnaht wird verlötet und
gegen die Randscheibe mit Glaserkitt oder einer Mischung aus Asbest
und Wasserglas abgedichtet. In dem Blechmantel müssen zwei Löcher
vorgesehen sein; durch das eine wird die Isoliermasse eingegossen,
wobei die Luft durch das andere Austritt findet. Ist der Raum, der
in Abb. 150 schwarz angelegt ist, ganz ausgefüllt, so wird das eine
Loch in dem Mantel mit einem Kork verschlossen; in das andere wird
mit einem durchbohrten Kork ein Glasrohr angesetzt, das man mit einer
Wasserstrahlsaugpumpe verbindet. Während man den Blechmantel möglichst
gleichmäßig (durch eine größere Anzahl kleinerer Flämmchen) auf
115 bis 120° erhitzt, saugt man mit der Strahlpumpe die Luft ab. Das
Verfahren soll 24 Stunden ununterbrochen fortdauern; es hat den Zweck,
die sehr schädlichen Luftreste aus der Isoliermasse zu entfernen.
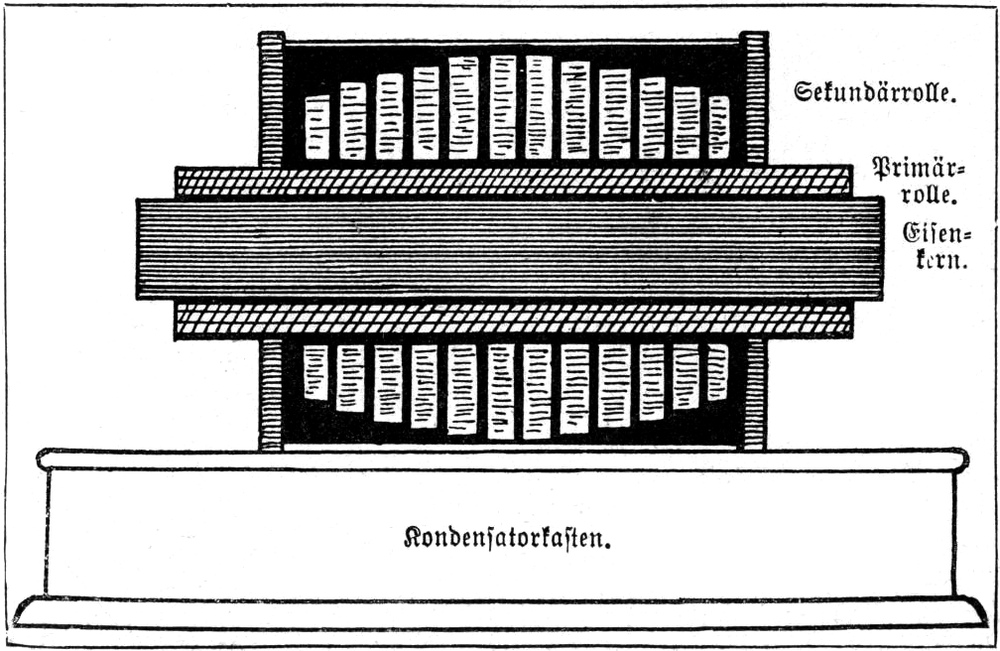
Abb. 150. Schematischer Schnitt durch einen großen
Funkeninduktor.
Die Klemmschrauben, an die die Drahtenden der sekundären Wickelung
geführt werden, dürfen keine Kanten, sondern müssen möglichst runde
Formen haben, da, wie wir im ersten Kapitel schon sahen, hochgespannte
Elektrizität aus Spitzen und scharfen Kanten leicht ausströmt (siehe[S. 180]
Seite 44). Bei den größeren Apparaten ist es auch vorteilhaft, die
Klemmen nicht auf die Randscheiben aufzuschrauben, sondern auf zwei
Glassäulen zu befestigen, die wir neben der Induktorrolle in das
Grundbrett eingelassen haben.
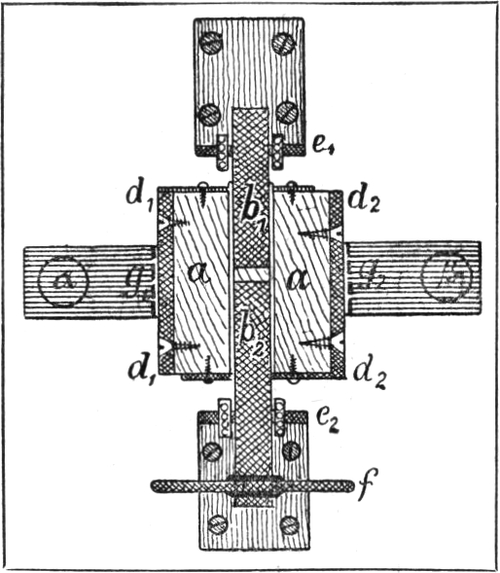
Abb. 151. Kommutator (Horizontalschnitt).
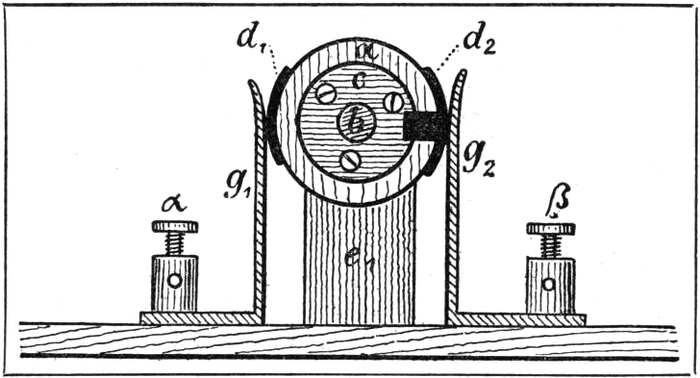
Abb. 152. Kommutator (Vertikalschnitt).
Ferner ist es vorteilhaft, auf dem Apparat noch einen Kommutator
anzubringen; wir können ihn wie den auf Seite 101 beschriebenen
herstellen. Geeigneter ist der im folgenden beschriebene Stromwender,
der zugleich auch als Ausschalter dient. Eine Holzwalze a
(Abb. 151 und 152) wird der Länge nach durchbohrt; zwei Achsenhälften
b werden von rechts und links in die Bohrung hineingeschoben,
dürfen aber einander innen nicht berühren. Wie sie befestigt werden,
geht aus Abb. 153 hervor: wir löten an b ein Messingscheibchen
c an, das an a angeschraubt wird. Die eine Achsenhälfte
(b₂) wird am Ende quer durchbohrt, und in dem Loch wird der
dünnere Messingstift f, der als Griff dient, angelötet. Nun
werden an a auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten die
Kupferblechstreifen d angeschraubt; der Streifen d₁
wird mit b₁ und b₂ mit d₂ in leitende
Verbindung gebracht. Die Lagerträger e verfertigen wir aus
starkem Messingblech und die Lager selbst, welche hier nicht geölt
werden dürfen, in der bekannten Weise (Seite 22).[S. 181] Zwei kupferne
Schleiffedern g werden so auf dem Grundbrett angeschraubt,
daß sie rechts und links an der Walze a schleifen. Jetzt
verbinden wir e₁ mit der Kontaktspitze des Unterbrechers
und e₂ mit dem freien Ende der primären Wickelung durch
dicke Kupferdrähte oder Kupferblechstreifen. Die Verbindungsstellen
sind zu verlöten. Auf den Federstreifen e₁ und e₂
ist je eine Klemmschraube (α und β) anzulöten. Steht nun die Walze
a wie in Abb. 151, so tritt der Strom bei α ein und geht
durch d₁, b₁ nach e₁, durch den
Unterbrecher in den Apparat und kommt durch e₂, b₂,
d₂ und β zurück. Drehe ich a um 90°, so ist der Strom
ausgeschaltet; drehen wir in der gleichen Richtung nochmals um 90°, so
geht der Strom von α zuerst nach d₂, e₂ und kommt
durch e₁, d₁ nach β zurück, durchfließt also den
Apparat in umgekehrter Richtung wie vorhin.
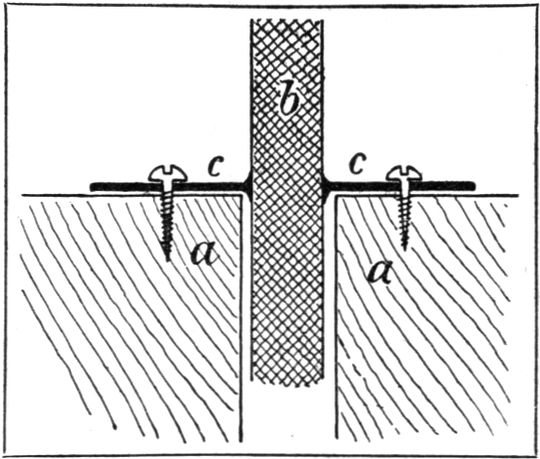
Abb. 153. Befestigung der Achse des Kommutators.
Drahtmasse für Induktionsapparate.
Bei einfachen Elektrisiermaschinen brauchen wir uns an keine bestimmten
Verhältnisse der Bewickelungen zu halten; es gilt hier ganz allgemein:
primäre Spule aus wenig Windungen eines dicken Drahtes, sekundäre Spule
aus viel Windungen eines dünnen Drahtes.
Bei der Herstellung von Funkeninduktoren halte man sich an die
folgenden Tabellen Seite 182 und 183.
Unterbrecher.
Bei kleineren Apparaten bis zu 4 cm Funkenlänge reicht der
gewöhnliche Unterbrecher aus. Auch für größere Induktoren, bis zu 15
cm Funkenlänge, genügt diese Konstruktion, nur müssen dann die
Kontaktteile des Unterbrechers aus ziemlich starken Platinstücken
bestehen. Auch können wir, da bei den dicken Induktorrollen der
Eisenkern ziemlich hoch liegt, die Feder des Hammers senkrecht stellen, wie aus Abb. 154 hervorgeht: K
bezeichnet den Eisenkern, H den Hammer, P den
Platinkontakt, F die Feder, die durch die Stellschraube S
mehr oder weniger gegen die Spule hineingedrückt werden kann, welcher
Umstand es ermöglicht, die Schnelligkeit der Unterbrechungen etwas zu
regeln. Man mache den Eisenkern H möglichst leicht und den Hebel
c kurz.
[S. 182]
|
Maße für einfachere Funkeninduktoren
|
|
Funken-
länge
|
Primäre Rolle
|
Sekundäre Rolle
|
Nötige
Stromspannung
|
|
Draht-
stärke
|
Zahl der
Lagen
|
Draht-
stärke
|
Draht-
länge
|
Drahtgewicht
|
|
mm
|
mm
|
|
mm
|
m
|
ca. kg
|
Volt
|
|
1 bis 10
|
0,8 bis 1
|
2
|
0,1
|
400 bis 800
|
—
|
etwa 2 bis 5
|
|
10 bis 50
|
1 bis 1,3
|
2 oder 3
|
0,1
|
1000 bis 7000
|
—
|
etwa 5 bis 7
|
|
50 bis 100
|
1,3 bis 1,7
|
3
|
0,1 bis 0,2
|
7000 bis 15000
|
0,75 bis 1,5 (bei 0,1 mm)
2,5 bis 3 (bei 0,2 mm)
|
etwa 7 bis 8
(Akkumulator)
|
|
100 bis 200
|
1,7 bis 2,2
|
3 oder 4
|
0,2 (0,1)
|
15000 bis 30000
|
5 bis 10 (bei 0,2 mm)
1,5 bis 3 (bei 0,1 mm)
|
etwa 8 bis 12
(Akkumulator)
|
[S. 183]
|
Maße für bessere Funkeninduktoren
|
|
|
Eisenkern
|
Primärrolle
|
Sekundärrolle
|
|
Funken-
länge
|
Länge
|
Dicke
|
Stärke der
einzelnen
Eisenstäbe
|
Länge
|
Zahl der
Lagen
|
Draht-
stärke
|
Durch-
messer
|
Länge
|
Äußerer
Durchmesser
|
Breite der
Einzelspulen
|
|
100
|
150
|
16
|
0,8
|
140
|
2
|
1
|
34
|
130
|
80
|
4
|
|
200
|
360
|
35
|
1
|
300
|
3
|
2
|
70
|
260
|
140
|
4
|
|
300
|
600
|
42
|
1,2
|
540
|
3
|
2,5
|
85
|
440
|
230
|
3
|
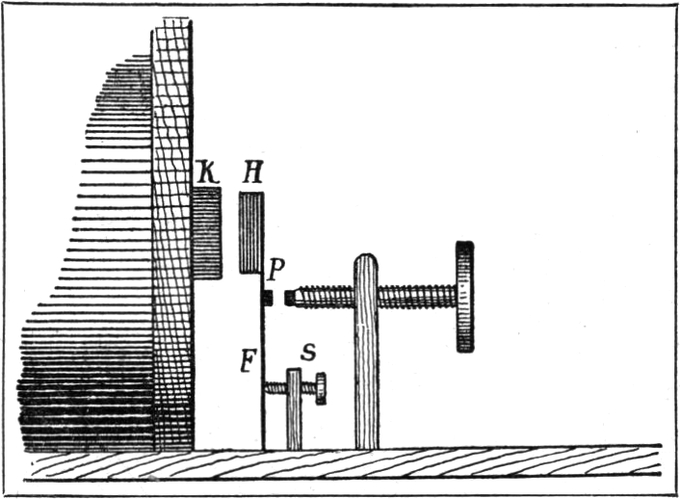
Abb. 154. Einfacher Unterbrecher.
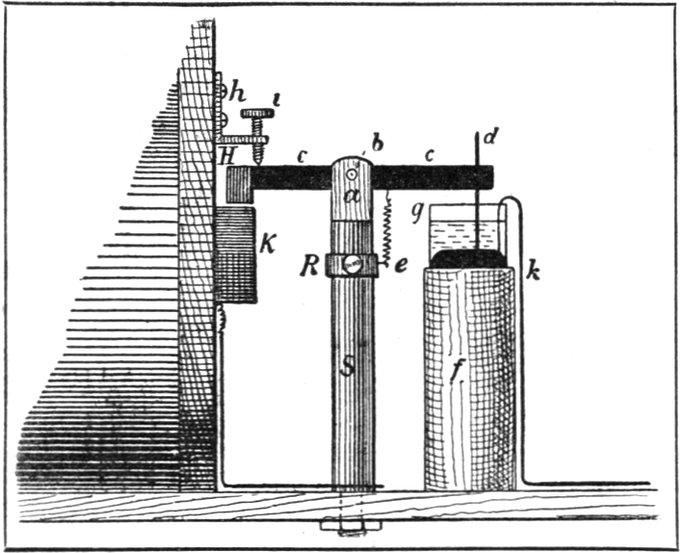
Abb. 155. Quecksilberunterbrecher.
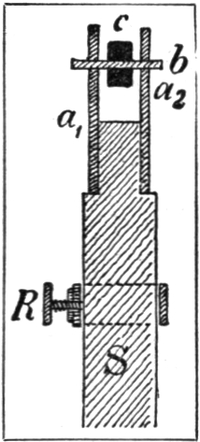
Abb. 156. Träger des Hebels zum Quecksilberunterbrecher.
Quecksilberunterbrecher.
Abb. 155 zeigt einen sehr gut arbeitenden und für Apparate bis zu 30
cm Funkenlänge ausreichenden Unterbrecher, einen sogenannten
Quecksilberunterbrecher. Eine Messingsäule[S. 184] oder auch aus Holz
gefertigte Säule S wird an ihrem unteren Ende zur Beseitigung
im Grundbrett etwas abgedreht und mit einem Gewinde versehen, an
ihrem oberen zweiseitig abgeflacht. Auf diese abgeflachten Stellen
werden zwei Messingblechstreifen (a₁ und a₂ in
Abb. 156) angelötet, die je mit einer Bohrung zu versehen sind, in
welche eine Stricknadel (b) hineinpaßt. c zeigt uns
einen gleicharmigen Hebel aus Aluminiumblech oder Holz, der links
den Eisenanker (H) trägt und rechts zur Aufnahme eines 2 bis
3 mm starken Kupferdrahtes (d) durchbohrt ist. In
der Mitte erhält c ein Loch, in welches die oben erwähnte
Stricknadel paßt. Um die Säule S wird ein Messingring (R)
gelegt, der an einer Stelle durchlocht wird. Über das Loch lötet man
eine kleine Schraubenmutter, durch die man eine Schraube eindrehen
und damit den Ring an der Säule befestigen kann. Außerdem wird an
R ein Häkchen zum Einhängen der Feder e angelötet.
Unter das rechte Ende des Hebels wird auf einem Holzfuß f ein
kleiner Glasbehälter g aufgestellt, in welchen das Quecksilber
eingegossen wird. Das Ende des Drahtstiftes d wird mit einer
Platinspitze versehen. Ferner wird ein schmaler Messingblechstreifen
(h) rechtwinkelig umgebogen, auf einer Seite durchbohrt, mit
einem Muttergewinde versehen und mit der anderen über dem Anker
(H) an der Randscheibe des Induktors angeschraubt. Durch das
Gewinde[S. 185] geht die Schraube i, mit der wir die Entfernung des
Ankers vom Magnetkerne K regeln können. Zum Gebrauch wird
über das Quecksilber, das von dem Platinende des Stiftes d
gerade berührt wird, eine etwa 2 cm hohe Schicht Petroleum
aufgegossen. Der Strom tritt durch einen über den Rand des Glases in
das Quecksilber eingetauchten Kupferblechstreifen k ein und geht
durch d, c und b in die Säule S und von da
den üblichen Weg durch den Apparat. Bei welcher Stellung der Schraube
i und des Ringes R, durch dessen Verschieben die Spannung
der Feder e reguliert werden kann, der Unterbrecher am besten
funktioniert, ist durch Probieren ausfindig zu machen.
Elektrolytischer Unterbrecher nach Wehnelt.
Für Unterbrechungen sehr hoher Zahl wird gewöhnlich der Wehneltsche
oder elektrolytische Unterbrecher gebraucht. Für unsere Zwecke ist er
jedoch nicht geeignet, schon deswegen nicht, weil er sehr starke Ströme
erfordert. Rudi hatte sich trotzdem nur zur Demonstration für seinen
Vortrag einen Wehneltschen Unterbrecher hergestellt, zu dessen Betriebe
ihm seine zwölfzellige Akkumulatorenbatterie gerade ausreichte.
An das Ende eines 2 bis 3 mm starken Kupferdrahtes lötete er
ein 5 mm langes Stückchen Platindraht und hämmerte es zur
feinen Spitze aus. Diesen Draht schob er mit der Spitze voran in eine
Glasröhre und schmolz sie gerade über der Platinspitze so ab, daß
letztere noch 1 mm weit herausragte. Die Platin- und die daran
anschließende Glasspitze brachte er in der Stichflamme des Lötrohrs
bis zur hellen Weißglut, damit die beiden Teile innig miteinander
verschmelzen sollten. An das aus der Glasröhre hervorragende Ende des
Kupferdrahtes lötete er eine Klemmschraube. In ein ziemlich großes
rundes Einmachglas stellte er dann einen halbzylindrischen Mantel
aus Bleiblech, der einen über den Rand des Gefäßes hinausragenden
Fortsatzstreifen trug, an dem eine Klemme angelötet war. Die Glasröhre
befestigte er in einem auf das Gefäß passenden Holzdeckel nahe dem
Rande, so daß er durch Drehen des Deckels sie der Bleiplatte beliebig
nähern konnte. Die Röhre ragte von oben ungefähr bis[S. 186] in die Mitte des
Gefäßes, das er mit verdünnter Schwefelsäure gefüllt hatte.
Zum Gebrauch eines Wehneltschen Unterbrechers wird der Unterbrecher des
Induktors kurz geschlossen; dann verbinden wir den positiven Pol
der Akkumulatorenbatterie mit der Platinspitze und die Bleiplatte mit
der einen Klemme des Induktionsapparates, dessen andere Klemme wir mit
dem negativen Pol der Batterie verbinden. Der Kondensator ist hierbei
am besten auszuschalten.
Die Wirkungsweise dieses Apparates ist ungefähr folgende. Beim
Durchgang des Stromes durch die Schwefelsäure entstehen durch
Elektrolyse an den Elektroden Gase, und zwar tritt an der Platinspitze
Sauerstoff, an der Bleiplatte Wasserstoff auf. Da nun aber der starke
Strom die feine Platinspitze sehr stark erhitzt, so entwickelt sich um
diese herum Wasserdampf, der durch die große Hitze in Sauerstoff und
Wasserstoff zerlegt wird. Diese Gase nehmen ein so großes Volumen um
die Spitze herum ein, daß diese ganz von der Flüssigkeit getrennt wird.
Damit ist der Strom unterbrochen, die Gasblase steigt auf, und der
Vorgang beginnt von neuem.
Die an der Spitze auftretende Wärme ist so groß, daß die sich bildenden
Gase bis zum Glühen erhitzt werden, was zur Folge hat, daß auch die
Flüssigkeit eine hohe Temperatur annimmt, so daß man nach kurzer Zeit
die Arbeit mit dem elektrolytischen Unterbrecher einstellen muß.
Nachdem Rudi die verschiedenen Konstruktionen der Induktoren erläutert
hatte, ging er dazu über, diejenigen Eigenschaften der Wechselströme
zu besprechen, durch welche sie sich besonders von den Gleichströmen
unterscheiden.
Wechselströme.
Die Ströme, die wir in unseren Induktoren erhalten, sind, wie wir
gesehen haben, auch Wechselströme, das heißt Ströme, die fortwährend
ihre Richtung ändern. Solche Ströme haben wir im vorigen Kapitel
kennen gelernt. Die zweipolige magnetelektrische Maschine (Seite 138
u. f.) liefert uns einen einfachen Wechselstrom, dessen Verlauf in
Abb. 157 graphisch dargestellt ist. Stehen die Induktionsrollen des
Ankers gerade vor den Magnetpolen, wenn wir beginnen, die Maschine[S. 187] in
Rotation zu setzen, so steigt die elektromotorische Kraft und damit,
wenn der Ankerdrahtkreis geschlossen ist, auch die Stromstärke von dem
Wert 0 bei a bis zu ihrem höchsten Wert bei α, den sie nach
einer Ankerdrehung von 90° erreicht hat; jetzt fällt die Spannung
wieder, bis sie bei b nach einer Ankerdrehung von 180° wieder
den Wert 0 erreicht hat. In diesem Augenblick ändert der Strom seine
Richtung, was in der Figur daran zu sehen ist, daß die Kurve nicht mehr
oberhalb der Linie ax verläuft, sondern unterhalb. Hier
wiederholt sich der gleiche Vorgang bei umgekehrter Stromrichtung. Hat
der Anker eine volle Drehung (360°) gemacht, so ist die Spannung im
Punkte c wieder gleich 0, der Strom steigt und fällt wieder wie
zu Anfang und so fort.
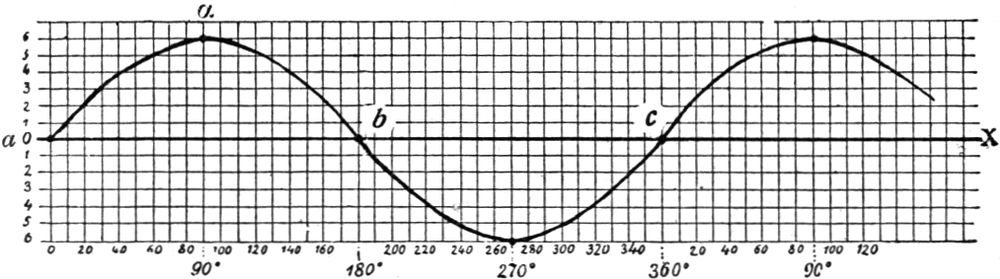
Abb. 157. Kurve eines einfachen Wechselstromes.
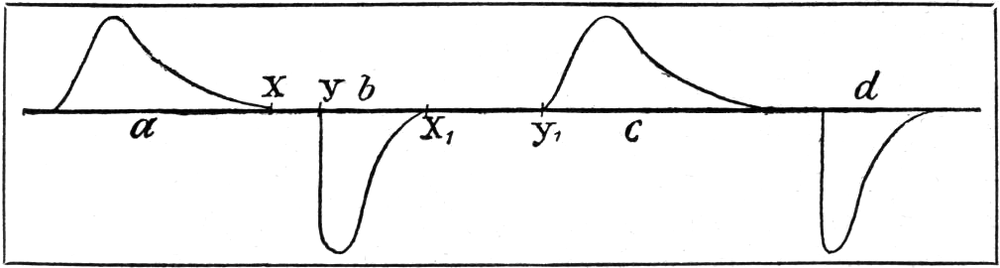
Abb. 158. Kurve eines Induktorstromes.
Betrachten wir nun die Wechselströme, die in einem einfachen
Induktionsapparat entstehen, während der Unterbrecher in Tätigkeit
ist. Der Verlauf eines solchen Stromes ist in Abb. 158 versinnlicht:
Wird der primäre Strom geschlossen, so erhalten wir im sekundären
Draht einen Stromimpuls, der rasch ansteigt bis zu einem gewissen
Maximalwert, der mit von der Geschwindigkeit, mit der der Strom
geschlossen wird, abhängt, um sogleich wieder auf 0 herabzusinken
(a in Abb. 158). Der Unterbrecher[S. 188] mag nun noch so rasch
funktionieren, der Stromimpuls war so kurz, daß eine gewisse Zeit
verstreicht, bevor der Strom wieder geöffnet wird. Diese Zeit ist
in der Figur durch die Strecke xy dargestellt. Bei
y tritt dann der Stromwechsel ein, und wir erhalten den anders
gerichteten Öffnungsstrom (b), der noch viel rapider verläuft
und einen höheren Maximalwert erreicht als der Schließungsstrom. Dann
vergeht wieder eine gewisse Zeit (x₁, y₁), bis der
Strom geschlossen wird und so fort.
Es fragt sich nun: Wie können wir Spannungen und Stromstärken von
Wechselströmen messen? Wie wir im vorigen Kapitel schon sahen (Seite
148), reagiert z. B. unser Vertikalgalvanoskop aus den dort erwähnten
Gründen nicht auf Wechselströme. Dagegen ließe sich denken, daß
die Volt- und Amperemeter, bei denen weiche Eisenteile durch die
magnetische Kraft einer Spule bewegt werden, auch auf Wechselströme
reagieren, da ja, wenn der Elektromagnet seine Pole ändert, sich auch
ebenso rasch die Pole des weichen Eisens ändern, dieses somit auf jeden
Fall angezogen wird. Diese Überlegung ist wohl ganz richtig, doch wir
würden zu sehr schlechten Resultaten kommen, wenn wir mit unseren
Instrumenten Wechselströme messen wollten; denn erstens dürfen die
verwendeten Eisenmassen nur sehr klein, zweitens muß das Eisen absolut
weich sein, was eigentlich nur bei chemisch reinem Eisen der Fall ist,
und drittens müssen die Instrumente für Wechselströme, und zwar für
solche mit ganz bestimmten Perioden, geeicht sein.
Rudi hatte sich zur Demonstration in seinem Vortrag zwei
Meßinstrumente für Wechselstrom gefertigt, deren Konstruktion am
Schlusse dieses Kapitels beschrieben ist. Das eine, ein sogenanntes
Hitzdrahtinstrument, benutzt die Stärke der Ausdehnung, die ein vom
Strome durchflossener kurzer dünner Draht infolge der Erwärmung
erfährt, als Maßstab für die Stromstärke. Das zweite ist ein
Elektrodynamometer, ein Instrument, das sich nur dadurch von unserem
Vertikalgalvanoskop unterscheidet, daß statt des Stahlmagneten eine
Drahtrolle ohne Eisenkern verwendet wird. Wenn ein solches Instrument
von einem Wechselstrom durchflossen wird, so ändert sich die
Stromrichtung[S. 189] gleichzeitig in der äußeren und in der inneren Spule,
weshalb die Ablenkung der letzteren immer nach der gleichen Seite
erfolgt. Auch das im Anhang beschriebene Universalinstrument ist zur
Messung von Wechselströmen geeignet.
Eine zweite Frage, die von vornherein nicht so begründet erscheinen
mag, wie die erste, ist die, ob auch für Wechselströme das Ohmsche
Gesetz (Seite 84 u. f.) gilt. Diese Frage ist nur bedingungsweise zu
bejahen, nämlich dann, wenn der vom Strome durchflossene Leiter völlig
frei ist von Selbstinduktion (Seite 158); ist dies nicht der Fall, so
erhält das Ohmsche Gesetz Modifikationen, die von einer großen Anzahl
einzelner Umstände abhängig sind.
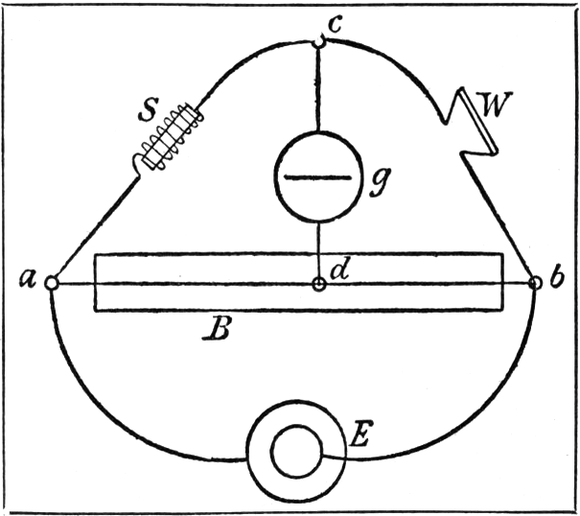
Abb. 159. Wheatstonesche Brücke.
Impedanz.
Schicken wir z. B. durch eine Drahtspule mit einem Eisenkern, also
durch einen Leiter mit sehr großem Selbstpotential, einen Wechselstrom,
so bietet diesem die Spule einen größeren Widerstand, als sie einem
Gleichstrom bieten würde, da die Spannung des Extrastromes der des
Wechselstromes entgegenwirkt. Diese Tatsache läßt sich durch ein sehr
einfaches Experiment beweisen: Auf Seite 109 u. f. haben wir die
Wheatstonesche Brücke und ihre Benützung zur Messung von Widerständen
kennen gelernt. Wir schalten nun, wie aus Abb. 159 hervorgeht, in den
Stromkreis einer solchen Brücke eine mit einem Eisenkern versehene
Drahtspule S, an Stelle des Vergleichswiderstandes bringen wir
einen möglichst induktionsfreien Leiter, etwa einen Graphitstab,
dessen Widerstand wir — nur der Bequemlichkeit wegen — annähernd
gleich dem der Spule S wählen, und stellen dann den Schlitten
der Brücke so, daß das Galvanoskop stromlos ist. Jetzt wissen wir,
daß sich der Widerstand von S zu dem von W verhält wie
die[S. 190] Strecke ad zur Strecke db; dabei ist
es völlig einerlei, wie stark die elektromotorische Kraft in E
und wie groß der Widerstand von g ist. Wir können deshalb
statt des Elementes E eine magnetelektrische Maschine, die uns
Wechselstrom liefert, und statt des Galvanometers ein Telephon
einschalten. Das Telephon ist nämlich eines der geeignetsten
Instrumente, um das Vorhandensein selbst sehr schwacher Wechselströme
noch zu erkennen, indem es diese durch Ertönen anzeigt. Die Einrichtung
des Telephons selbst ist am Schlusse dieses Kapitels Seite 200
beschrieben. Wenn aber eine Drahtspule einem Wechselstrom einen
größeren Widerstand entgegensetzt als ein induktionsfreier Leiter vom
selben Widerstand, so ist klar, daß jetzt in unserem Wheatstoneschen
Systeme die Verhältnisse gestört sein müssen, was wir daran erkennen,
daß der Stromzweig cd nicht stromlos ist, wie vorhin,
sondern von einem Teil des Wechselstromes durchflossen wird und das
Telephon zum Ertönen bringt. Daß diese Veränderung tatsächlich auf eine
Vergrößerung des Widerstandes für Wechselströme in S
hinausläuft, erkennen wir daran, daß wir, um das Telephon zum Schweigen
zu bringen, also um es stromlos zu machen, den Schlitten d der
Brücke nach b zu verschieben müssen.
Man bezeichnet den Widerstand, den die Einschaltung einer solchen Spule
den Wechselströmen bietet, zum Unterschied von dem gewöhnlichen, in Ohm
gemessenen Widerstand, als die Impedanz der Spule; sie ist um
so größer, je höher das Selbstpotential der Spule ist, und je rascher
die Richtungsänderungen des Wechselstromes aufeinander folgen. Die
Impedanz führt bei Wechselströmen hoher Frequenz zu sehr eigentümlichen
Erscheinungen, die wir im sechsten Vortrage genau kennen lernen werden.
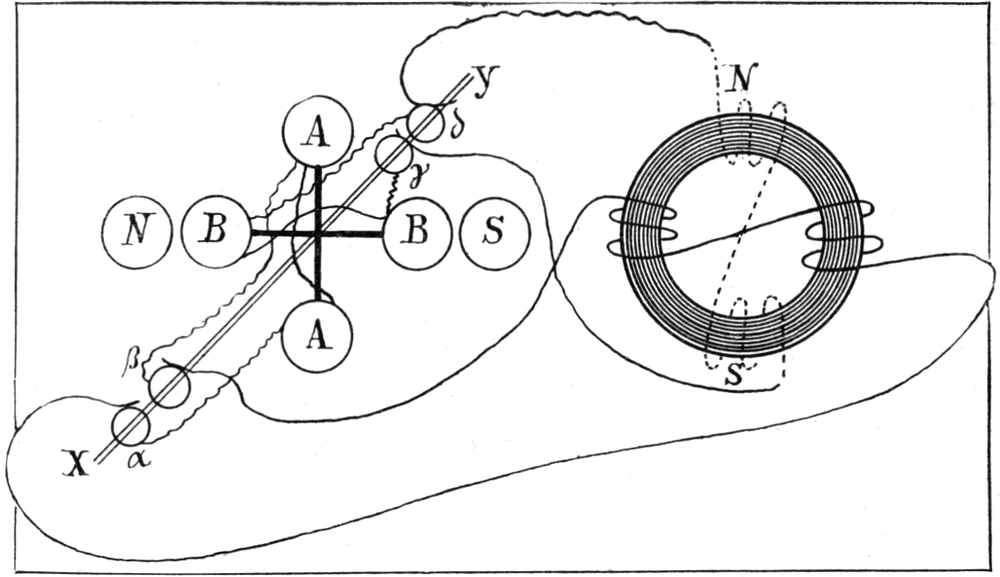
Abb. 160. Schema zum Versuch mit dem zweiphasigen
Wechselstrome.
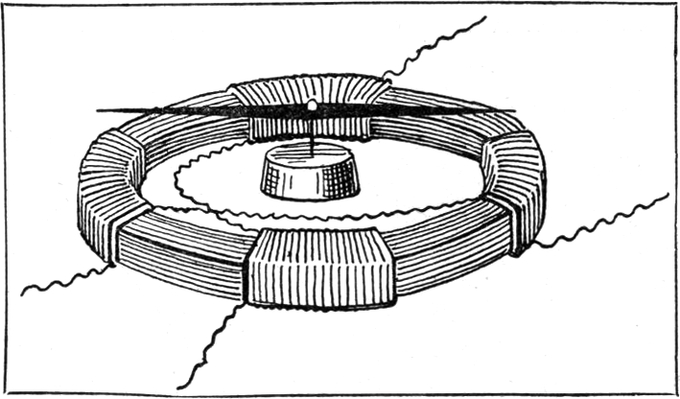
Abb. 161. Eisenring mit Magnetnadel.
Mehrphasenströme.
Nach diesen Versuchen ging Rudi dazu über, die Anwendungen der
Wechselströme in der Praxis zu besprechen. Zur Erklärung des
zweiphasigen Wechselstromes und des Begriffes der Phasen überhaupt
hatte er sich seinen Elektromotor (Seite 124), der zwei Feldmagnet-
und vier Ankerpole hatte, besonders hergerichtet: Er brachte auf der
Achse vier Schleifringe an, je zwei verband er mit den Drahtenden
eines[S. 191] Rollenpaares, wie aus der schematischen Zeichnung in Abb.
160 hervorgeht. In dieser Figur sind N und S die
Pole des Feldmagneten, A, A ist das eine, B,
B das andere Rollenpaar, xy ist die Achse mit
den vier Schleifringen α, β, γ, δ. Ferner fertigte er sich einen
Ring aus Eisendraht, ähnlich dem Grammeschen Ringe (Seite 127). Auf
diesen wickelte er vier Drahtspulen und verband je zwei einander
gegenüberliegende so, wie aus dem Schema Abb. 160 zu erkennen ist;
die vier freien Drahtenden verband er mit den vier Schleiffedern. Der
Ring hatte einen mittleren Durchmesser von 6½ cm und einen
Querschnitt von 1 qcm. Jede Spule bestand aus etwa 40 bis 50
Windungen eines 0,5 mm starken isolierten Drahtes. Die in dem
Ring verlaufenden Verbindungsstücke führte er nicht, wie in der Abb.
160 angegeben[S. 192] ist, durch die Mitte, sondern der inneren Ringseite
entlang. In die Mitte des Ringes stellte er eine in einen Kork
gesteckte Nadel, auf welcher eine Magnetnadel balancierte (Abb. 161).
Die Feldmagnete erregte Rudi mit einem starken Akkumulatorenstrom und
setzte dann mit Hilfe eines großen Übersetzungsrades den Anker in
rasche Rotation. Sofort begann auch die Magnetnadel sich zu drehen.
Wodurch mag nun diese Drehung verursacht werden?
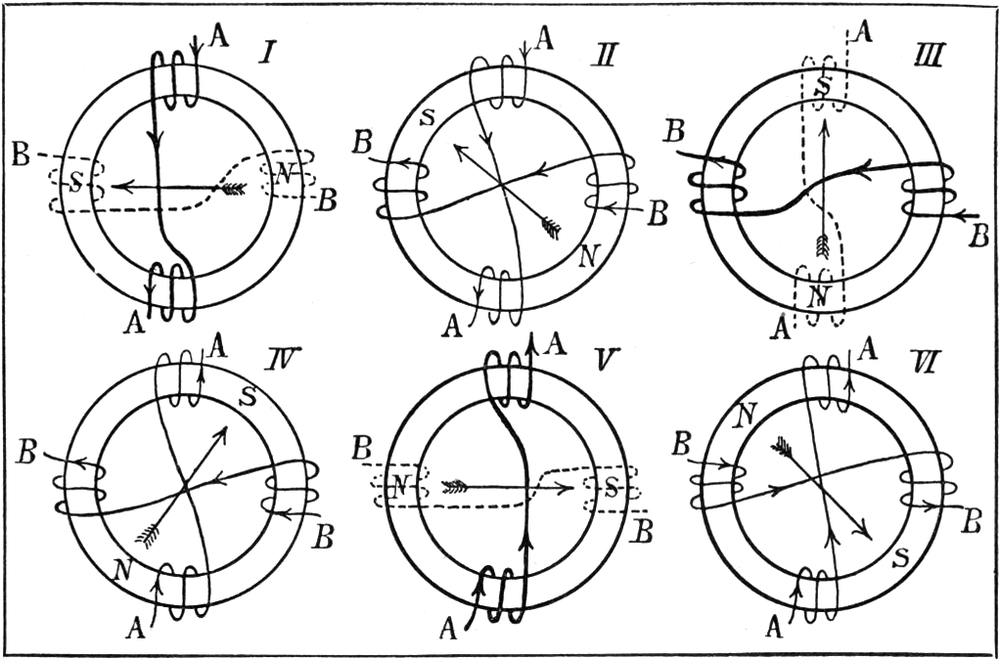
Abb. 162. Magnetisches Drehfeld.
Betrachten wir Abb. 162. Hier soll jeweils der mit A, A
bezeichnete Draht mit den Spulen A, A (in Abb. 160),
der Draht B, B mit den Spulen B, B
verbunden sein. Wir wollen nun sehen, wie sich die Stromverhältnisse
in einzelnen, herausgegriffenen Augenblicken während der Ankerdrehung
verhalten. Bei der in Abb. 160 gezeichneten Stellung der Spulen wird
der in A, A induzierte Strom gerade seinen höchsten
Wert erreicht haben, und in B, B wird er sich gerade
umdrehen, also im Augenblick gleich 0 sein. Um dies anzudeuten, ist in
Abb. 162 I der Draht A, A dick und der Draht B,
B punktiert gezeichnet. Bei der durch Pfeilspitzen angedeuteten
Stromrichtung müssen also bei N und S die entsprechenden
magnetischen Pole entstehen, nach denen sich die Magnetnadel — in
der Figur ein Pfeil —[S. 193] einstellt. Dreht sich nun der Anker weiter,
bis A und B beide gleichweit von N und S
(Abb. 160) entfernt sind, so sind in beiden Drähten die Stromimpulse
gleich stark und so gerichtet, wie aus Abb. 162 II zu erkennen ist;
jetzt haben sich also die Pole des Ringes um 45° verschoben, und die
Magnetnadel ist ihnen gefolgt. Abb. 162 III zeigt die Stromverhältnisse
in dem Augenblick, da A, A gerade die Pole des
Feldmagneten passiert und deshalb stromlos ist, während durch B,
B der Strom mit voller Stärke fließt; die Pole des Ringes
entstehen dann so, wie sie angedeutet sind. Dies geht so fort, bis der
Anker eine ganze Drehung gemacht hat (Abb. 162, IV–VI); dann wiederholt
sich der gleiche Vorgang.
Setzen wir nun auf die Spitze statt der Magnetnadel eine nicht
magnetische Nadel aus weichem Eisen auf, so wird diese sich ebenfalls
drehen, da in ihr die Pole induziert werden. Wir können auch eine runde
Weißblechscheibe in der Mitte mit einer Vertiefung versehen und auf die
Spitze legen; wird der Ring von den beiden Wechselströmen durchflossen,
so dreht sich die Scheibe.
Den Raum, das Feld in einem solchen Eisenring, das von zwei (oder mehr)
Wechselströmen in oben beschriebener Weise umflossen wird, nennt man
ein magnetisches Drehfeld. Von Wechselströmen, die sich wie die
Genannten verhalten, sagt man, sie hätten verschiedene Phasen,
oder es bestünde zwischen ihnen eine Phasendifferenz. Die
Phasendifferenz kann je nach der Anzahl der Wechselströme, die wir
von einem Anker abnehmen, verschieden sein. In unserem Falle haben
wir eine Phasendifferenz von 90°, das heißt während der
Strom aus dem einen Spulenpaar, z. B. B, B, seinen
geringsten Wert (= 0) hat, hat der Strom aus dem anderen
Spulenpaar A, A, das um 90° gegen das erste verschoben
ist, seinen höchsten Wert. Man spricht in diesem Falle von
einem zweiphasigen Wechselstrome. Würden wir von einem Anker
mit drei Spulenpaaren drei Wechselströme abnehmen, so wäre zwischen
diesen ein Phasenunterschied von je 60°. Solche Ströme nennt man
Dreiphasenströme.
Wir wollen nun sehen, was geschieht, wenn wir zwei[S. 194] Wechselströme,
zwischen denen eine Phasendifferenz besteht, durch einen
Drahtkreis fließen lassen. Zeichnen wir wieder wie vorhin den Verlauf
eines einfachen, sogenannten einphasigen Wechselstromes
graphisch auf, so erhalten wir eine Linie wie A in Abb. 163;
dies sei der Strom, den die Rollenpaare A, A (Abb. 160)
liefern. Den Strom von B, B zeichnen wir dann ebenfalls
auf und erhalten die Linie B; die an derjenigen Stelle den
höchsten Wert hat, an welcher A gleich 0 ist. Addieren wir nun
die Spannungen beider Ströme da, wo sie gleichgerichtet sind, und
subtrahieren wir sie, wo sie verschiedene Richtungen haben, so erhalten
wir die Linie C, welche die Resultante der beiden Wechselströme
in dem einen Leiter darstellt.
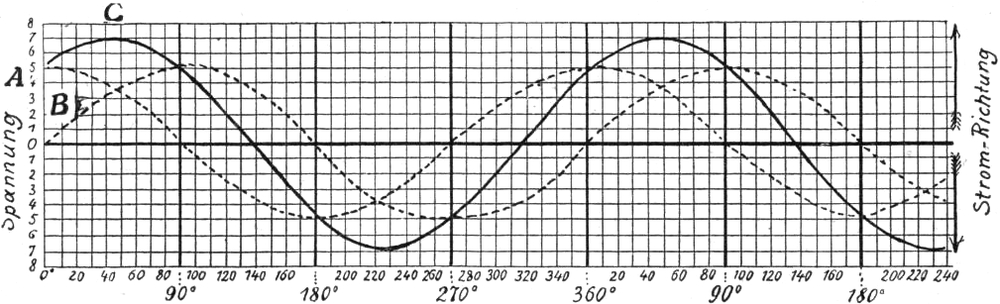
Abb. 163. Kurve der aus zwei Wechselströmen mit
verschiedener Phase entstehenden Resultante.
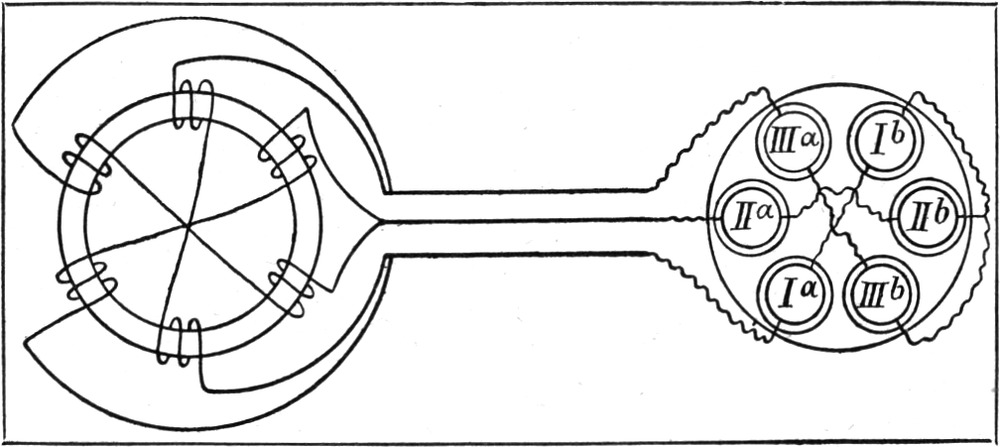
Abb. 164. Dreiphasiger Wechselstrom.
Auch einen dreiphasigen Wechselstrom mit einer Phasendifferenz
von 60° konnte Rudi erzeugen. Er hatte sich dafür einen besonderen mit
drei Spulenpaaren, also mit sechs Spulen versehenen Anker hergestellt,
indem er in eine[S. 195] runde, 2 bis 3 mm starke Eisenplatte sechs
zylindrische Stäbe einnietete, die den Rollen als Kerne dienten;
diese Rollenpaare sind in Abb. 164 mit Ia, Ib, IIa,
IIb und IIIa, IIIb bezeichnet und
werden so miteinander verbunden, wie das aus der Figur zu erkennen
ist. Der Eisenring muß natürlich auch entsprechend drei Spulenpaare
tragen. Aus der Figur erkennen wir ferner den Vorteil des dreiphasigen
Wechselstromes: wir brauchen nämlich nicht, wie man anfangs meinen
könnte, sechs Leitungen, sondern nur drei, die dann in der angedeuteten
Weise mit den Spulen verbunden werden. Die Ankerspulenpaare können auf
zweierlei Weise geschaltet werden: entweder, wie Abb. 165 zeigt, in
Sternschaltung oder wie in Abb. 166 als Dreieckschaltung.
Die drei Leitungen werden durch die Verbrauchsstellen W₁,
W₂, W₃, die aus Glühlampen, Heizapparaten,
Motoren u. s. w. bestehen können, miteinander verbunden. In
W₁, in W₂ und in W₃ fließt dann je ein
einphasiger Wechselstrom, der sich, ähnlich wie in Abb. 163, aus zwei
Wechselströmen, die eine Phasendifferenz von 60° haben, zusammensetzt.
Die drei Resultanten haben dann wieder einen Phasenunterschied von 60°.
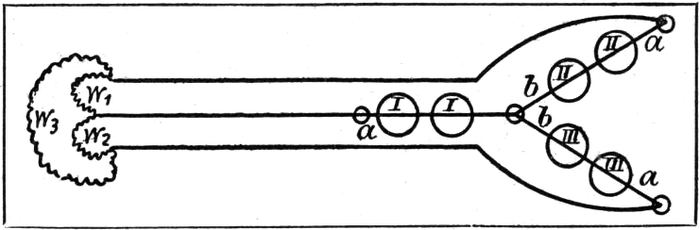
Abb. 165. Die drei Spulenpaare in Sternform geschaltet.
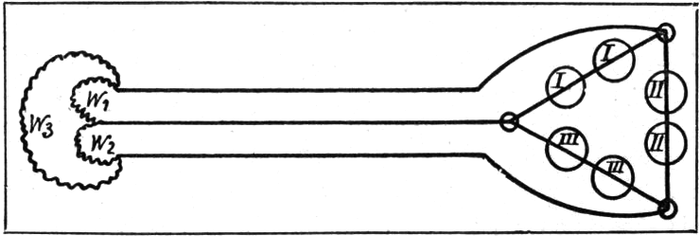
Abb. 166. Die drei Spulenpaare im Dreieck geschaltet.
Die mehrphasigen Wechselströme — in der Praxis aber eigentlich nur die
dreiphasigen — bezeichnet man auch als Drehströme, da man mit
ihnen ein magnetisches Drehfeld erzeugen kann.
Um seinen Hörern die Verhältnisse von Stromstärken und Stromrichtungen
in den drei Leitungen eines Drehstromes[S. 196] möglichst klar und anschaulich
zu machen, fertigte sich Rudi einen einfachen Apparat. Er schnitt
sich zwei 60 bis 70 cm große runde Pappendeckelscheiben und
befestigte in der Mitte der einen, um ein paar Zentimeter kleineren,
einen etwa fingerdicken Holzstab als Achse, in die andere schnitt er
in die Mitte ein Loch und drei 1 bis 2 cm breite Schlitze, wie
aus Abb. 167 zu erkennen ist. Auf die Scheibe mit der Holzachse malte
er, wie ebenfalls die Abbildung zeigt, zwei Kreise, deren Durchmesser
gleich der Länge der Schlitze in der anderen Scheibe waren. Die eine
Kreisfläche malte er blau, die andere rot, den übrigen Pappendeckel
schwarz und die Scheibe mit den Schlitzen weiß an. Letztere stellte
er zur Demonstration mit der Kante auf dem Tisch auf und hielt sie
senkrecht fest, während Käthe die Holzachse der farbigen Scheibe von
hinten in das Loch der weißen hineinsteckte und sie dann langsam
drehte. Dabei sah man von vorn, wie die drei Schlitze abwechselnd rot
und blau wurden. Aber sie änderten ihre Farbe nicht plötzlich, sondern
wenn der eine anfangs in seiner ganzen Länge die rote Farbe zeigte,
so wurde der scheinbare Strich immer kürzer, bis man gar kein Rot
mehr sah, dann kam Blau und wurde immer länger und nahm dann wieder
ab u. s. w. Bei diesem Versuch stellen die drei Schlitze die drei
Leitungen, Rot die eine, Blau die andere Stromrichtung und die Länge
der in den Schlitzen erscheinenden Farbenstriche die Stromstärke vor.
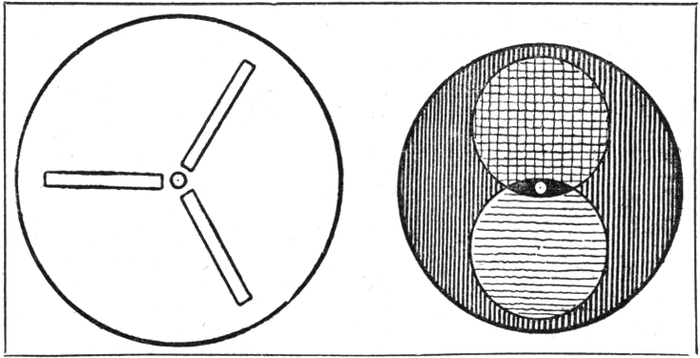
Abb. 167. Apparat zur Veranschaulichung eines
Drehstromes.
Transformatoren.
Daß man mit einem solchen Drehstrom sehr einfache Elektromotoren bauen
kann, leuchtet nach den angestellten Experimenten mit dem Drehfeld
(Abb. 162) ein. Ein weiterer noch viel wichtigerer Vorteil, den
auch die einphasigen Wechselströme[S. 197] mit den Drehströmen teilen, ist
die Fähigkeit, sich durch einfache Apparate auf andere Spannungen
transformieren zu lassen. Solche Apparate sind im wesentlichen
unseren Induktoren gleich, nur daß diese für Gleichströme, die durch
eine besondere Vorrichtung periodisch unterbrochen werden müssen,
eingerichtet sind, während jene einfach aus zwei getrennten, auf einen
Eisenkern aufgewickelten Spulen bestehen, bei denen die Unterbrechung
durch die periodische Richtungsänderung ersetzt wird.
Was für einen Vorteil hat es aber im Großbetriebe, die Spannung eines
Stromes transformieren zu können? Wir wissen, daß bei gegebener
Drahtdicke der Widerstand einer Leitung um so größer wird, je länger
wir sie machen. Wenn z. B. für die Beleuchtung einer Stadt die
Wasserkräfte in einem weit entlegenen Gebirgstal ausgenützt werden
sollen, so würde ein Strom mit normaler Spannung (110 Volt) entweder in
der langen Leitung sehr große Verluste erleiden, oder man müßte, um das
zu vermeiden, die Leitung aus ungeheuer dicken Drähten herstellen. Im
ersten Falle tritt also ein Energieverlust ein, im zweiten würden die
Kosten für die Leitung allein so groß werden, daß sich eine derartige
Anlage niemals lohnen könnte. Nun geht aber aus dem Ohmschen Gesetz
(Seite 84 u. f.) hervor, daß ein Strom mit einer gewissen Anzahl von
Watt, sagen wir 1000, mit viel geringeren Verlusten durch eine Leitung
fließt, wenn er hohe Spannung und geringe Stromstärke hat, als wenn die
gleichen 1000 Watt mit geringer Spannung und großer Stromstärke durch
dieselbe Leitung fließen müssen. Also ein Strom mit 1000 Volt und 1
Ampere (gleich 1000 Watt) ist leichter in die Ferne zu leiten, als ein
solcher mit nur 100 Volt und 10 Ampere (ebenfalls gleich 1000 Watt).
Da sich nun aber Ströme mit sehr hohen Spannungen für den Betrieb von
Lampen, Motoren u. s. w. schlecht eignen und außerdem für die mit den
Leitungen in Berührung kommenden Personen lebensgefährlich sein können,
so werden sie vor den Verbrauchsstellen auf niedere Spannung umgeformt,
transformiert. In solchen Transformatoren bestehen die primären
Wickelungen aus vielen Windungen eines dünnen Drahtes, die sekundären
aus wenig Windungen eines dicken Drahtes. Von dem Verhältnis[S. 198] der
primären zur sekundären Spannung hängt auch das Verhältnis der
Drahtmaße der Bewickelung ab.
Soviel etwa sprach Rudi über die Transformatoren; ein besonderes
Experiment führte er dabei nicht vor, obgleich es nicht schwer gewesen
wäre, sich einen kleinen Transformator herzustellen. Wie eine Maschine,
die Drehstrom liefert, herzustellen ist, haben wir auf Seite 194
gesehen. Speziell für diesen Versuch ist es von Vorteil, wenn die
Bewickelung der sechs Ankerspulen aus recht dünnem Draht besteht (etwa
0,3 mm stark). Den Transformator können wir als sogenannten
Ringtransformator auf folgende Weise konstruieren. Wir stellen aus etwa
0,5 bis 0,6 mm starkem Eisendraht, den wir in einer Bunsenflamme
— nicht etwa im Kohlenfeuer — tüchtig durchgeglüht haben, einen Ring
her, ähnlich dem, den wir für das magnetische Drehfeld anfertigten,
und teilen ihn auf seinem Umfange in drei gleiche Teile ein, die wir
durch drei um den Ring gebundene Bindfäden bezeichnen. Jetzt wickeln
wir um jedes Drittel vier Lagen eines 0,3 mm starken, isolierten
Kupferdrahtes; das sind also drei einzelne Wickelungen, zwischen denen
etwa 5 mm frei bleiben sollen. Die sechs Drahtenden werden mit
Seidenfäden festgebunden, das Ganze mit Schellacklösung überstrichen
und mit einem in Schellack getränkten Papierstreifen umgeben. Darauf
werden auf jede dieser Wickelungen zwei Lagen eines 1 mm starken
Kupferdrahtes aufgewickelt. Dieser Ring, der sechs dicke und sechs
dünne Drahtenden hat, wird auf einem Brett befestigt, und die Drähte
werden zu Klemmen geführt.
Wir haben jetzt einen Drehstromgenerator und einen
Drehstromtransformator, es fehlt uns nur noch der Drehstrommotor.
Letzterer ist ebenfalls sehr einfach herzustellen. Wir versehen einen
Eisendrahtring wie den des Transformators mit drei Spulenpaaren. Der
Ring soll einen inneren Durchmesser von 4 cm, einen äußeren von
5 cm haben. Jede Spule soll aus drei Lagen mit je 10 Windungen
eines 0,5 mm starken Drahtes bestehen. Die Verbindungsdrähte der
einzelnen Spulen dürfen nicht durch die Mitte des Ringes gehen, sondern
müssen auf dessen Außenseite verlaufen.
Der Anker dieses Motors ist ebenfalls sehr einfach[S. 199] herzustellen. Wir
biegen aus einem 1 bis 2 mm dicken und 1 cm breiten
Eisenblechstreifen einen Ring, der mit 3 mm Spielraum in den
bewickelten Drahtring hineinpaßt. Die zusammenstoßenden Enden des
Blechstreifens werden verlötet, und der ganze Blechring wird mit
einem nicht isolierten, 1 mm starken Kupferdraht so
umwunden, wie aus Abb. 168 hervorgeht. Zwischen je zwei Windungen sei
ein Zwischenraum von 3 bis 4 mm. Die Enden des Drahtes werden
zusammen- und die Windungen an den Blechring angelötet Dieser Reif ist
in Abb. 168 dargestellt. Wir schieben ihn auf ein Holzscheibchen, das
gerade so hineinpaßt, daß er fest sitzt. In der Holzscheibe wird eine
Achse befestigt.
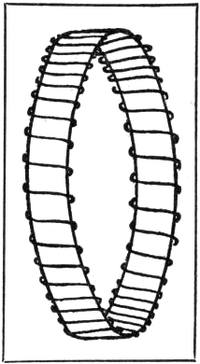
Abb. 168. Kurzschlußanker.
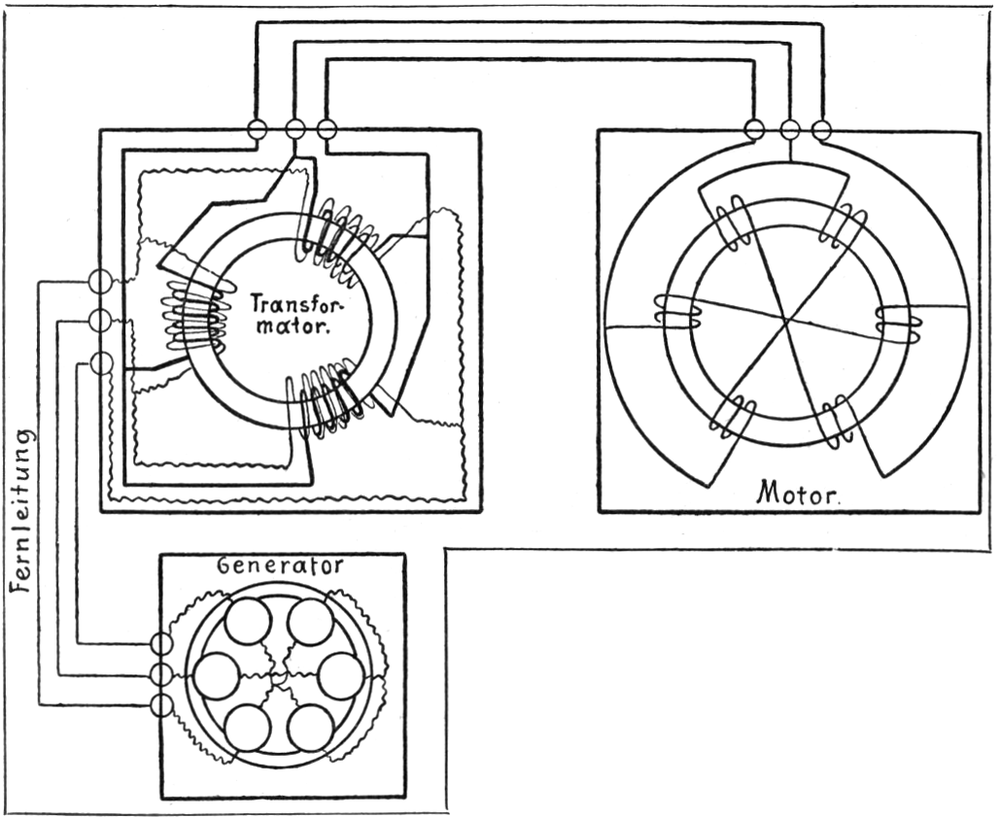
Abb. 169. Schaltungsschema eines Transformators.
Der Ring, der das magnetische Drehfeld erzeugt, wird senkrecht auf
einem Brettchen montiert; rechts und links werden die Lagerträger,
die wir aus Messingblech verfertigen, angebracht. Der Anker muß sich
spielend leicht und ohne zu streifen in dem Magnetringe drehen lassen,
dessen sechs Drahtenden wir zu drei Klemmen führen, wie aus dem Schema
Abb. 169 zu erkennen ist.
[S. 200]
Einen Anker, wie den eben beschriebenen, nennt man einen
Kurzschlußanker, weil seine Wickelung kurz geschlossen (siehe
Seite 153 u. f.) ist. Die mit dem Eisen des Ankerringes überall in
leitender Verbindung stehenden Kupferwindungen haben den Zweck, die
durch Induktion entstehenden Wirbelströme einen bestimmten Weg zu
führen. Sie folgen also zum größten Teile dem besser leitenden Kupfer
und verstärken dadurch noch den induzierten Magnetismus des Eisens.
(Siehe auch, was darauf bezüglich bei der Erklärung des magnetischen
Drehfeldes Seite 192 gesagt ist.) Weil der Magnetismus in solchen
Ankern induziert ist, werden sie auch als Induktionsanker
bezeichnet.
Wie der Generator, das ist die stromerzeugende Maschine, der
Transformator und der Motor miteinander zu verbinden sind, geht aus dem
Schema in Abb. 169 hervor. Setzen wir den Generator in Gang, so wird
sich auch der Motor drehen; je rascher wir den Anker des Generators
rotieren lassen, desto rascher wird auch der Motor laufen. —
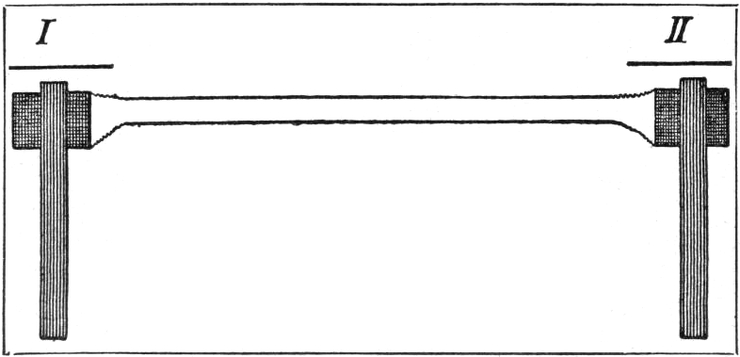
Abb. 170. Schema des ersten Telephons.
Das Telephon.
Zum Schlusse dieses Vortrages erklärte Rudi noch die Einrichtung
des Telephons, das eine der bedeutendsten Nutzanwendungen der
Induktionsströme darstellt.
Das erste Telephon war auffallend einfach: Ein Stahlmagnet war an dem
einen Pol mit einer Drahtspule versehen und in einem Gehäuse von Holz
untergebracht, in dem, kaum einen Millimeter vom Magnetpol entfernt,
eine dünne Eisenmembran befestigt war. Verband man nun die Spulen
zweier solcher Telephone, wie aus Abb. 170 hervorgeht, so konnte man
die Worte, die gegen die Membran I gesprochen wurden, bei II hören und
umgekehrt. Wodurch wird nun[S. 201] die Fernleitung des Schalles in den beiden
Drähten bewirkt?
Wir wissen, daß ein Stück Eisen, wenn es in die Nähe eines Magneten
gebracht wird, selbst magnetisch wird, somit selbst auch Kraftlinien
aussendet und die des Magneten aus ihrer ursprünglichen Richtung
ablenkt. Bei jeder Bewegung der Eisenmembran in unserem Telephon
werden sich deshalb die Kraftlinien des Stahlmagneten etwas verändern
und dadurch in der Drahtspule Induktionsströme erzeugen. Wird z. B.
die Membran I gegen den Pol hinbewegt, so wird ein Induktionsstrom
erzeugt, der so gerichtet ist, daß er den Magneten bei II verstärkt;
dadurch wird auch die Membran II stärker angezogen, macht also auch
eine Bewegung gegen den Pol hin. Entfernt sich die Membran I von ihrem
Magnete, so entsteht der Induktionsstrom in umgekehrter Richtung,
schwächt also in II den Magnet, und deshalb bewegt sich auch Membran II
von ihrem Pol weg. Kurz, die Membran der einen Station macht ganz genau
die Bewegung nach, in die wir die Membran der anderen bringen. Sprechen
wir also gegen die Membran I, so wird diese von den auftreffenden
Luftwellen (Schallwellen) in ganz bestimmter Weise in Schwingung
gebracht. Da die Membran II aber die Bewegungen der Membran I genau
mitmacht, so muß II ebenso schwingen wie I; dadurch werden der Luft in
der Nähe von II dieselben Schwingungen mitgeteilt, die der Membran I
die Bewegung erteilt haben; wir hören also bei II die gleichen Laute,
die gegen I gesprochen werden.
Eine derartig einfache Einrichtung hat aber den Nachteil, daß die
Tonstärke sehr gemindert wird; denn ein großer Teil der Energie des
Schalles wird dazu verbraucht, die Trägheit der ersten Membran zu
überwinden und sie in Schwingung zu versetzen, und dann geht wieder
ein Teil bei der Umsetzung der mechanischen Bewegungsenergie in
elektrische Energie verloren. Wie wir wissen, wird in dem Widerstand
eines Leiters die Energie eines elektrischen Stromes geschwächt; da
sie aber nach dem Gesetz der Erhaltung der Energie nicht verloren
gehen, nicht einfach verschwinden kann, so muß sie sich in eine andere
Energieform[S. 202] verwandelt haben. Elektrische Energie wird in Widerständen
zum Teil in Wärme umgesetzt, wie wir schon an den auf Seite 51
und 57 beschriebenen Experimenten gesehen haben. Man nennt diese durch
elektrische Ströme in Leitern hervorgerufene Wärme Joulesche
Wärme. Dieser Vorgang spielt sich zum Teil, je nach dem Widerstand
(Länge) der Leitung auch hier ab. Bei der zweiten Station finden in
umgekehrter Reihenfolge dieselben Verluste noch einmal statt.
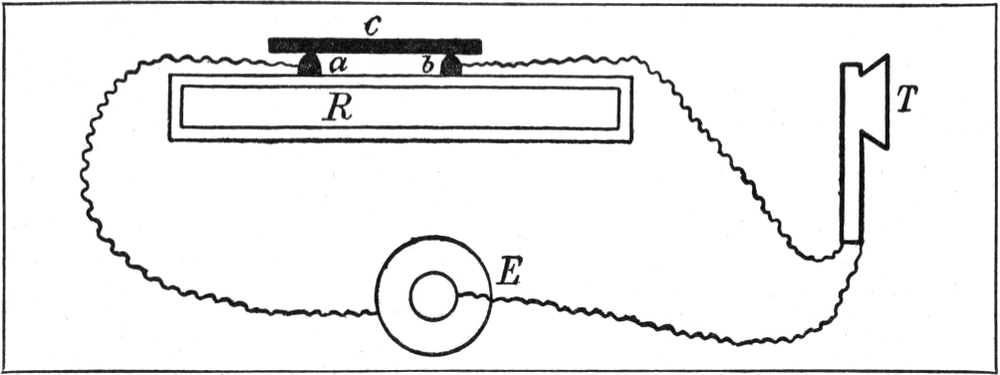
Abb. 171. Schema des Mikrophones.
Das Mikrophon.
Ein solches Telephon hatte eigentlich nur theoretisches Interesse;
zum praktischen Gebrauch war es kaum anzuwenden, da die Töne an der
Empfangsstation zu schwach wiedergegeben wurden. Dieser Mißstand wurde
durch die Erfindung des Mikrophones durch Hughes beseitigt.
Hughes befestigte auf einem Resonanzkästchen parallel nebeneinander
zwei Kohlestäbchen und legte auf diese ein drittes. Dann verband er
die eine der befestigten Kohlen mit einem Pol, die andere durch ein
Bellesches Telephon T — so genannt nach Graham Bell,
dem Erfinder des vorher beschriebenen Telephones — mit dem anderen
Pol eines Elementes E (Abb. 171). Wird bei dieser Einrichtung
durch irgend eine Erschütterung der Deckel des Resonanzkästchens
(R) rasch nach unten bewegt und mit ihm die beiden Kohlen
a und b, so wird das nur leicht aufliegende Stäbchen
c infolge seiner Trägheit nicht so rasch folgen können, es wird
in dem Augenblick nicht so fest auf a und b aufliegen
als vorher; dadurch aber, daß der Kontakt geringer wird, wird der
Widerstand für den Strom größer, der Strom selbst also schwächer. Wird
umgekehrt der Resonanzboden[S. 203] gegen c hinbewegt, so wird der
Kontakt inniger und der Strom stärker. Die Stromstärke gerät demnach
in Schwankungen, die den Schwingungen des Resonanzbodens analog sind.
In genau derselben Weise schwankt dann die Stärke des vom Strome
umflossenen Stahlmagneten, so daß schließlich die Membran des Telephons
die Schwingungen des Resonanzbodens genau mitmacht. Einen derartigen
Kohlenkontakt auf einem Resonanzboden nennt man Mikrophon.
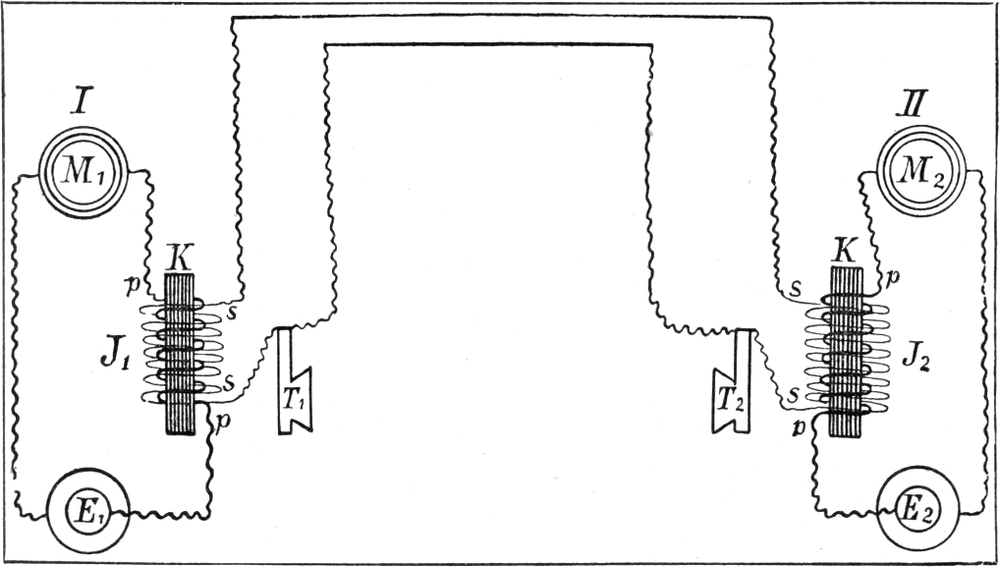
Abb. 172. Schema einer Telephonanlage.
Jedoch auch diese Vorrichtung genügte nicht, wenn man auf sehr große
Entfernungen sprechen wollte; der Strom des Elementes wurde in
einer langen Leitung zu sehr geschwächt. Aber gerade der Umstand,
daß der durch das Mikrophon gehende Strom durch die Schallwellen in
Schwankungen gerät, ermöglicht es uns, ihn zu transformieren, auf eine
andere Spannung zu bringen, genau so, wie wir die Wechselströme in
den Transformatoren transformiert haben. Die sich dadurch ergebende
Schaltungsweise ist aus Abb. 172 zu erkennen: I und II bezeichnen
die beiden Fernsprechstationen. Wird nun in I gesprochen, so macht
der Strom folgenden Weg: er fließt von Element E₁ durch
das Mikrophon M₁ und durch die um einen Eisenkern K
gewundene primäre (dicke) Wickelung p der Induktionsrolle
J₁ zum Element E₁ zurück. Beim Durchgang durch das
Mikrophon, gegen welches gesprochen[S. 204] wird, wird er bald stärker, bald
schwächer, gerät also in Schwankungen. Dieser unstete Strom wird beim
Durchgang durch pp in J₁ in der sekundären Wickelung
ss auf hohe Spannung und geringe Stromstärke transformiert,
so daß er jetzt ohne erhebliche Verluste in die Ferne geleitet
werden kann. Er geht von J₁ zuerst durch das Telephon
T₁, durch den einen Ferndraht zu dem Telephon T₂,
durch J₂ und durch den anderen Ferndraht nach J₁
zurück. Da er in den Telephonen deren Stahlmagnete umkreist, teilt
er ihrem Magnetismus seine eigenen Schwankungen mit, dadurch gerät
die Eisenmembran in Schwingung, so daß man die gegen M₁
gesprochenen Worte in T₂ hören kann. In der gleichen Weise
kann man von Station II nach Station I sprechen.
Bei einer praktischen Fernsprechanlage muß natürlich noch ein
Anrufwecker (Klingel) und eine Vorrichtung vorhanden sein, die es
gestattet, wenn nicht gesprochen wird, den Batteriestrom auszuschalten,
damit die Elemente nicht erschöpft werden. (Siehe auch Herstellung
einer Telephonanlage im Anhang.) —
An dieser Stelle sei noch die Beschreibung der Herstellung der beiden
vorerwähnten Meßinstrumente für Wechselstrom, dessen theoretische
Betrachtungen auf Seite 187 nicht unterbrochen werden sollten,
nachgeholt.
Das Hitzdrahtinstrument.
Ein genau arbeitendes Hitzdrahtinstrument können wir uns nicht
selbst herstellen, wenigstens nicht für geringe Stromstärken, da
es ohne korrigierende Vorrichtungen auch auf die Schwankungen der
Lufttemperatur reagiert. Da es aber theoretisches Interesse darbietet,
auch zur Demonstration sehr geeignet und, wenn keine Ansprüche an
Genauigkeit und Präzision gestellt werden, sehr leicht anzufertigen
ist, so sei seine Herstellung hier beschrieben.
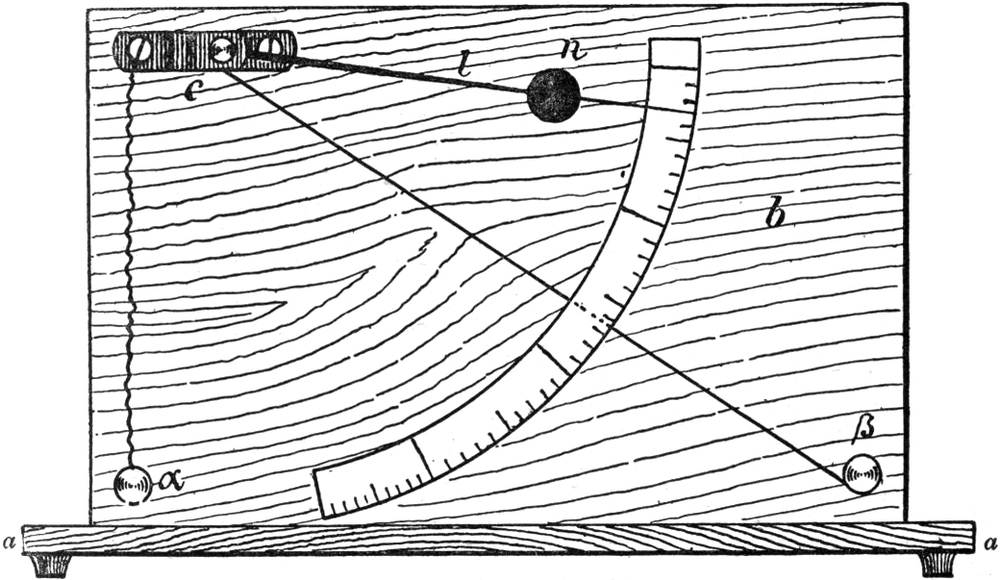
Abb. 173. Das Hitzdrahtinstrument.
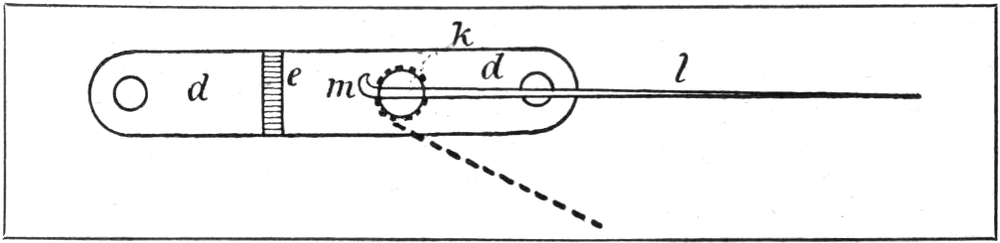
Abb. 174. Lager für den Zeiger des Hitzdrahtinstrumentes
(Vertikalschnitt).
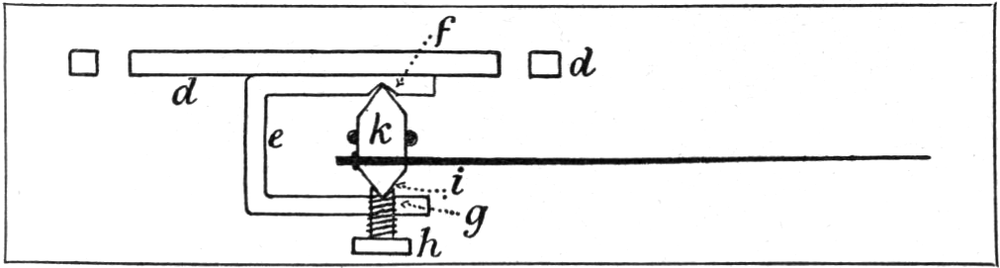
Abb. 175. Dasselbe (Horizontalschnitt).
Auf ein langes, schmales Grundbrett a (Abb. 173), das mit
Stollen zu versehen ist, wird ein rechteckiges Brett b
aufgeschraubt. In der linken oberen Ecke wird die Lagervorrichtung
c für den Zeiger befestigt. Letztere ist in Abb. 174 und
175 besonders dargestellt. Auf ein längliches, etwa 1 mm
starkes Messingplättchen d wird der zweimal[S. 205] rechtwinkelig
gebogene Bügel e aufgelötet, der aus einem 1 bis 1,5 mm
starken Messingblechstreifen gefertigt ist. Dieser Bügel erhält
auf der Innenseite bei f einen ziemlich tiefen mit einem
Körner eingeschlagenen Punkt und bei g, genau dem Körnerpunkt
gegenüber, ein Loch, in das ein Muttergewinde geschnitten wird, damit
darin die Schraube h eingedreht werden kann. Letztere erhält bei
i ebenfalls einen Körnerpunkt. Ein etwa 2 mm starkes,
rundes Eisenstiftchen[S. 206] k wird auf beiden Seiten zugespitzt und
muß zwischen f und i eingespannt werden können. An dieses
Stiftchen wird ein 2 mm starker Eisendraht angelötet und an dem
kurzen auch noch etwas über k hinaussehenden Ende zum Häkchen
m gebogen. Soll das Instrument für Ströme mit mehreren Amperes
bestimmt sein, so muß der Zeiger, um stärker belastet werden zu können,
aus einem Blechstreifen hergestellt werden, etwa so, wie Abb. 176 zeigt.
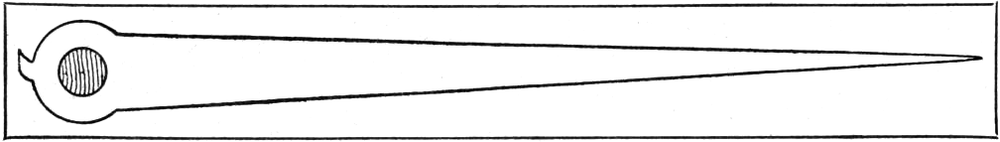
Abb. 176. Zeiger für das Hitzdrahtinstrument.
Das Stiftchen wird nun eingesetzt und die Schraube h soweit
angezogen, daß k nicht herausfallen, sich aber noch leicht
drehen kann. Dann wird ein Draht aus Nickelin (es kann auch Eisen,
Platin, sogar Kupfer verwendet werden), dessen Dicke sich nach den zu
messenden Stromstärken richten muß, an einem Ende mit einer Schleife
versehen, hiermit in das Häkchen m eingehängt und, von vorn
gesehen, einmal links herum um k gewunden und dann an der Klemme
β befestigt. Der Draht muß so gespannt werden, daß der Zeiger l
horizontal liegt. Die Klemme α wird noch durch einen Kupferdraht mit
c verbunden, wonach eine Skala, wie in Abb. 173 zu sehen ist,
auf b angebracht wird. Der Zeiger wird durch das Scheibchen
n aus Messing- oder Bleiblech so weit beschwert, daß der Draht
straff gespannt ist. Die Drahtdicke muß sich, wie schon erwähnt, nach
der Stromstärke richten. Für die Wechselströme, die die auf Seite 138
u. f. beschriebenen magnetelektrischen Maschinen liefern, wird ein 12
bis 15 cm langer (Strecke β bis c Abb. 173), 0,1 bis 0,2
mm starker Nickelindraht richtig sein. Ist der Draht aus einem
besser leitenden Metall, so muß er dünner und nötigenfalls auch länger
sein.
Die Wirkungsweise des Instrumentes ist sehr einfach. Fließt durch den
Draht ein Strom, so entwickelt sich infolge seines großen Widerstandes
Joulesche Wärme (von der wir auf Seite 202 sprachen); der Draht wird
deshalb länger und läßt den Zeiger sinken.
[S. 207]
Das Elektrodynamometer.
Das Elektrodynamometer können wir bei sorgfältiger Ausführung
weit empfindlicher und genauer arbeitend herstellen als das
Hitzdrahtinstrument. Es besteht aus einer festen und einer beweglichen
Drahtspule. Da beide Spulen gleichzeitig vom Strome durchflossen
werden, so wird die bewegliche immer nach der gleichen Seite hin
abgelenkt, auch wenn sich die Stromrichtung umkehrt.
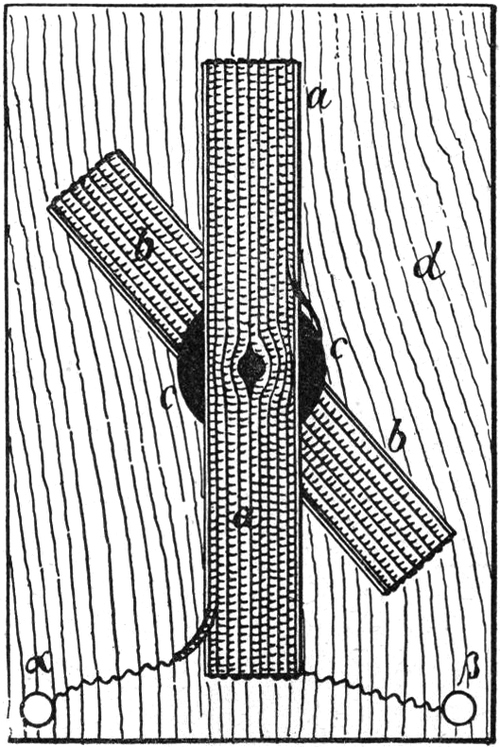
Abb. 177. Das Elektrodynamometer.
Abb. 177 zeigt ein Elektrodynamometer von oben gesehen. Wir stellen
aus Messingblech einen Rahmen a her, etwa 10 cm lang,
2,5 cm hoch und 1,5 cm breit. Dieser Rahmen wird mit
etwa 20 m eines 0,7 bis 0,8 mm starken, isolierten
Kupferdrahtes bewickelt. Je schwächer der zu messende Strom ist, desto
dünner und länger muß der Draht sein. Ein zweiter Rahmen b, der
in den ersten hineinpaßt, wird mit etwa 15 m Draht bewickelt.
In die Mitten der Langseiten werden bei beiden Rahmen 2 mm
weite Löcher gebohrt; auf diese Löcher werden bei dem größeren
Rahmen (a) außen kurze Stückchen eines 3 mm weiten
Messingrohres aufgelötet, damit das Loch nicht von der Bewickelung
verdeckt wird; bei dem kleineren Rahmen (b) wird durch die
beiden ein 2 mm starkes Messingstäbchen als Achse gesteckt;
letzteres soll ziemlich fest sitzen, aber in den Bohrungen von a
sich leicht drehen können. Das eine Ende der Bewickelung von b
wird an der Achse angelötet; das andere Ende wird zu einem runden
Blechscheibchen c geführt, das mit Schellackkitt (Seite 5) auf
b befestigt wird. Auf diesem Scheibchen liegt das eine Ende der
Bewickelung von a auf. Jetzt wird der größere Rahmen,[S. 208] wie aus
der Abbildung zu sehen ist, auf ein senkrecht stehendes Brett d
mit Schellackkitt aufgekittet. Die Klemme α wird mit dem noch freien
Drahtende von a, die Klemme β mit einem an dem Rahmen von
a angelöteten Draht verbunden. Sollte der Rahmen b sich
im indifferenten Gleichgewicht befinden, so muß er so beschwert werden,
daß seine Längsachse in der Ruhelage lotrecht steht.
Wird das Instrument von einem Strome, sei es ein Gleich- oder ein
Wechselstrom, durchflossen, so wird der Rahmen b aus seiner
lotrechten Lage abgelenkt. Wir können an dem beweglichen Rahmen einen
Zeiger und auf d eine Skala anbringen und das Instrument durch
Vergleich mit einem anderen eichen; dabei müssen natürlich das zu
eichende und das Vergleichsinstrument hintereinander geschaltet werden
(siehe auch Seite 98).
Das im Anhang beschriebene Universalinstrument ist ebenfalls
für Wechselströme verwendbar. Wir können uns, wenn uns der oben
beschriebene Apparat zu einfach und das Universalinstrument zu
umständlich ist, etwa in der Mitte zwischen beiden halten.
So können wir z. B. das oben beschriebene Instrument dadurch wesentlich
verfeinern, daß wir die Lager der beweglichen Spule sorgfältiger
herstellen, indem wir folgendermaßen verfahren: In die Mitten der
Längsseiten der äußeren Spule wird, wie auch schon oben beschrieben, je
ein Messingröhrchen eingesetzt. Nun darf aber die Achse der beweglichen
Spule nicht in diesen Röhrchen gelagert sein, sondern muß freien
Spielraum in ihnen haben und besonders gelagert werden. Zu diesem Zweck
wird das Brett d so durchbohrt, daß das Loch eine Fortsetzung
zu den durch die Messingröhrchen gebildeten Öffnungen in der äußeren
Spule darstellt. Die Lagerung der Achse kann dann in der auf Seite 205
beim Hitzdrahtinstrument beschriebenen Weise hergestellt werden; die
Stromzuführung geschieht in dem Fall entweder durch zwei auf der Achse
sitzende Schleifringe oder nach der im Anhange beim Universalinstrument
beschriebenen Methode. Auch ist es besser, die innere Spule so zu
gestalten, daß ihre Längsachse die größere Ausdehnung hat.
Um anschauliche Experimente über den Durchgang der Elektrizität durch
verdünnte, das heißt unter geringem Druck stehende Gase vorzuführen,
brauchen wir vor allem eine hinreichend starke Quelle für hochgespannte
Elektrizität. Für geringe Ansprüche genügen schon Funkeninduktoren
von 1 bis 2 mm Funkenlänge. Je größer und leistungsfähiger
unser Apparat ist, desto glänzender und vielseitiger können wir unsere
Versuche gestalten. Für sehr viele hierher gehörende Experimente ist
die Influenzelektrisiermaschine dem Funkeninduktor vorzuziehen, da bei
ihr, wenn man keine Kondensatoren einschaltet, die Lichterscheinungen
ruhiger sind. Sie hat freilich den Nachteil, daß wir zu ihrer Bedienung
eine zweite Person brauchen, und ferner, daß sie bei feuchtem Wetter
nie sicher arbeitet.
Da sich für die Verwendung von Leidener Flaschen beim Gebrauch der
Influenzmaschine für die einzelnen Fälle keine genauen Angaben
machen lassen, so sei hier ein für allemal gesagt, daß man sämtliche
Experimente mit verschiedenen Kapazitäten anstellen soll; es ist auch
hier der im Anhang beschriebene variable Kondensator recht brauchbar;
es ist dann leicht zu erkennen, in welchem Falle man die bessere
Wirkung erzielt. Der Kondensator verstärkt meist die Wirkung, die
Lichterscheinungen werden aber unruhig und zuckend.
Rudi bediente sich seiner selbstgefertigten Influenzmaschine
(Seite 19 u. f.), die wir noch vom ersten Vortrage her kennen. Er
hatte ja eine unermüdliche Assistentin, seine Schwester Käthe, die
ihm bei allen Versuchen die Maschine drehte. Außerdem hatte er
sich eine Trockenvorrichtung hergestellt, so daß er auch von dem
Feuchtigkeitsgrade der Luft nur noch wenig abhängig war.
[S. 210]
Der Trockenapparat.
Diese Trockenvorrichtung bestand aus einem Eisenblech, das etwa 30
cm länger und breiter war als das Grundbrett der Maschine und an
dessen vier Ecken je eine lange Eisenstange eingenietet war, so daß das
Eisenblech auf den vier Füßen hoch genug stand, um die Influenzmaschine
unter sich aufzunehmen. Rechts und links von der Maschine stellte
Rudi dann zwei Argandbrenner[6] mit Asbestzylinder so auf, daß der
obere Zylinderrand sich etwa 6 cm unter dem Eisenblech befand.
Etwa zehn Minuten vor Gebrauch der Maschine zündete er die Lampen an;
solange er die Maschine benützte, stellte er sie aber beiseite und ließ
nur noch das heiße Eisenblech über ihr (Abb. 178).
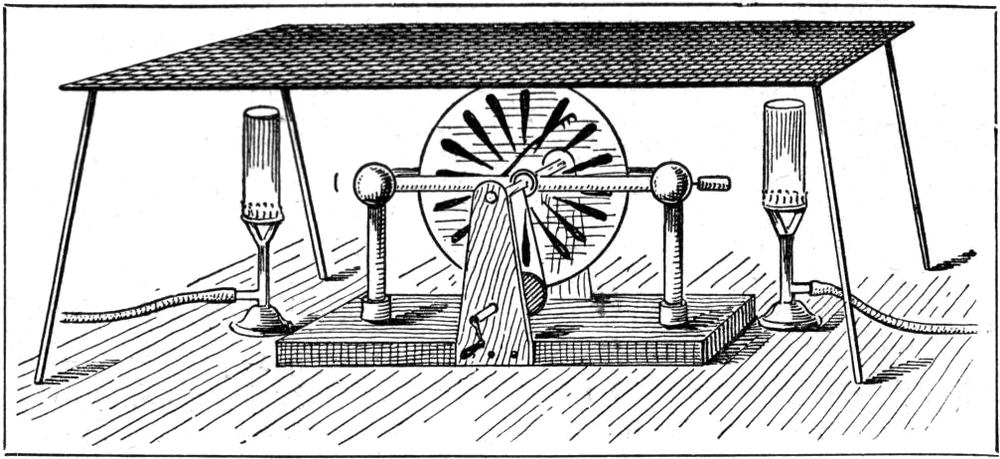
Abb 178. Trockenapparat für die Influenzmaschine.
Da an dem Tag des Vortrages die Luft außerordentlich trocken war,
hielt es Rudi für überflüssig, den Trockenapparat zu verwenden. Er
probierte kurz vor dem Vortrag alle wichtigen Experimente noch einmal
durch, und sie gelangen mit seltener Leichtigkeit. Aber während des
Vortrages wurde die Wirkung der Maschine immer schlechter, und er mußte
schließlich entgegen seinem ursprünglichen Vorhaben den Funkeninduktor
verwenden.
Es war Rudi bald klar, daß diese Störung nur daher kommen konnte, daß
durch die Anwesenheit der vielen Personen die Luft im Zimmer ständig
feuchter wurde. Er ließ deshalb bei dem nächsten Vortrage seine Hörer
sich in einem[S. 211] anderen Zimmer versammeln und erst kurz vor Beginn
in den Vortragsraum eintreten. Ferner hatte er die Maschine, bis er
sie zum ersten Male gebrauchte, im angrenzenden Zimmer unter dem
Trockenapparate stehen. Erst zum Beginn der ersten Experimente brachte
Käthe die Maschine samt dem heißen Blechdach, aber ohne die Lampen,
herein.
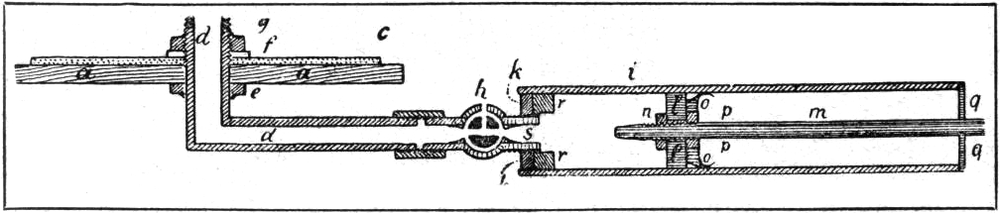
Abb. 179. Schnitt durch die Vakuumpumpe.
Die Vakuumpumpe.
Um zu zeigen, wie sich der Ausgleich der Elektrizitäten einer
Influenzelektrisiermaschine in einem abgeschlossenen Raum bei
zunehmender Verringerung des Luftdruckes verändert, bedürfen wir einer
Luftpumpe, einer sogenannten Vakuumpumpe, die man sich in einfacher
Form ziemlich leicht selbst herstellen kann.
Abb. 179 zeigt den Schnitt durch eine solche Pumpe, die an jedem Tische
befestigt werden kann, und für die wichtigsten Versuche ausreicht.
(In der Abbildung ist der Zylinder der Pumpe im Verhältnis zum Teller
größer gezeichnet, damit die einzelnen Teile deutlicher sichtbar sind.)
Den Teller a sägen wir aus einem 1 bis 2 cm dicken
Brette von Hartholz; er soll einen Durchmesser von 20 bis 25 cm
bekommen und muß vollkommen eben und in der Mitte mit einer Bohrung
versehen sein. Um einem Verziehen des Holzes vorzubeugen, bestreichen
wir ihn mit geschmolzenem Paraffin, das wir ziemlich reichlich
auftragen und dann mit einem recht heißen Plätteisen nochmals
überfahren, damit es gut in alle Poren des Holzes eindringt.
Solange das Brett noch warm ist, wird auf die Oberseite eine 2 bis
3 mm dicke Schicht unseres bekannten Kolophonium-, Wachs-
oder Leinölkittes, der ziemlich hart sein soll (Seite 66),
aufgetragen. Darauf wird eine runde, ebenfalls mit einem Loch versehene
angewärmte Glasplatte (c) (womöglich Spiegelglas) vorsichtig
aufgepreßt (über das Durchbohren von Glas siehe Seite 12 und 13).
[S. 212]
Nach dem Erkalten muß die Glasplatte eben, bei Spiegelglas nur
leicht matt abgeschliffen werden. Wir befreien eine unbrauchbare
photographische Platte in der Größe von 9 × 12 cm von ihrer
Gelatineschicht und kitten mit Kolophonium-Wachskitt ein etwa 5 ×
8 cm großes und 2 cm dickes Holzklötzchen auf. Jetzt
beschaffen wir uns die drei feinsten Nummern Schmirgelpapier,
überschwemmen die ganze Glasplatte mit Wasser, streuen reichlich von
dem wenigst feinen Schmirgel darauf und schleifen mit der Glasplatte
die Platte des Tellers eben, wobei wir den an der Glasplatte
befestigten Holzklotz als Griff benutzen. Beide Glasplatten werden
matt, aber zuerst nur an einzelnen, an den erhabenen Punkten. Um sich
von Zeit zu Zeit von dem Fortgang der Arbeit zu überzeugen, spült
man den Glasteller mit Wasser ab und reibt ihn dann mit einem Tuche
trocken. Die geebneten Stellen sind dann, da sie matt sind, leicht von
den noch unebenen zu unterscheiden. Ist die ganze Platte gleichmäßig
matt, was nach etwa einer halben Stunde tüchtigen Schleifens erreicht
sein dürfte, dann schleifen wir während der Hälfte der bis jetzt
aufgewendeten Zeit mit dem feineren, ebensolange mit dem feinsten
Schmirgelpulver und schließlich ohne solches — nur mit Wasser — nach.
Jetzt besorgen wir uns ein rechtwinkelig gebogenes Gasleitungsrohr
d; beide Enden werden mit Gewinden versehen. Das Rohr muß
sich gerade durch das Loch von a hindurchschieben lassen. An
dem kürzeren Schenkel wird der Ring e angelötet, auf welchem
a aufliegt. Dann wird ein das Rohr eng umschließender Gummiring
f aufgelegt und mit der Schraubenmutter g gegen c
gepreßt. Die Schraubenmutter wird schließlich an d angelötet.
Die Verbindungsstelle zwischen Rohr und Teller wird mit der Zeit leicht
undicht; man kann deshalb gleich von vornherein alle in Frage kommenden
Fugen mit Schellackkitt (Seite 5), auch Siegellack oder Emaillack
überziehen, hauptsächlich auf der Seite, von welcher der Luftdruck
wirkt, also auf der Außenseite.
Der zweite wichtige Bestandteil unseres Apparates ist der sogenannte
Zweiwegehahn. Er ist in der Abb. 179 im Querschnitte gezeichnet.
Wir stellen ihn aus einem[S. 213] einfachen Gashahn (Abb. 180) her, den wir
am besten neu kaufen. Ein solcher Hahn besteht aus einem kugelförmigen
Mittelstück und zwei mit Gewinden versehenen Rohransätzen. In dem
Mittelstück kann ein konischer Bolzen, der quer durchbohrt ist, gedreht
werden. Steht diese Bohrung senkrecht zur Achse der Rohransätze, so ist
der Hahn geschlossen, wird dieser um 90° gedreht, so ist er geöffnet.
An den meisten Gashähnen sind in den Bolzen kleine Stifte, die eine
Drehung von mehr als 90° verhindern; diese müssen entfernt werden, so
daß man den Bolzen vollständig umdrehen kann. Jetzt wird letzterer
so gestellt, daß der Hahn geöffnet ist; dann bohren wir durch das
Mittelstück und durch die Hälfte des Bolzens ein Loch, wie dies aus den
Abbildungen deutlich zu sehen ist (h in Abb. 179).
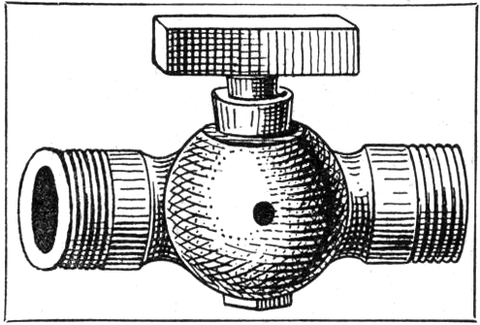
Abb. 180. Der in einen Zweiwegehahn veränderte Gashahn.
Der dritte Bestandteil ist die Pumpe. Wir kaufen uns ein 2 bis 3
cm weites, etwa 30 cm langes starkwandiges Messingrohr
(i). In dem einen Ende dieses Rohres wird der Ring k
eingelötet, der mit einem Muttergewinde versehen ist. In letzteres wird
der Hahn h eingeschraubt und ebenfalls verlötet.
Wir kommen nun zur Herstellung des Kolbens. Eine 2 bis 3 mm
starke Messing- oder Eisenscheibe l, die gerade in das Rohr
hineinpaßt, erhält in der Mitte eine Bohrung (ohne Gewinde), durch
die man das mit einem Gewinde versehene Ende der Eisenstange m
hindurchschieben kann. An dieser Stange ist das Messingscheibchen
p angelötet, dessen Halbmesser um etwa 2 mm kleiner ist
als der von l. Dann schneiden wir uns von alten Glacéhandschuhen
drei bis vier runde Scheibchen, die in der Mitte mit einem Loch
versehen sind, und deren Halbmesser etwa um 5 mm größer ist
als der von l und legen sie einige Zeit in reines Maschinenöl.
Wenn sie vollständig durchtränkt sind, bringen wir sie auf das
Messingscheibchen[S. 214] p, wie aus der Abb. 179 zu erkennen ist
(o); darauf wird l mit der auf m aufgeschraubten
Mutter n fest gegen p angepreßt. Das Blechscheibchen
q dient zur Führung der Stange m.
Das Kolbenende der Stange m soll so lang sein, daß es durch
den Ansatz des Hahnes bis auf den Stöpsel hindurchgeht; es soll auch
möglichst genau in jene Öffnung hineinpassen, damit der sogenannte
schädliche Raum s möglichst klein wird. Aus dem gleichen Grunde
müssen wir auch noch die leeren Kanten bei r mit Wachs oder
Paraffin ausfüllen.
Wir nehmen zu diesem Zweck den Stöpsel aus dem Hahne heraus und machen
letzteren etwas warm, dann schieben wir den Kolben so weit in den
Zylinder hinein, daß die Öffnung s gerade noch frei bleibt.
Jetzt stellen wir die Pumpe so auf, daß der Hahn oben ist, gießen durch
letzteren möglichst heißes Paraffin in den Zylinder und drücken dann
den Kolben so weit als möglich hinein, wobei natürlich wieder etwas
Paraffin herausgetrieben wird. Nach dem Erkalten wird das Loch für den
Stöpsel und der äußere Rohransatz vom Paraffin gereinigt. Letzterer
wird nun, wie aus Abb. 179 zu erkennen ist, mit dem Rohre d
verbunden.
Wir können uns auch noch eine Glasglocke, den Rezipienten, selbst
herstellen. Wir beschaffen uns eine starkwandige, möglichst weite
Flasche aus weißem Glas, deren Boden wir möglichst glatt entfernen
müssen. Wir umkleben sie deshalb da, wo sie gesprengt werden soll, mit
zwei mehrmals herumgewundenen Papierstreifen, die einen nur 2 bis 3
mm breiten Raum zwischen sich frei lassen. In dieser Rinne legen
wir eine gut gezwirnte, möglichst harte Schnur einmal um die Flasche,
befestigen an dem einen Schnurende ein 1 bis 2 kg schweres
Gewicht und an dem anderen einen runden Holzstab. Die Flasche lassen
wir von einer zweiten Person halten und ziehen nun, die Schnur an dem
Holzgriff fassend, das Gewicht auf, lassen es sinken, ziehen es wieder
auf u. s. f., bis infolge der Reibung die Hitze so groß wird, daß die
Schnur durchbrennt und das Gewicht zu Boden fällt. Jetzt wird das[S. 215]
Bodenende der Flasche so rasch als möglich in kaltes Wasser getaucht.
Entlang der von der Schnur berührt gewesenen Stelle springt der Boden
ab. Ein anderes Verfahren besteht darin, daß man zuerst die Flasche
unter ständigem Drehen über einer Flamme auf etwa 250° erhitzt und
dann da, wo der Sprung entstehen soll, einen mit Salzwasser benetzten
Bindfaden herumschlingt.
Der dadurch entstandene Rand der Flasche ist jetzt noch eben zu
schleifen; diese Arbeit nehmen wir auf einer möglichst ebenen
Sandsteinplatte mit Wasser und Schmirgel vor.
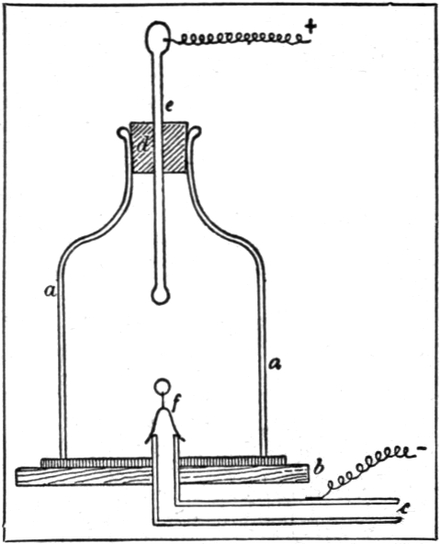
Abb. 181. Der Rezipient als Entladungsröhre.
Um elektrische Ausgleiche in dem Rezipienten vornehmen zu können,
führen wir durch einen durchbohrten Gummistöpsel eine Messingstange
ein, die die eine Elektrode bildet; als die andere Elektrode dient uns
das durch den Teller führende Metallrohr. Der untere eben geschliffene
Rand der Glasglocke wird zur besseren Abdichtung mit Talg eingerieben.
Die ganze Anordnung geht aus Abb. 181 hervor: a ist die Glocke,
b der Teller, c das Rohr, das zur Pumpe führt, d
der Gummistopfen, in dem die Messingstange e steckt. Ein aus
Draht gebogener und mit einer Kugel versehener Dreifuß f bildet
auf das Rohrende gesetzt die zweite Elektrode.
Wer sich selbst Geißlersche Röhren herstellen will, der muß im
Glasblasen einige Übung besitzen. Einfache Röhren sind nicht schwer
herzustellen. Wir schmelzen in das eine Ende eines 0,5 bis 1 cm
weiten Glasrohres — die Länge richtet sich nach der Leistungsfähigkeit
unserer Apparate — einen Platindraht ein; nahe diesem Ende setzen
wir ein etwas dünneres Röhrchen nach der Seite an und schmelzen
dann auch in das andere Ende einen Platindraht ein. Wie diese Röhre
mit dem Rezipienten zu verbinden ist, geht[S. 216]
aus Abb. 182 hervor. In
den Schlauch a ist, damit er nicht von dem äußeren Luftdruck
zusammengequetscht werde, eine eng gewundene Drahtspirale zu stecken.
Während des Auspumpens der Röhre läßt man den elektrischen Strom
hindurchgehen; ist dann die Lichterscheinung so, wie man sie wünscht
— man kann sie natürlich nur im verdunkelten Zimmer gut sehen —, so
pumpt man noch etwas weiter und schmilzt dann die Röhre ab.
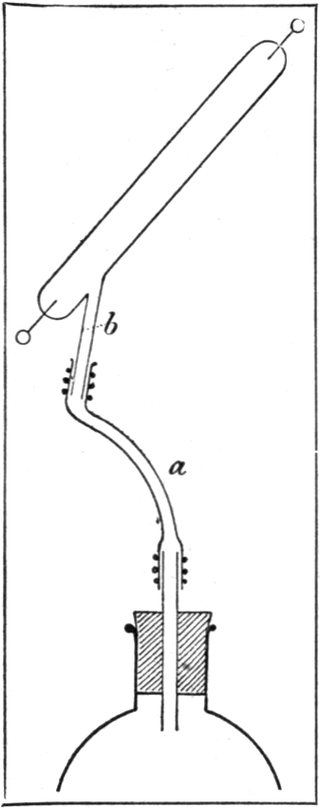
Abb. 182. Verbindung der Geißlerröhre mit dem
Rezipienten zum Auspumpen.
Um die Verdünnungen in Röhren noch weiter treiben zu können, müssen wir
die Geißlersche Röhre samt dem Schlauch a (Abb. 182) und der
Glasröhre, die durch den Gummistöpsel geht, mit Quecksilber anfüllen.
Nachdem wir uns überzeugt haben, daß nirgendmehr Luftblasen haften,
stecken wir den Gummistöpsel auf den Rezipienten und pumpen denselben
aus, bis alles Quecksilber aus der Röhre zurückgesunken ist, aber nicht
weiter, als bis zu der in Abb. 182 mit b bezeichneten Stelle,
da in dem Schlauch a meistens Luftbläschen haften bleiben. In
der Mitte zwischen b und der Ansatzstelle wird das Röhrchen dann
abgeschmolzen.
Wie weit wir mit diesen Apparaten die Verdünnung in einer Röhre bringen
können, hängt natürlich von ihrer Ausführung und Handhabung ab. Die
für gewöhnliche Geißlersche Röhren nötige Verdünnung ist leicht zu
erreichen; viel schwieriger ist es schon, Röhren für Kathodenstrahlen
herzustellen. In Röntgenröhren schließlich ist die Verdünnung der Luft
so stark, daß wir den Versuch, uns solche selbst herzustellen, von
vornherein aufgeben müssen. —
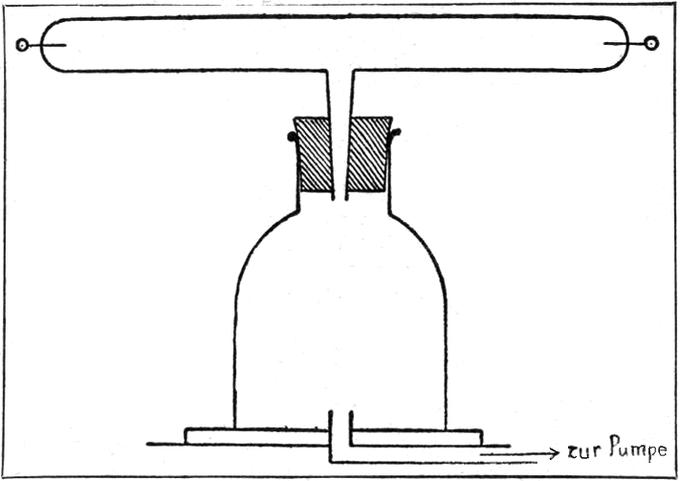
Abb. 183. Einfache Röhre auf dem Rezipienten.
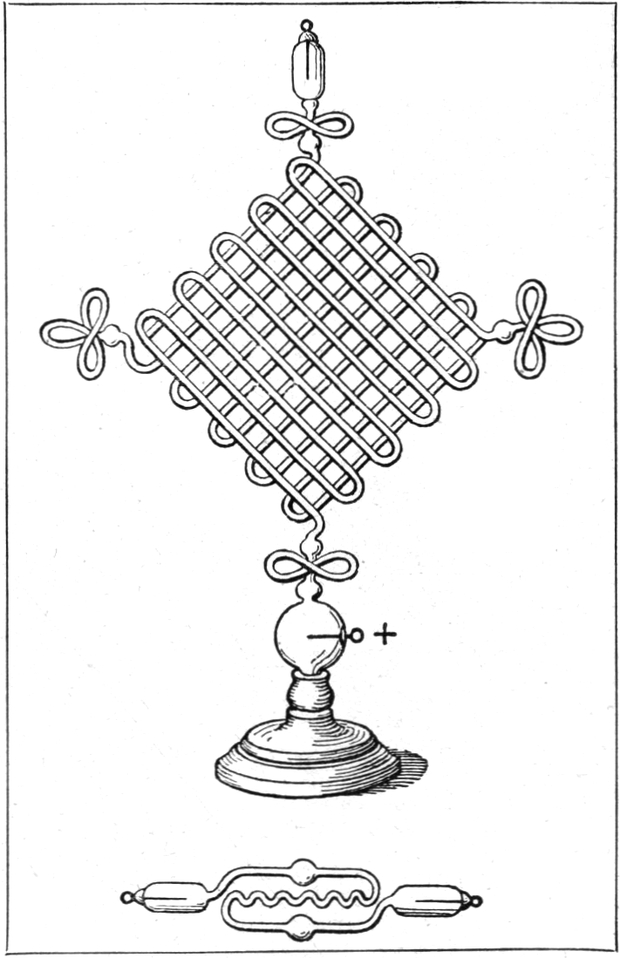
Abb. 184. Geißlersche Röhren, ungefüllt.
Experimente mit der Luftpumpe.
Wir setzen auf den Rezipienten, wie aus Abb. 183 hervorgeht, eine
einfache Röhre mit eingeschmolzenen Platinelektroden, deren Abstand
größer als die Schlagweite[S. 217] unseres Funkeninduktors oder unserer
Influenzmaschine sein muß, und verbinden sie mit der Stromquelle.
Wir wählen Platin, weil es zum Einschmelzen in Glas das geeignetste
Metall ist, da es fast denselben Ausdehnungskoeffizienten hat wie
Glas. Für einfachere Instrumente, wie das oben erwähnte, genügt auch
Aluminiumdraht, der den Vorteil hat, wesentlich billiger zu sein; wenn
wir dann die Einschmelzstelle, solange sie noch warm ist, mit gutem
roten Siegellack überziehen, so hält sie sicher dicht. Im verdunkelten
Raum sieht man dann an den Elektroden nur sehr schwaches[S. 218] Glimmlicht.
Fängt man dann an, die Pumpe in Tätigkeit zu setzen, so wird der
Lichtbüschel an der Kathode (negative Elektrode) heller, größer und
schärfer abgegrenzt, und an der Anode (positive Elektrode) zeigt
sich ein kleines helles Lichtpünktchen. Pumpt man weiter, so beginnt
schließlich der ganze Raum zwischen den Elektroden schwach zu leuchten:
ein violettes Lichtband zieht sich durch die Röhre, ohne aber ihre
Breite ganz zu erfüllen. Bei weiterer Verdünnung wird der violette
Streifen breiter, und man kann sehen, daß das Licht nicht einheitlich,
sondern geschichtet ist; die Röhre scheint erfüllt von einzelnen hellen
Scheibchen mit dunkeln Zwischenräumen. Dieses geschichtete Lichtband
beginnt unmittelbar an der Anode, geht aber[S. 219] nicht ganz bis zur Kathode
hin; hier bleibt ein dunkler Raum, der bei noch weiter gesteigerter
Verdünnung immer größer wird. Das positive Licht wird immer kürzer und
seine Schichtung immer undeutlicher.
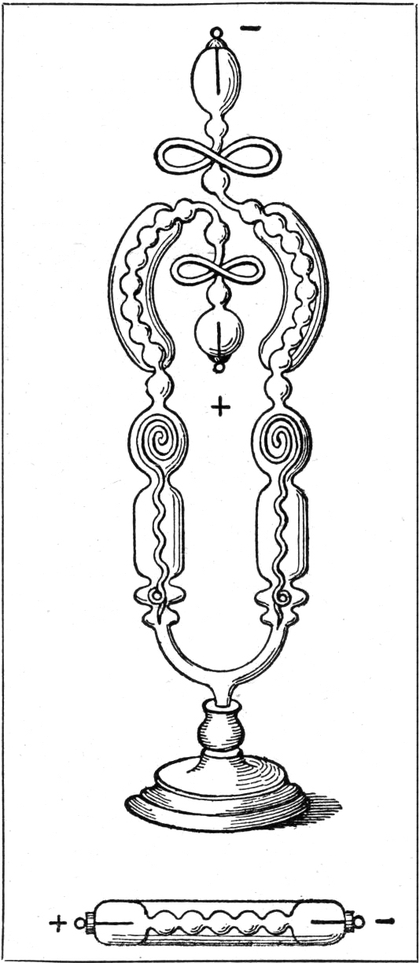
Abb. 185. Geißlersche Röhren. Zu füllen mit
fluoreszierenden Flüssigkeiten.
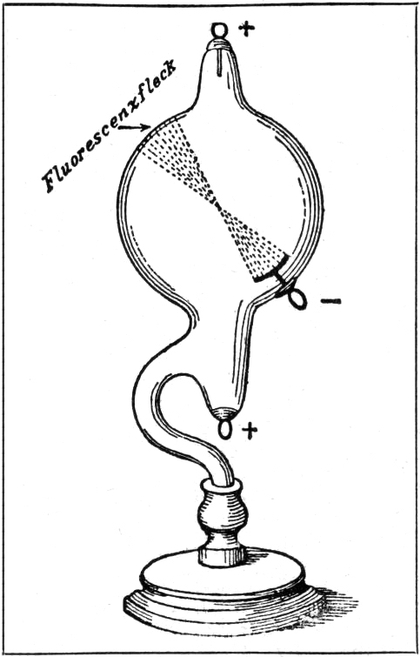
Abb. 186. Hittorfsche (Crookessche) Röhre.
Hier hörte die Leistungsfähigkeit der Pumpe, die sich Rudi selbst
gefertigt hatte, auf. Er hatte sich deshalb zur Demonstration der
Kathodenstrahlen eine sogenannte Crookessche Röhre (Abb. 186) gekauft.
Auch Geißlersche Röhren in verschiedenen Stufen der Evakuation und in
sehr mannigfaltigen Formen kommen in den Handel (Abb. 184 und Abb. 185).
Die Kathodenstrahlen.
Wird die Verdünnung in der Röhre noch weiter getrieben, so verschwindet
das positive Licht schließlich ganz, aber eine andere merkwürdige
Erscheinung tritt dafür ein. Es gehen nämlich von der Kathode Strahlen
aus, die man nicht sehen, sondern nur daran erkennen kann, daß sie die
Glaswand der Röhre da, wo sie sie treffen, zum Fluoreszieren bringen.
Bei unserer Röhre, in welche Drähte eingeschmolzen sind, wird das Glas
um die Anode herum grün leuchten. Besteht die Kathode aus einem runden
Blechscheibchen, so wird die dem Scheibchen gegenüberliegende Stelle
zum Fluoreszieren gebracht. Ist zwischen die negative Elektrode und die
gegenüberliegende Glaswand ein Gegenstand aus Metall gebracht, z. B.
ein Kreuz b wie in Abb. 187, so zeichnet dieser einen deutlichen
Schlagschatten d auf das Glas. Alle diese Erscheinungen weisen
darauf hin, daß die Kathodenstrahlen sich senkrecht zu der Fläche
des Punktes fortpflanzen, von dem sie ausgehen. Dabei ist es ganz
einerlei, an welcher Stelle sich die Anode befindet.
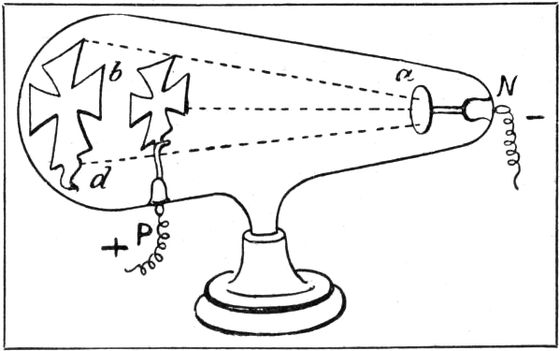
Abb. 187. Crookessche Röhre.
Eine weitere eigentümliche Eigenschaft dieser Strahlen ist die, daß sie
alle nicht metallischen Körper, die sie treffen, zur Phosphoreszenz
bringen. Man hat Röhren hergestellt,[S. 220] in denen verschiedene Mineralien
den Kathodenstrahlen ausgesetzt werden können; die Stoffe leuchten dann
je nach ihrer Natur in verschiedenen Farben auf.
Ferner kann man bemerken, daß das Glas einer Crookesschen Röhre,
da, wo es von den Kathodenstrahlen getroffen wird, also an der grün
fluoreszierenden Stelle, sich mit der Zeit stark erhitzt. Diese
Erwärmung kann so weit gehen, daß das Glas weich wird und dem äußeren
Luftdruck nachgibt. Von diesen Strahlen getroffene Metallteile können
bis zur Weißglut, ja bis zum Schmelzen gebracht werden.
Crookes entdeckte auch, daß die Kathodenstrahlen mechanische Wirkungen
ausüben können. Um das nachzuweisen, hat man in der Röhre ein leichtes
Flügelrädchen so angebracht, daß die obere Hälfte desselben sich gerade
zwischen den Elektroden befand. Wurde ein Strom durchgeleitet, so
drehte sich das Rädchen so, als ob von der Kathode ein Wind ausginge,
der, die oberen Flügelchen treffend, es zur Rotation brachte.
Bringen wir einen Magneten in die Nähe der Röhre, so sehen wir,
daß er die Kathodenstrahlen ablenkt. Wir können mit ihm den grünen
Fluoreszenzfleck von seiner ursprünglichen Stelle wegziehen; er
folgt genau den Bewegungen des Magneten. Rudi machte diesen Versuch
und verwendete dazu einen starken Elektromagneten, den er mit dem
Akkumulatorenstrom erregte.
Alle diese merkwürdigen Erscheinungen spielen sich ausschließlich in
der Röhre ab. Keine Spur von diesen geheimnisvollen Strahlen scheint
die Glaswand durchdringen zu können. Über die eigentliche Natur dieser
Strahlen, überhaupt über diese Entladungsvorgänge weiß man noch so gut
wie gar nichts.
Nur das eine steht ziemlich sicher fest, daß die Kathodenstrahlen
aus sehr kleinen Stoffteilen bestehen, die sich mit einer enormen
Geschwindigkeit durch den fast leeren Raum der Röhre bewegen. Mit
dieser Annahme lassen sich leicht für die oben erwähnten Eigenschaften
der Kathodenstrahlen Erklärungen geben, deren nähere Behandlung aber
hier zu weit führen würde.
Es sind verschiedene Versuche gemacht worden, die[S. 221] Kathodenstrahlen aus
der Röhre herauszuführen in die normale Atmosphäre, aber man ist bis
jetzt nicht weiter damit gekommen, als daß man eben nachweisen konnte,
daß die Strahlen auch außerhalb der Röhre bestehen können.
Die Röntgenstrahlen.
Lange boten die Kathodenstrahlen nur theoretisches Interesse, bis
Professor Röntgen im Jahre 1895 in Würzburg die Entdeckung machte, daß
von der von den Strahlen getroffenen Stelle der Crookesschen Röhre
andere Strahlen ausgehen, die sich wesentlich von den Kathodenstrahlen
unterscheiden. Röntgen selbst nannte sie X-Strahlen, während sie
sonst nach ihrem Entdecker Röntgenstrahlen genannt werden.
Diese geheimnisvollen Strahlen sind selbst unsichtbar und geben sich
nur durch verschiedene Wirkungen zu erkennen: Photographische Platten,
von ihnen getroffen, werden geschwärzt. Dabei hat sich auch gezeigt,
daß eine Papierverpackung oder eine Holzkassette der empfindlichen
Bromsilbergelatine keinen Schutz gegen diese Strahlen bietet; sie
gehen durch Holz und Papier fast ungeschwächt hindurch; nur dickere
Metallschichten können sie nicht durchdringen. Im allgemeinen kann man
annehmen, daß je dichter ein Körper ist, er sich desto undurchlässiger
für Röntgenstrahlen zeigt. Diese Eigentümlichkeit ist besonders
wichtig, und wir kommen später noch einmal darauf zurück.
Eine zweite für die Praxis sehr wertvolle Eigenschaft der
Röntgenstrahlen ist ihre Fähigkeit, Fluoreszenz zu erregen. So leuchtet
z. B. Baryumplatincyanür, wenn es von den Röntgenstrahlen
getroffen wird, hell auf.
Wir haben schon oben gesehen, daß die X-Strahlen da entstehen,
wo die Kathodenstrahlen auf die Rohrwand auftreffen. Man hat nun
durch Versuche gefunden, daß die Röntgenstrahlen überhaupt überall da
entstehen, wo Kathodenstrahlen auf einen Gegenstand auftreffen.
Da es, wie wir späterhin noch sehen werden, für photographische
Aufnahmen mit Röntgenstrahlen nicht vorteilhaft ist, wenn die die
Strahlen aussendende Fläche groß ist, so hat man die Röhren so
konstruiert, daß die Kathodenstrahlen im Innern der Röhre auf ein
Platinblech auftreffen.[S. 222] Von diesem Platinbleche gehen sie dann wie von
einem Punkt kegelförmig aus.
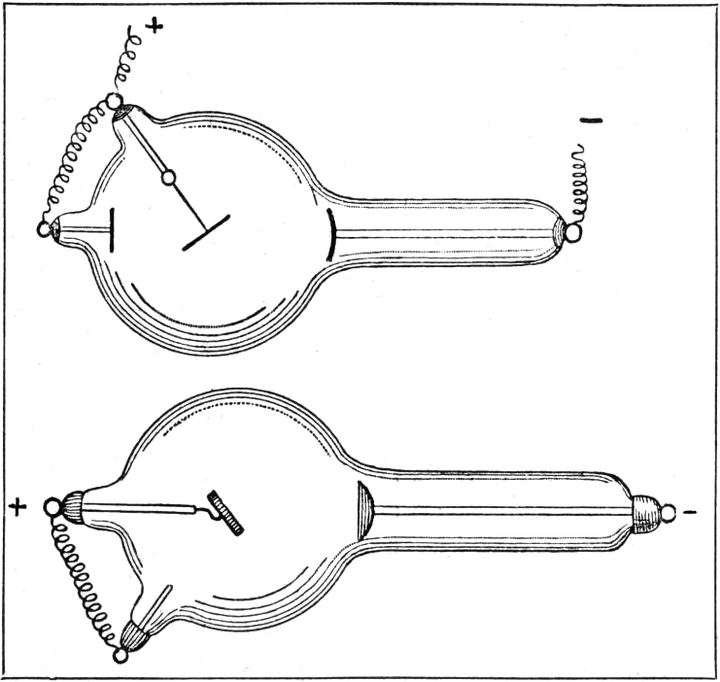
Abb. 188. Röntgenröhren.
Abb. 188 zeigt eine der gangbarsten Formen der Röntgenröhren. In der
Mitte des kugeligen Teiles der Röhre befindet sich das Platinblech,
das, von den Kathodenstrahlen getroffen, die Röntgenstrahlen aussendet
und als Antikathode bezeichnet wird. Diesem gegenüber (rechts)
steht die Kathode, und in dem dritten Ansatz ist die Anode, die durch
einen Draht mit der Antikathode verbunden ist.
Nach diesen theoretischen Ausführungen ging Rudi dazu über, eine
größere Anzahl von Experimenten mit der Röntgenröhre vorzuführen.
Er bediente sich dabei des Funkeninduktors, da dieser besonders
für diese Versuche geeigneter ist. Für solche, die keinen größeren
Induktor, aber eine gute Influenzmaschine besitzen, sei gesagt,
daß für photographische Aufnahmen die Maschine mit Leidener
Flaschen verwendet werden kann. Will man dagegen ein Schattenbild
auf dem Fluoreszenzschirm erzeugen, so kann man die Kondensatoren
nicht gebrauchen, da das Bild dann derartig flimmert, daß die
Augen schmerzen. Die besten Bilder erzielt man, wenn man vor jeder
Elektrode der Röhre eine Funkenstrecke einschaltet, deren günstigste
Größe man durch Probieren herausfinden muß. Abb. 189 zeigt eine
durch Funkenstrecken mit der Influenzelektrisiermaschine verbundene
Röntgenröhre. Die viereckigen Rähmchen,[S. 223] zwischen denen sich die Kugeln
befinden, müssen natürlich aus einem isolierenden Material, etwa aus
Hartgummi bestehen.
Rudi hatte versucht, sich den Fluoreszenzschirm selbst herzustellen,
indem er Kreide, Kochsalz und wolframsaures Natron zu gleichen
Teilen innig mengte und die Mischung dann in einem Tontiegel drei
Stunden lang mit einem Knallgasgebläse durchglühte. Die beim Erkalten
zusammengesinterte Masse pulverte er, mengte sie mit einem Bindemittel
(Gelatine) und strich sie auf einen Karton.
Obwohl Rudi genau nach Vorschrift verfahren war, war seine Mühe hier
von keinem guten Erfolg gekrönt, so daß er sich gezwungen sah, doch
noch einen fertigen Fluoreszenzschirm zu kaufen.
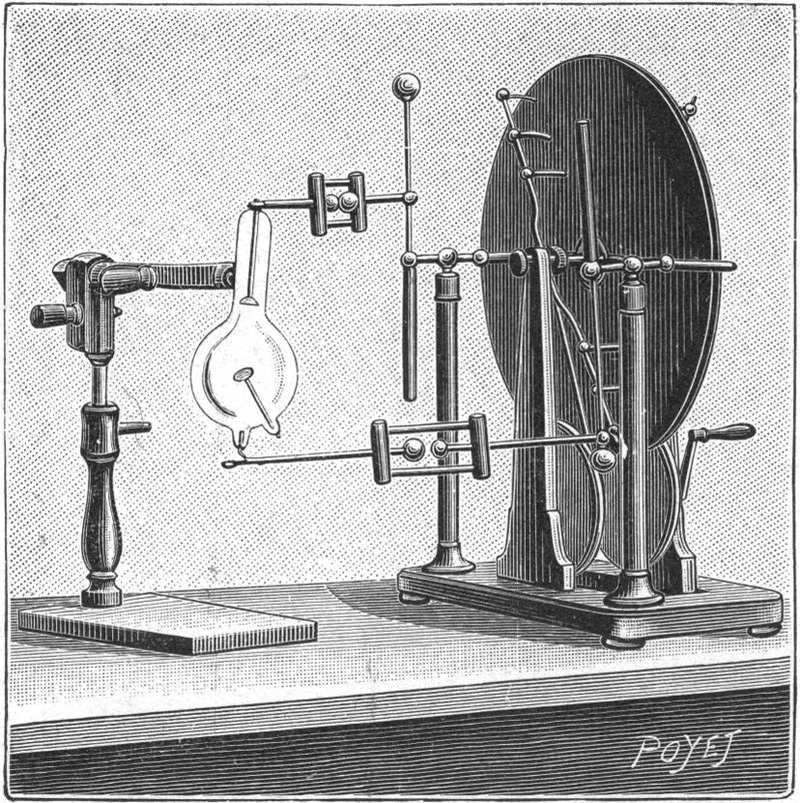
Abb. 189. Influenzmaschine und Röntgenröhre nach
Bonetti.
Bevor Rudi die Durchleuchtung auf dem Fluoreszenzschirm zeigte, machte
er ein photographisches Durchleuchtungsbild der Hand seiner
Schwester. Er hatte zu diesem Zweck eine photographische Platte von
der Größe 13 × 18 cm in ein lichtdichtes schwarzes Papier so
eingehüllt, daß die Schichtseite der Platte nur von einer
Papierlage bedeckt war. Die Röhre befestigte er an einem Gestell
derart, daß der von der Antikathode ausgehende[S. 224] Strahlenkegel senkrecht
nach unten wirkte. Dann legte er die eingewickelte Platte mit der
Schichtseite nach oben unter die Röhre in einem Abstand von etwa
30 cm auf den Tisch. Auf die Platte legte dann Käthe ihre
ausgestreckte Hand, und Rudi schaltete den Strom ein. Nach kurzer Zeit
— je nach der Größe der Röhre beträgt die Dauer etwa drei bis sechs
Minuten — stellte er die Bestrahlung ab.
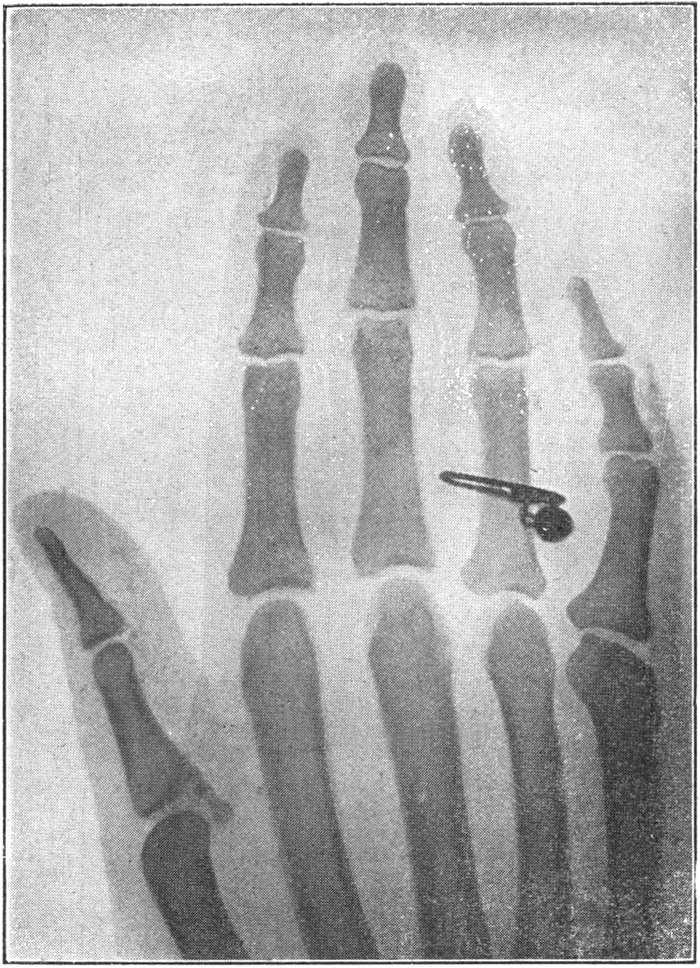
Abb. 190. Hand, von Röntgenstrahlen durchleuchtet.
Während nun Rudi noch einige erklärende Worte sprach, zündete Käthe
eine Lampe mit rotem Zylinder an und löschte alle übrigen Lichter
aus — näheres über die Raumverdunkelung siehe unten. Alle nötigen
Utensilien zum Entwickeln waren schon gerichtet. In wenigen Minuten, in
denen Rudi auch noch das Wesentlichste über die photographische Platte
und ihre Eigenschaften sagte, hatte die eifrige Assistentin das Bild
fertiggestellt, und während er das äußerlich anhaftende Fixiernatron
mit Wasser abspülte, machte seine Schwester wieder Licht und reichte
dann die Platte herum. Man sah ganz deutlich die einzelnen Knochen der
Hand,[S. 225] da an den unter diesen gelegenen Stellen die Bromsilbergelatine
nicht geschwärzt, also fast ganz durchsichtig war. Auch die Konturen
der Fleischteile waren deutlich zu erkennen, und besonders schön konnte
man den Fingerring sehen.
Die Kopie, das heißt das Positiv einer solchen Aufnahme gibt das Bild
auf Seite 224 wieder.
Man kann die photographische Platte auch so verpacken, daß man sie in
der Verpackung, also bei hellem Licht, entwickelt und fixiert. Man
verfährt dabei folgendermaßen: Aus starkem, englischem, dunkelrotem
Fließkarton stellt man sich drei flache vierseitige Tüten her, die je
auf einer Seite offen und so groß sind, daß in die erste eine Platte
13 × 18 cm eingeschoben werden kann, die zweite Tüte muß sich
wiederum über die erste und die dritte schließlich über die zweite
stülpen lassen. Hat man beim Einlegen der Platte die Öffnung der Tüte
links, so muß die der zweiten rechts und die der dritten wieder links
sein. Die Platte wird natürlich in der Dunkelkammer in die Papierhüllen
gebracht und dann in eine lichtdichte Schachtel gelegt, der man sie
erst kurz vor Gebrauch entnimmt. Nach der Exposition wird sie samt
ihren Papierhüllen erst 1 bis 2 Minuten in Wasser gelegt, wobei man
durch Streichen und leichtes Drücken die Luft aus den Hüllen zu
entfernen sucht. Dann wird die äußerste der drei Hüllen unter Wasser
entfernt und die jetzt nur noch von zwei Hüllen umschlossene Platte
in einen ziemlich starken Entwickler mit ein wenig Bromkalium gelegt.
Nach etwa 5 bis 10 Minuten (je nach Expositionsdauer, Platten- und
Entwicklersorte) ist die Entwicklung beendet; dann kommt die Platte,
immer noch eingehüllt, 5 Minuten in Wasser und darauf 15 bis 20 Minuten
in frisches, starkes Fixierbad. Nunmehr kann sie ihren Hüllen
entnommen und bei Tageslicht betrachtet werden.
Zum Schlusse wollte Rudi noch jedem einzelnen seiner Hörer ein
Durchleuchtungsbild auf dem Fluoreszenzschirm zeigen. Er stellte
deshalb die Röhre so am vorderen Rande des Experimentiertisches auf,
daß die Strahlen schief nach oben und vorne fielen. Darauf zeigte
er, bevor er den Raum verdunkeln ließ, wie der zu durchleuchtende
Gegenstand und der Fluoreszenzschirm zu halten sind, und erklärte[S. 226]
dabei die Wirkungsweise des letzteren etwa folgendermaßen: Wie
wir vorhin schon gehört haben, ist Baryumplatincyanür ein Stoff,
der in hohem Grade die Eigenschaft besitzt, von Röntgenstrahlen
zur Fluoreszenz gebracht zu werden, das heißt er leuchtet an den
bestrahlten Stellen, je nach der Stärke der Bestrahlung mehr oder
weniger hell auf. Dieser Stoff wird auf einem schwarzen Karton
gleichmäßig verteilt. Bringt man zwischen die Röntgenröhre und den
Schirm, dessen fluoreszierende Seite natürlich von der Röhre ab-, dem
Auge zugewandt sein muß, einen Gegenstand, z. B. einen Geldbeutel, oder
ein Reißzeug, eine Hand, einen Arm, einen Regenschirm, so wird man
jeweils von den dichtesten Teilen, im Beutel also von den Geldstücken,
in der Hand von den Knochen usw., die schwarzen Silhouetten sich
deutlich von der helleren Umgebung abheben sehen.
Endlich wies Rudi noch auf den für einfache Verhältnisse ziemlich hohen
Preis der Röntgenröhren und der Fluoreszenzschirme hin und bat seine
Hörer, in dem dunklen Zimmer nicht zu drängen.
Daß diese Bitte nicht unbegründet war, bewies ein kleiner Unfall, der
trotz der Mahnung eintrat.
Die meisten Anwesenden hatten schon das Geld in ihrem Beutel, ohne ihn
zu öffnen, gezählt, oder ihr Handskelett oft nicht ohne ein heimliches
Grausen bewundert, als eben eine Freundin Käthes, die von den Apparaten
zurücktrat, dabei an eine hinter ihr stehende Person stieß, ausglitt
und mit der unwillkürlich nach einem Halt ausgestreckten Hand gerade
die eine Elektrode des Funkeninduktors ergriff. Mehr erschrocken als
vor Schmerz fuhr sie, nach Mädchenart laut aufschreiend, zurück und
fiel zu Boden; dabei riß sie die Röntgenröhre samt ihrem Träger mit.
Weiteres Unheil wurde durch die geistesgegenwärtige und gewandte
Handlungsweise Käthes verhindert, die trotz der völligen Finsternis
sofort an dem unten beschriebenen Beleuchtungsmechanismus war und Licht
machte. Jetzt war die Ordnung gleich wiederhergestellt. Niemand hatte
Schaden gelitten, auch die Röhre nicht, da sie an den Drähten hängen
geblieben und deshalb nicht zu Boden gestürzt war.
Um nun bei den Personen, die noch nicht an der Reihe[S. 227] waren, einen
ähnlichen Fall zu verhindern, stellte Rudi einen kleinen Tisch so vor
den Experimentiertisch, daß jeweils nur eine Person an die
Apparate herantreten konnte. —
Ich will nun noch anführen, was für einen Beleuchtungsmechanismus Rudi
für diesen Vortrag konstruiert hatte. Der Raum mußte nämlich, um die
zarten Lichter in den Geißlerschen Röhren möglichst sichtbar zu machen,
öfters verdunkelt werden. Da Rudi kein elektrisches Licht zur Verfügung
hatte, mußte er das Gaslicht so einrichten, daß er es ohne Umstände
öffnen und schließen konnte.
In der Mitte des Zimmers hing ein Kronleuchter mit einem mittleren
und vier äußeren Brennern. Den mittleren benutzte er nicht. Es
handelte sich also darum, ohne zwischen die unter den Lampen
sitzenden Leute treten zu müssen, das Licht anzünden und löschen
zu können. Zur Entzündung des Gases verwendete Rudi die bekannten
„Selbstzünder“. Sie haben für Auerbrenner die Form von
Staubhütchen und bergen in sich Platinschwamm, an dem sich das Gas
entzündet. Um einem Versagen dieser Selbstzünder vorzubeugen, hatte
er sie vorher über einem Bunsenbrenner vorgeglüht.
Um die vier Gashähne von der Wand aus hinter seinem Tisch öffnen und
schließen zu können, befestigte er an jedem einen Hebel aus dickem
Draht mit einem kleinen Bleigewicht derart, daß das Gewicht den Hahn
zuzog. Ferner befestigte er an jedem Hebel einen Bindfaden, den er
durch einen nahe der Decke an der Gasleitung befestigten Porzellanring
zog. Die vier Fadenenden verband er mit einer Schnur, die er an der
Decke entlangführte, bis an die Wand, wo er sie wieder durch einen
Porzellanring steckte und dann gerade herunterhängen ließ. Hing die
Schnur lose, so war kein Licht; wurde sie angezogen, so öffneten sich
die Hähne, und es wurde hell. Die Schnur konnte mit einer Öse in einen
Nagel an der Wand eingehängt werden.
Um bei den Versuchen mit Röntgenstrahlen nicht immer die Nacht
abwarten, oder ein Zimmer verdunkeln zu müssen, kann man sich um den
fluoreszierenden Karton herum einen Schirm legen, der die leuchtende
Fläche und die Augen vor Tageslicht schützt. Abb. 191 zeigt diesen
Apparat im Schnitt.[S. 228] a ist der Fluoreszenzschirm, der in die
Nute b des Rahmens c eingeschoben werden kann. An diesem
Rahmen ist ein Tuchsack d aus schwarzem, möglichst dichtem Tuch
angeleimt. Der Sack wird nach oben etwas enger und ist an dem Rahmen
e befestigt. An letzterem sind zwei bogenförmig ausgeschnittene
Kartonstücke angebracht; f₁ (ausgezogen) soll sich der
Wölbung der Stirne über den Augen anschließen; f₂ (punktiert)
hat einen Ausschnitt für die Nase. Um den Lichtabschluß möglichst
vollkommen zu machen, sind diese Kartonstücke mit langhaarigem
Samt überzogen. g ist ein Handgriff, und h sind zwei
Strebehölzer, die die beiden Holzrahmen auseinanderhalten; sie sind
abnehmbar, so daß man den ganzen Apparat auch zusammenlegen kann.
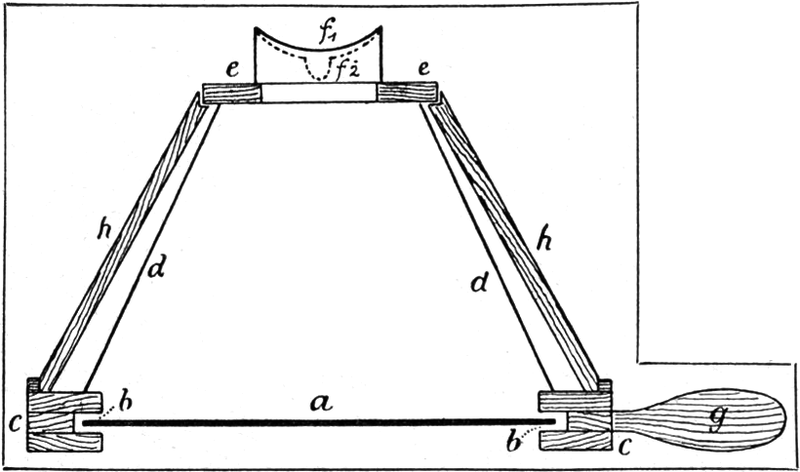
Abb. 191. Schnitt durch den Lichtschutzschirm.
Zum Gebrauche wird der Baryumplatincyanürschirm (a) mit der
fluoreszierenden Seite nach innen in den Rahmen eingeschoben. Dann läßt
man die Röntgenstrahlen von vorne oder von unten auf die Rückseite des
Schirmes, vor die man z. B. seine Hand hält, auffallen und nicht durch
die obere Öffnung in den Apparat hinein.
Zum Schlusse sprach Rudi noch einige Worte über die Verwendung der
Röntgenstrahlen in der Medizin. Er sagte: Die erste Verwendung der
Röntgenstrahlen in der Medizin lag sehr nahe; mit ihnen war den
Chirurgen ein Mittel an die Hand gegeben, vor operativen Eingriffen
sich von der Lage eines Fremdkörpers oder der Natur einer Fraktur
zu überzeugen. Ferner können Veränderungen im Knochengewebe, wie
solche z. B. bei Tuberkulose vorkommen, auf Radiogrammen, das sind
Photographien mit Röntgenstrahlen, sehr leicht erkannt werden. Ein ganz
neuer Zweig tat sich[S. 229] auf, als man entdeckte, daß die Röntgenstrahlen
auch auf das Gewebe des organischen Körpers verändernd einwirken. Wird
die Haut des menschlichen Körpers lange intensiv bestrahlt, so tritt
Entzündung der betreffenden Stelle ein und es entstehen schwer heilende
Wunden. Auch beim Arbeiten mit kleinen und schwachen Röntgenröhren ist
einige Vorsicht geboten; man soll sich nie unnötig lang den Strahlen
aussetzen und vor allem die Augen mit großen Schutzbrillen aus Bleiglas
schonen. Beim Experimentieren blende man mit dünnem Bleiblech oder
dicken Stanniolblättern die Röhre so ab, daß die Röntgenstrahlen nur an
ihren Bestimmungsort gelangen.
Kritik.
Auch nach diesem Vortrage fehlte die Kritik von Rudis Onkel nicht.
„Ich hätte“, meinte der Onkel, „noch etwa folgendes angeführt: Wie
bekannt, ist es in letzter Zeit gelungen, aus gewissen Mineralien
Stoffe zu isolieren, die die merkwürdige Eigenschaft haben, Strahlen
auszusenden, die in ihren Wirkungen denjenigen Strahlen gleich sind,
die in der Vakuumröhre beim Durchgang der Elektrizität entstehen. Man
hat drei verschiedene Arten der Strahlen unterschieden, die immer alle
drei von den aktiven Stoffen — der bekannteste ist das Radium —
ausgesandt werden. Die Unterschiede sind bedingt durch die Quantität,
das Durchdringungsvermögen und durch die Beeinflussung des Magneten.
Man bezeichnet die verschiedenen Arten mit α-, β- und γ-Strahlen.
Die α-Strahlen sind die quantitativ vorherrschenden; sie haben ein
geringes Durchdringungsvermögen und werden vom Magneten nur wenig
beeinflußt. Die β-Strahlen werden stark vom Magneten abgelenkt und
dringen tiefer in die Materie ein als die α-Strahlen. Die γ-Strahlen
endlich haben die geringste magnetische Ablenkbarkeit und das größte
Durchdringungsvermögen. Ganz analoge Unterschiede bestehen zwischen den
unter verschiedenen Umständen entstandenen Strahlen der evakuierten
Entladungsröhren. Man kann u. a. auch mit radiumhaltigen Stoffen
Durchleuchtungsphotographien machen. Erwähnt sei endlich noch, daß in
der Umgebung radiumhaltiger Stoffe die Luft leitend wird, so daß z. B.
die statischen Ladungen isoliert aufgestellter Körper durch die Luft
zur Erde abgeleitet werden.“
„Werte Zuhörer!
In meinem letzten Vortrage haben Sie von den rätselhaften Vorgängen
gehört, die sich beim Durchgang der Elektrizität durch verdünnte Gase
abspielen. Heute will ich Ihnen einige Erscheinungen vorführen, die
auf den Laien gewöhnlich einen noch wunderbareren Eindruck machen, für
die der Physiker aber verhältnismäßig leicht ungezwungene Erklärungen
gefunden hat. Es handelt sich heute um elektrische Schwingungen.
Lassen Sie mich jedoch zuerst einige Worte über das verlieren, was man
in der Physik unter Erklärung versteht!
Hebe ich einen Stein in die Höhe und lasse ihn dann los, so fällt er zu
Boden. Den meisten Menschen ist dies etwas völlig Selbstverständliches,
und sie fragen gar nicht danach, warum der Stein fällt. Selbst
Galilei, der die Fallgesetze entdeckt hat, der sich jahrelang mit
fallenden Steinen experimentell beschäftigt hat, dachte nicht daran zu
fragen, warum die Steine fallen.
Erst der große Newton kam, als er — so erzählt man — einen Apfel vom
Baume fallen sah, auf die bedeutungsvolle Frage: Warum?, eine
Frage, die in der Philosophie schon vor Jahrtausenden von den Gelehrten
der alten Kulturvölker aufgeworfen, die aber für naturwissenschaftliche
Ereignisse im engeren Sinne vor noch nicht 250 Jahren zum ersten Male
gestellt wurde.
Wenn Newton auch keine Antwort auf dieses ‚Warum?‘ fand, so
ward ihm doch klar, daß diese geheimnisvolle Tatsache des fallenden
Steines selbst die Antwort sei auf die Frage nach der Ursache
von tausend anderen Naturereignissen. Ja, nach dem jetzigen Stande der
Wissenschaften will es sogar den Anschein haben, daß wir überhaupt[S. 231]
alle Naturerscheinungen mit diesem Gesetz der Schwere, dem
Gravitationsgesetz, dem in erster Linie der fallende Stein
unterliegt, erklären können. Ich sage alle Naturerscheinungen,
nicht nur etwa die mechanischen, nein, auch die akustischen, die
optischen, die elektrischen, die chemischen, die Erscheinungen des
organischen und sogar des geistigen Lebens[7].
Man sagt kurz, alle Naturereignisse können mit dem Gesetz der Schwere
erklärt werden. Wenn ich also z. B. frage: Warum dreht
sich die Erde um die Sonne, und ich behaupte, weil ihre Masse dem
Gravitationsgesetz unterliegt, kurz, weil sie schwer ist — genauere
Ausführungen hierüber würden zu weit führen —, so habe ich nur
scheinbar eine Erklärung der Bewegung abgegeben, weil das
Mittel, mit dem ich erklärt habe, selbst noch ein Rätsel ist. Und
so, wie es bei diesem Beispiel ist, ist es mit allen Dingen unseres
Erkennens; wir mögen forschen und suchen, so lange wir wollen,
wir mögen noch so viel entdecken, zuletzt bleibt immer ein großes
Fragezeichen stehen.
Aber wenn man nichts erklären kann, was bedeutet denn dann das Wort
erklären? Es bedeutet so viel wie vergleichen. Ich
vergleiche die Gesetze, nach denen der Stein fällt, mit denen, nach
welchen die Himmelskörper sich bewegen, und finde, daß sie ähnlich oder
gleich sind, oder daß sie in bestimmten Beziehungen zueinander stehen.
Wenn ich jetzt die Erscheinungen der elektrischen Schwingungen
zu erklären versuche, so vergleiche ich die Vorgänge mit
Erscheinungen, die uns aus dem alltäglichen Leben geläufig sind. So
habe ich früher schon z. B. den elektrischen Strom im Drahte mit dem
Wasserstrom in einer Leitung verglichen[7].
Doch nun zur Sache!
Sie wissen, daß man einen elektrischen Strom transformieren kann, das
heißt, daß man einen starken Strom mit geringer Spannung in einen
schwachen Strom mit hoher Spannung umwandeln kann. Die Konstruktion und
Wirkungsweise der Transformatoren, der Induktionsapparate[S. 232] haben Sie in
meinem vorletzten Vortrage kennen gelernt.
Es wird Ihnen noch erinnerlich sein, daß wir von den Funkeninduktoren
eine umso größere Wirkung erhoffen durften, je plötzlicher wir
den induzierenden Strom unterbrachen. Ich habe seinerzeit als
den wirksamsten Unterbrecher den von Wehnelt, der bis zu 2000
Unterbrechungen in der Sekunde macht, erwähnt. Tatsächlich haben
wir aber in einem Ihnen wohl vom ersten Vortrag her noch bekannten
Apparat, in der Leidener Flasche ein Mittel, das uns erlaubt, durch
den Induktionsapparat einen Strom zu senden, der in der Sekunde seine
Richtung einige Millionenmal wechselt.
Um diese Erscheinung zu erklären, muß ich auf die Natur der
elektrischen Funkenentladungen im allgemeinen näher eingehen.“
So weit vorläufig sei Rudis Vortrag wörtlich angeführt. Im folgenden
wollen wir den Inhalt seiner Erklärungen und Experimente rein sachlich
wiedergeben.
Elektrische Oszillation.
Wenn wir eine Leidener Flasche durch einen Funken entladen, so gleichen
sich nicht etwa die entgegengesetzten Elektrizitäten der beiden Beläge
einfach aus, sondern die Entladung geht recht umständlich vor sich.
Während der Strom im ersten Augenblicke vom inneren zum äußeren Belege
fließt, geht er im zweiten Augenblick in umgekehrter Richtung, im
dritten wieder in der ursprünglichen und so fort, etwa 10- bis 20mal
während der Dauer eines ungefähr ¹∕₈₀₀₀₀ Sekunde andauernden Funkens,
eine Entdeckung, die man dem Physiker Feddersen zu Leipzig verdankt.
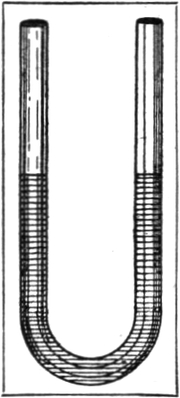
Abb. 192. U-Röhre zur
Versinnlichung elektrischer Oszillation.
Dieses Hin- und Hergehen der Ladungen kann man durch ein einfaches
Experiment leicht versinnlichen. Man füllt die beiden Schenkel einer
1 bis 2 cm weiten, U-förmig gebogenen Glasröhre bis
zur Hälfte mit irgend einer farbigen Flüssigkeit (Abb. 192). Darauf
stellt man die Röhre schief, so daß sich der eine Schenkel ganz füllt,[S. 233]
während der andere leer wird, verschließt den gefüllten Schenkel mit
dem Daumen und richtet dann die U-Röhre wieder auf. Nun soll der
von der Flüssigkeit ausgefüllte Schenkel — es sei der rechte — die
positive Ladung des einen Belages einer Leidener Flasche darstellen,
der leere die negative Ladung des anderen Belages. Läßt man dann den
Daumen los, so fließt die Flüssigkeit nicht etwa langsam zurück, bis
sie auf beiden Seiten gleich hoch steht, wie bei dem Beispiel auf Seite
49, sondern sie schießt in dem linken Schenkel beinahe ebenso
hoch in die Höhe, als sie zuerst im rechten war. Dann geht sie wieder
zurück und so fort, bis sie erst nach einiger Zeit zur Ruhe kommt. In
ähnlicher Weise, nur in viel kürzerer Zeit, schwanken die Ladungen der
beiden Beläge einer Leidener Flasche hin und her.
Der Drehspiegel.
Rudi führte auch vor, wie man diese Tatsache nachgewiesen hat.
Er hatte sich einen sogenannten Drehspiegel hergestellt; das ist
eine Kombination von drei oder vier Spiegeln, die zu einem Prisma
zusammengestellt und so montiert sind, daß sie sehr rasch um ihre
Längsachse gedreht werden können.
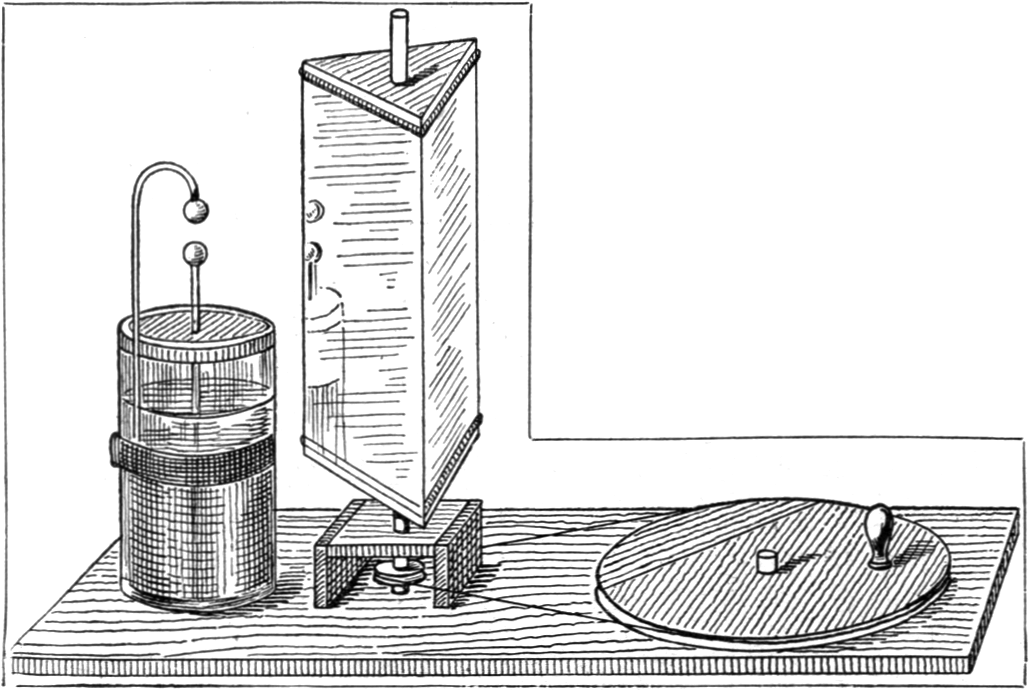
Abb. 193. Der Drehspiegel.
Rudi stellte sich diesen Drehspiegel folgendermaßen her: Er ließ sich
von einem Glaser drei belegte Spiegelscheiben schneiden, jede 15
cm lang und 9 cm breit. Diese Scheiben klebte er mit
Kolophonium-Wachskitt (Seite 79) auf ein aus Brettchen gefertigtes
dreiseitiges Prisma so auf, daß die[S. 234] langen Seiten der Spiegel
die Längskanten des Prismas bildeten. Das Aufkitten mußte sorgfältig
geschehen und es durfte mit dem Kolophonium dabei nicht zu sparsam
umgegangen werden, da die Scheiben, um nicht von der Zentrifugalkraft
abgeschleudert zu werden, sehr fest sitzen müssen. Oben und unten
wickelte Rudi über sie je einige Lagen Schnur und überstrich diese mit
Tischlerleim. Die übrige Anordnung und die Vorrichtung zum Drehen geht
wohl hinreichend deutlich aus der Abb. 193 hervor. Es sei nur noch
erwähnt, daß die Achse des Spiegelprismas nicht zu schwach (mindestens
8 mm stark) gemacht werden durfte und ganz genau zentral
sein mußte. Zum Antriebe verwendete Rudi das Übersetzungsrad der in
Abb. 134 (Seite 160) dargestellten Maschine. Die stets gut zu ölenden
Lager wurden in der üblichen Weise (Seite 22) hergestellt.
Den Versuch führte Rudi folgendermaßen aus: Er stellte so, wie das aus
der Abbildung zu erkennen ist, eine Leidener Flasche (Seite 46 u. f.)
dem Spiegel gegenüber auf. Um den äußeren Belag der Flasche legte
er einen Blechstreifen, an dem ein 2 mm starker Kupferdraht
angelötet war; letzterer endete in eine kleine Messingkugel, die
der durch eine Messingstange mit dem inneren Belag verbundenen
gegenüber stand. Die Flasche wurde im mäßig verdunkelten Raum mit
einem Funkeninduktor geladen, so daß ein kontinuierlicher Funkenstrom
zwischen den Kugeln übersprang. Während nun Käthe den Funkeninduktor
bediente, drehte Rudi den Spiegel und wies seine Hörer darauf hin,
das Spiegelbild des Funkens zu betrachten. Dieses sah nicht, wie die
meisten erwarteten, ebenso aus, wie der Funke selbst, sondern bei
der Entladung sah man in dem Spiegel einen Lichtstreifen, der aber
nicht zusammenhängend, sondern unterbrochen war; der Funke erschien
im Spiegel als eine Reihe heller Punkte. Bevor Rudi diese Erscheinung
näher erklärte, stellte er an Stelle der Leidener Flasche eine
brennende Kerze auf, deren Spiegelbild beim Rotieren des Apparates zu
einem kontinuierlichen Lichtband ausgezogen wurde.
„Was beweist dieser Versuch?“ begann unser junger Dozent die
Erläuterung. „Sie wissen, daß ein Lichtstrahl[S. 235] von einem Spiegel unter
demselben Winkel zurückgeworfen wird, in dem er auffällt; in der
gleichen Weise, wie ein Ball, der schief gegen die Wand geworfen wird,
eben so schief, aber nach der anderen Seite, zurückprallt. Wenn die
Lichtstrahlen der Kerzenflamme den ruhenden Spiegel treffen, so
wird man ein unverändertes Bild sehen; dreht sich aber der Spiegel,
so fallen die Lichtstrahlen in jedem Augenblick in einem anderen
Winkel auf die reflektierende Fläche, werden deshalb auch in anderer
Richtung zurückgeworfen. Die Folge davon ist, daß wir einen breiten
zusammenhängenden Lichtstreifen sehen. Ist nun aber das Lichtband nicht
zusammenhängend, sondern unterbrochen, so ist das ein Beweis dafür,
daß die Lichtquelle nicht fortdauernd Licht aussendet. Dies Schwanken
des Lichtes des elektrischen Funkens können wir mit unseren Augen
deshalb nicht unmittelbar erkennen, weil jeder Lichteindruck länger
empfunden wird, als er in Wirklichkeit andauert. Deshalb sehen wir
auch die hellen Punkte des Lichtbandes gleichzeitig auftreten, während
der folgende tatsächlich erst dann erscheint, wenn der vorausgegangene
verschwunden ist[8].
Diese Art einer elektrischen Entladung nennt man eine
oszillierende Entladung und den dabei die Leiter durchfließenden
Strom einen Wechselstrom hoher Frequenz.
Der Physiker Hertz hat nachgewiesen, daß von einem geladenen
Leitersystem, das sich durch einen oszillierenden Funken ausgleicht,
Wellen ausgingen, die selbst zwar unsichtbar waren, aber sich
nach denselben Gesetzen fortpflanzen wie die Lichtstrahlen, deren
Wellennatur zuerst von Newton geahnt, später von Maxwell erkannt
und in bestimmte Gesetze formuliert wurde.
Die Versuche, die beweisen, daß sich von einem oszillierenden Funken
aus elektrische Wellen in den Raum ausbreiten, will ich nun hier
vorführen. Ich muß jedoch vorher noch auf ein von Hertz angestelltes
Experiment hinweisen, das ich leider nicht vorführen kann, da es mir
trotz vieler Versuche infolge unzureichender Hilfsmittel nie gelang.
Hertz konstruierte einen Apparat, den Sie im Schema auf der Tafel hier
aufgezeichnet sehen. (Käthe hängte eine Tafel[S. 236] auf, deren Zeichnung
Abb. 194 wiedergibt, und zeigte die von Rudi genannten Teile.) Mit
J ist der Funkeninduktor bezeichnet, dessen sekundäre Pole durch
eine Funkenstrecke F miteinander verbunden sind. Von dieser
Funkenstrecke sind nach beiden Seiten hin die Drähte L gespannt,
die in Kugeln enden. Wurde der Funkeninduktor in Tätigkeit gesetzt,
so ging bei F. ein Funkenstrom über und von den mit F.
verbundenen Drähten gingen elektrische Wellen aus, die im stande
waren, in dem fast zu einem Kreis geschlossenen Leiter A Ströme
hervorzurufen. Diese äußerten sich durch Entstehen von kleinen Fünkchen
bei F′.
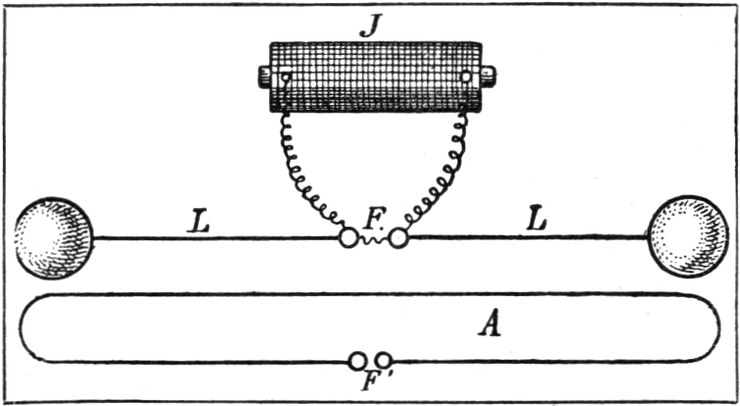
Abb. 194. Schema des Hertzschen Wellenversuches.
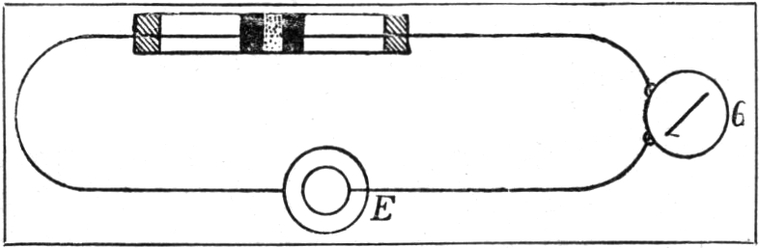
Abb. 195. Der Fritter (Schema).
Der Fritter.
Aber gerade in der Kleinheit dieser Fünkchen liegt die Schwierigkeit
der Versuche. Ich bediene mich deshalb im folgenden eines Apparates,
der von Branly erfunden wurde, des sogenannten Fritters oder
Kohärers. Sie sehen auf der zweiten Tafel das Schema eines
Kohärers aufgezeichnet. (Hier hielt Käthe eine Tafel vor, auf der
die in Abb. 195 wiedergegebene Zeichnung zu sehen war.) In einer
Glasröhre befinden sich zwei Metallkolben, zwischen denen sich
feine Metallfeilspäne befinden. Da der Kontakt der losen Feilspäne
sehr schlecht ist, so bietet eine derartige Röhre dem Strom eines
galvanischen Elementes einen fast unüberwindlichen Widerstand. Wenn[S. 237]
wir also diese Röhre, den Fritter, mit einem Galvanoskop G
in den Stromkreis eines Elements E schalten, so zeigt das
Galvanoskop auf Stromlosigkeit. Wird aber der Fritter von elektrischen
Wellen getroffen, so sinkt der Widerstand der Feilspäne sofort bis auf
ein ganz geringes Maß, und die Nadel des Galvanoskopes schlägt kräftig
aus. Diesen Versuch kann ich Ihnen hier vorführen.“
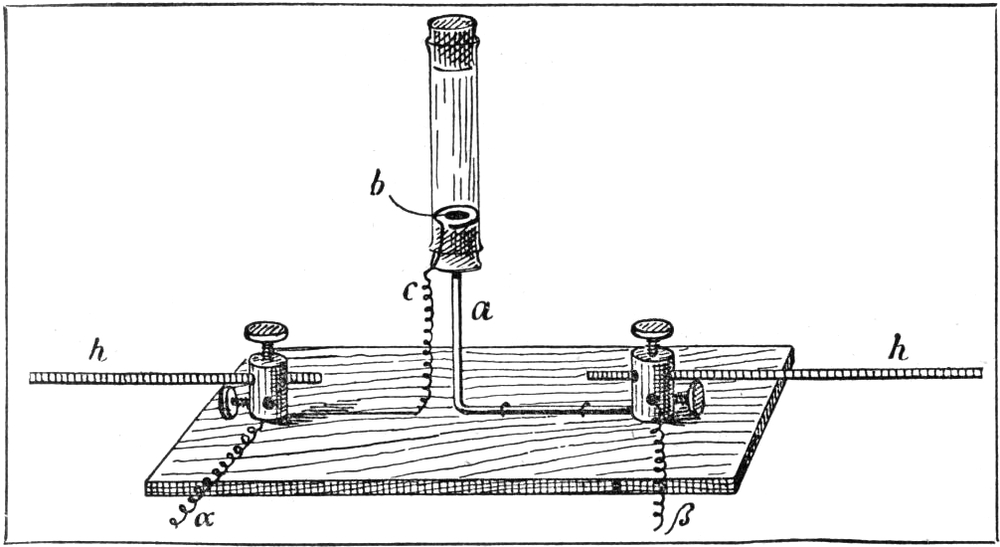
Abb. 196. Der Fritter.
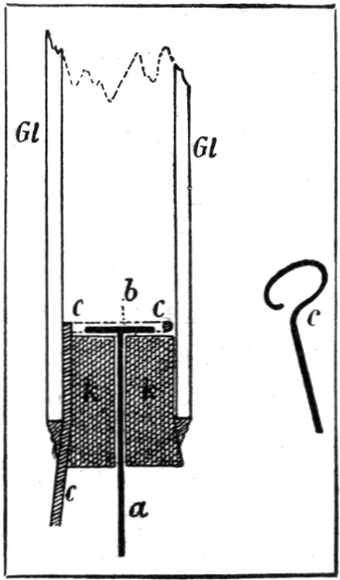
Abb. 197. Zum Fritter.
Rudi führte den Versuch hierauf mit einem selbstgefertigten Fritter
aus, dessen Konstruktion hier beschrieben sei.
An das Ende eines etwa 7 cm langen und 2 mm starken
Kupferdrahtes (a in Abb. 196 und 197) wird ein etwa 3 mm
großes dünnes Silberplättchen b gelötet, das man aus einem
Silberdraht durch Hämmern herstellt. Aus dem Rest des Silberdrahtes,
den man sich von einem Juwelier beschafft — es braucht kein reines
Silber, sondern kann eine geringere Legierung sein —, biegt man den
Ring c, der etwa 4 bis 5 mm weit sein soll. Man kann
übrigens hierzu statt Silber auch Nickel, im Notfall auch
Zinn verwenden. Andere Metalle, wie Kupfer oder Eisen,[S. 238] sind
nur bei den gröbsten Versuchen verwendbar. Jetzt wird ein etwa 5 bis
6 mm dicker Kork (k) in der Mitte durchbohrt, und der
Draht a wird so hindurchgesteckt, wie dies aus den Abbildungen
hervorgeht. Seitlich erhält der Kork eine Rinne zur Aufnahme des
Drahtes c. Diese Teile werden so in eine passend weite Glasröhre
(Gl) eingesteckt, daß b konzentrisch in c
liegt; beide Teile sollen in derselben Höhe auf dem oberen Korkrand
aufliegen. Kork und Glas werden noch mit heißem Siegellack abgedichtet.
Wie dieser Apparat auf einem Grundbrett angebracht wird, geht aus
der Figur hinreichend deutlich hervor. Die Klemmschrauben seien
mit zwei übereinanderliegenden, zueinander rechtwinkelig stehenden
Bohrungen versehen. Die Feilspäne stellen wir uns durch Befeilen
eines Fünfpfennigstückes — Nickel — so her, daß gröbere und feinere
Feilspäne entstehen. Je mehr Späne in das Röhrchen eingefüllt werden,
um so empfindlicher ist der Apparat. Für die meisten Versuche genügt
eine etwa 2 mm hohe Lage von Feilspänen.
Zur Vorführung des ersten Experimentes schaltete Rudi den Fritter
mit dem Vertikalgalvanoskop (Seite 91 u. f.) in den Stromkreis eines
Elementes und ließ dann etwa 50 cm von dem Fritter entfernt
aus einem Elektrophordeckel (Seite 5) ein Fünkchen in seinen Finger
überspringen. In demselben Augenblick zeigte das Galvanoskop einen
starken Strom an.
Die Erklärung für diese Erscheinung lautet folgendermaßen: Wird der
Fritter von elektrischen Wellen getroffen, wie sie immer von einem
elektrischen Funken ausgehen, so treten zwischen den einzelnen einander
nur lose berührenden Feilspänen kleine Fünkchen auf — aus demselben
Grunde, weshalb bei dem Hertzschen Versuch bei F′ in Abb. 194
Fünkchen auftreten —, die die kleinen Metallkörnchen gewissermaßen
zusammenschweißen, welcher Umstand dann das Herabsinken des Widerstands
zur Folge hat. Diese Erklärung ist einfach und bei oberflächlicher
Betrachtung sehr einleuchtend, wird aber aus verschiedenen Gründen, auf
die ich hier nicht näher eingehen kann, stark angegriffen.
Wird der leitende Fritter, nachdem er von elektrischen Wellen getroffen
wurde, erschüttert, so werden dadurch die verschweißten Feilspäne
wieder voneinander getrennt. Das[S. 239] Galvanoskop wird deshalb zurückgehen
und wieder Stromlosigkeit anzeigen, sobald man den Fritter z. B. mit
einem Holzstäbchen anschlägt.
„Mit diesem Fritter“, erklärte Rudi weiter, „haben wir nun ein
empfindliches Reagens auf elektrische Wellen. Mit der Erfindung
dieses Apparates war auch der erste Schritt getan zur praktischen
Verwendung dieser geheimnisvollen Kraft, zur sogenannten drahtlosen
Telegraphie oder Funkentelegraphie. Letztere Bezeichnung
ist die bessere, da man kaum zu anderen Apparaten so viel Draht
braucht, als gerade zu denen der drahtlosen Telegraphie.
Bevor ich jedoch die Funkentelegraphie bespreche, möchte ich einige
Versuche vorführen, die geeignet sind, Sie über das Wesen der
elektrischen Wellen aufzuklären.
Wir können die elektrischen Wellen in vielen ihrer Erscheinungsformen
ungezwungen mit entsprechenden Erscheinungen der Luftwellen
vergleichen. Man nimmt deshalb auch an, daß es ein Medium gebe, das
sich zur Elektrizität ebenso verhält, wie die Luft zum Schall. Der
Schall ist eine Wellenbewegung der Luft; wo keine Luft ist, kann auch
kein Schall sein. Den Schall erzeuge ich dadurch, daß ich die Luft
in rhythmische Schwingungen versetze, etwa durch Anschlagen einer
Stimmgabel, einer Saite u. s. w. Das Medium nun, in dem sich die
Elektrizität und das Licht fortpflanzt, ist für keinen unserer Sinne
wahrnehmbar; man hat ihm den Namen Äther gegeben. Der Äther muß eine
ungemein leichte, alle Stoffe durchdringende und den ganzen Weltenraum
erfüllende Substanz sein. Wie ähnlich die elektrischen Schwingungen
einerseits analogen Erscheinungen beim Licht, anderseits beim Schall
sind, will ich Ihnen durch einige Experimente beweisen.“
Bevor wir nun Rudis weitere Erklärungen wiedergeben, wollen wir zuerst
wieder die Herstellung der Apparate beschreiben, die Rudi zu seinen
Demonstrationen gebrauchte.
Die Resonanz.
Das erste hierhergehörige Experiment Rudis zeigte die elektrische
Resonanz. Zum Vergleich mit den analogen Erscheinungen[S. 240] des
Schalles führte er zuerst die akustische Resonanz vor. Er hatte zwei
Stimmgabeln, die auf kleinen Resonanzkästchen befestigt waren und von
denen die eine durch einen verstellbaren Gleitschuh auf verschiedene
Töne abgestimmt werden konnte. Er stellte die beiden Stimmgabeln,
die in der Tonhöhe um eine Terz differierten, so auf, daß sich die
offenen Seiten der beiden Resonanzkästchen in einem Abstand von etwa
20 cm gegenüberstanden. Rudi schlug zuerst beide Gabeln kurz
nacheinander mit einem Holzhämmerchen an, so daß man die Tondifferenz
hören konnte; dann schlug er eine allein an[9], ließ sie ein paar
Sekunden tönen und brachte sie dann durch Umfassen mit der Hand zum
Schweigen. Letzteres wiederholte er noch zweimal und forderte seine
Zuhörer auf, genau aufzumerken. Dann stimmte er die eine Gabel durch
Verstellen des Gleitschuhes genau auf die andere ab und schlug beide
nacheinander kurz an, so daß man die Tongleichheit erkennen konnte.
Darauf versetzte er wieder eine allein in Schwingung und umfaßte sie
nach ein paar Sekunden, wie zuerst mit der Hand; trotzdem hörte man
den Ton noch ganz deutlich weiter klingen. Bevor jedoch der Ton von
selbst verklungen war, berührte er auch die zweite Gabel, und sofort
war nichts mehr zu hören. Auch diesen Versuch wiederholte Rudi noch ein
paarmal.
Diese Experimente führte Rudi aus ohne ein Wort dazu zu sprechen,
von kurzen Aufforderungen zum Aufmerken abgesehen. Ebenso schweigend
verhielt er sich bei dem folgenden Versuch, der die entsprechende
elektrische Erscheinung vorführte.
Für diesen Versuch sind zwei möglichst gleiche Leidener Flaschen
nötig. Rudi hatte dazu zwei zylindrische Gläser verwendet (siehe
Seite 46 u. f.), die 30 cm hoch waren und nahe 15 cm
im Durchmesser hatten. (Je kleiner die Flaschen sind, umso schwerer
gelingt der Versuch!) Jede der Flaschen erhielt einen um ihren äußeren
Belag gelegten[S. 241] Blechstreifen (B in Abb. 198 und 199), an dem
bei der einen Flasche (Abb. 198) ein gerader, etwa 2 mm starker
und 30 cm langer Draht (D₂) angelötet war; bei der
anderen Flasche war ein ebensolcher Draht (D) in der aus Abb.
199 ersichtlichen Form gebogen, an seinem Ende mit einer Kugel versehen
und durch den Träger T gestützt, der aus Glas, Hartgummi oder
Vulkanfiber hergestellt war, auf dem Flaschenrand aufsaß und mit
Schellackkitt (s. S. 5 u. 79) angekittet war. Dem Knopf der ersten
Leidener Flasche gegenüber war, wie Abb. 198 zeigt, ebenfalls ein
Metallknopf befestigt, an dem der Draht D₁ angelötet war,
D₁ stand zu D₂ parallel. D₁ wurde von
dem Rähmchen R gehalten, das aus Hartgummi oder Vulkanfiber
hergestellt war. Aus 2 bis 3 mm dicken Fiber- oder Ebonitplatten
sägte er sich dazu zwei gleiche Rähmchen, versah sie an den in Abb.
198 mit x bezeichneten Stellen mit Kerben, in denen die Stange
S und der Draht D₁ knapp Platz fanden. S und
D₁ wurden dann in der aus der Abbildung ersichtlichen Weise
zwischen den beiden Rähmchen, indem diese mit Schrauben zusammengezogen
wurden, eingeklemmt. Ferner wurden D₁ und D₂ durch
einen verschiebbaren Draht V miteinander verbunden.
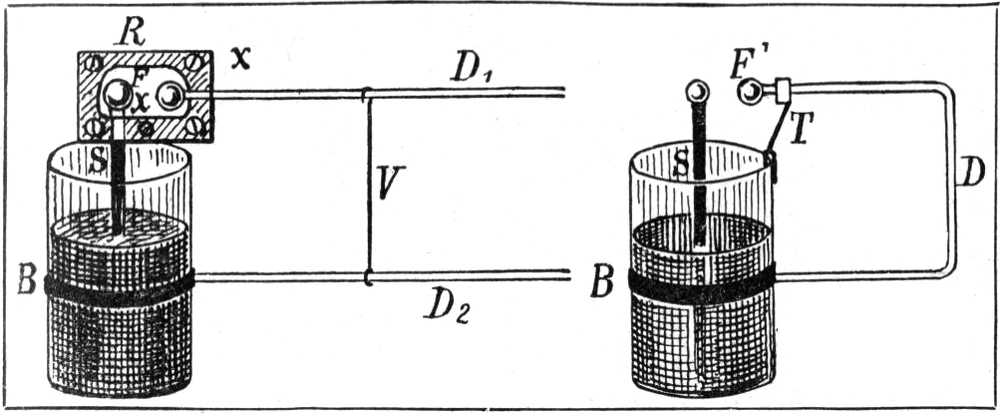
Abb. 198. Abb. 199.
Leidener Flaschen für Resonanzversuche.
Man kann auch D₁ direkt an den Knopf der Stange S
anlöten. Dann muß man aber noch eine besondere Funkenstrecke dadurch
herstellen, daß man einen Streifen Stanniol so über den Rand der
Flasche legt, daß er den inneren Belag berührt, von dem äußeren aber
einige Millimeter[S. 242] entfernt bleibt. Die Resonanzentladung geht dann
zwischen dem Streifen und dem äußeren Flaschenbelag über.
Diese beiden Flaschen stellte Rudi in einem Abstande von etwa 50
cm so auf, daß die Ebenen der beiden Schließungskreise
einander parallel waren. Der Bügel V war fast bis an das
Ende der Drähte D₁ und D₂ geschoben. Die Flasche,
die Abb. 199 darstellt — sie heiße fernerhin A, die andere
B —, ließ er durch Käthe mit seiner Influenzmaschine laden,
so daß in kurzen Intervallen bei F′ Funken überschlugen.
Dann verschob er mit einem Glasstab den Bügel V der Flasche
B langsam nach innen; kaum hatte V einen bestimmten
Punkt erreicht, als auch bei F an der Flasche B Funken
übersprungen, obgleich diese mit keiner Elektrizitätsquelle verbunden
war. Wurde das Laden der Flasche A unterbrochen, so hörten auch
die Funken bei B auf. Traten bei A die Funken wieder auf,
so traten sie auch bei B auf, aber nur, wenn der Bügel V
sich an einer ganz bestimmten Stelle befand; wurde er verschoben, so
blieben die Funken aus.
Nachdem Rudi diese Erscheinung einige Male möglichst demonstrativ
vorgeführt hatte, begann er die Erklärung:
„Bei dem Versuch mit den Stimmgabeln haben Sie gesehen oder vielmehr
gehört, daß, wenn beide Gabeln auf den gleichen Ton abgestimmt waren,
auch beide erklangen, selbst wenn nur die eine angeschlagen wurde. Die
Gleichheit der Tonhöhe, das heißt der Schwingungszahl in der Sekunde
bei beiden Gabeln war dabei notwendig, denn wenn sie auf verschiedene
Töne abgestimmt waren, gelang der Versuch nicht.
Ganz ähnlich verhielten sich die Dinge bei den Leidener Flaschen. Was
bei der Stimmgabel der Ton ist, ist hier der Funke; dem verstellbaren
Gleitschuh dort entspricht hier der Drahtbügel, den ich hin und her
schieben kann.
Wenn ich die eine der gleichgestimmten Gabeln anschlage, so geraten
ihre elastischen Zinken in Schwingungen; diese Schwingungen erschüttern
die Luft, und es entstehen Luftwellen, die sich mit einer gewissen
Geschwindigkeit von der Stimmgabel wegbewegen. Wenn man sich von
diesem[S. 243] Vorgang ein Bild machen will, so denke man an die Wellenkreise,
die ein in ein ruhiges Wasser geworfener Stein verbreitet. Diese
Luftwellen schlagen nun in einem ganz bestimmten Takt, der eben dem
betreffenden Ton eigen ist, an die andere Stimmgabel; da diese aber
fähig ist, in dem gleichen Takt zu schwingen — sie ist ja auf die
gleiche Tonhöhe abgestimmt —, so muß sie den rhythmisch anschlagenden
Luftwellen nachgeben, das heißt sie gerät selbst in Schwingungen.
Ganz ähnlich verhält es sich bei den Leidener Flaschen. Entladet
sich eine solche Flasche durch einen Funken, so geraten dabei die
leitenden Teile in einen Zustand, den man nicht näher definieren kann,
der aber dem Äther in ganz ähnlicher Weise wie die Stimmgabel der
Luft rhythmische Stöße erteilt, so daß er von einer Wellenbewegung
durchzittert wird. Treffen diese Wellen, die in einem ganz bestimmten
Takt aufeinander folgen, an das Leitungssystem der anderen Flasche,
so gerät dieses ebenfalls in jenen Zustand — was sich durch das
Auftreten von Funken äußert —, wenn es auf die gleiche Schwingungszahl
abgestimmt ist (siehe auch die Kritik am Ende des Vortrages). Die
Schwingungszahl eines derartigen Systemes hängt ab von Form und Größe
der Flaschen und des Drahtkreises, durch den die Entladung vor sich
geht.
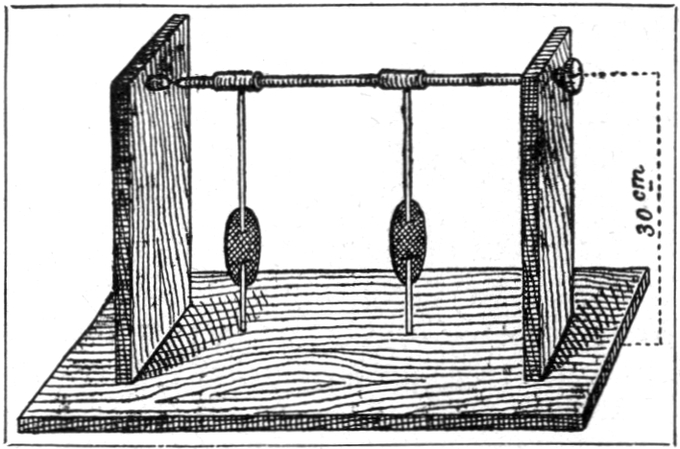
Abb. 200. Resonanzpendel.
Diesen Vorgang bezeichnet man in der Akustik wie in der
Elektrizitätslehre als Resonanz; ebenso finden wir in der Optik
ähnliche Erscheinungen, und auch in der Mechanik gibt es eine Resonanz,
wie ich Ihnen mit diesem Apparat zeigen will.“
[S. 244]
Hier stellte Käthe in den Vordergrund des Experimentiertisches einen
Apparat, dessen Konstruktion aus Abb. 200 und der nun folgenden
Beschreibung Rudis für den Leser hinreichend klar hervorgehen wird.
„Hier wird eine Messingstange von den beiden Holzträgern so
gehalten, daß sie sich leicht um ihre Längsachse drehen kann.
Über diese Messingstange sind zwei Rohrstückchen geschoben, die
ebenfalls beweglich sind. An jedem der Röhrchen ist ein dicker Draht
angelötet, an dem sich eine runde Scheibe aus Bleiblech herauf- und
herunterschieben läßt. Ich habe hier also zwei Pendel, deren Länge ich
beliebig verändern kann.
Nun ist es ein bekanntes Gesetz aus der Mechanik, daß ein Pendel
umso rascher schwingt, je kürzer es ist und umgekehrt, wie bei der
Stimmgabel. Ich will jetzt das eine Pendel ziemlich lang, das andere
möglichst kurz machen — Käthe schob die eine der Bleiplatten ganz nach
oben, die andere ganz herunter, hielt die Messingstange in der Mitte
fest und versetzte beide Pendel in Schwingung —. Sie sehen, das
lange Pendel braucht viel mehr Zeit, um einmal hin und her zu gehen,
als das kurze. Jetzt sind beide Pendel in Ruhe; ich stoße das kürzere
an; es schwingt allein, obgleich die gemeinsame Achse infolge der
Reibung dieses Röhrchens sich ebenfalls bewegt und man meinen sollte,
daß diese Bewegung auch dem langen Pendel mitgeteilt würde. Jetzt will
ich einmal das kurze zur Ruhe bringen und das lange in Schwingungen
versetzen: auch das ist nicht im stande, seinem Nachbar seine Bewegung
mitzuteilen.
Nun will ich sie aber einmal beide gleich lang machen und das
eine anstoßen: Sie sehen, schon nach drei, vier Schwingungen beginnt
der Nachbar mitzuschwingen — und jetzt pendeln sogar beide gleich
stark.
Näher kann ich hier auf diese mechanischen Erscheinungen nicht
eingehen. Das letzte Beispiel möge nur zur Versinnlichung der
elektrischen Resonanz dienen.“
Interferenz.
Die zweite hierher gehörige elektrische Erscheinung, die ebenfalls ihr
Gegenstück bei der Akustik hat, ist die Interferenz.
Die Experimente, die die akustische Interferenz nachweisen,[S. 245] sind
nicht gut für viele Zuhörer vorzuführen. Rudi beschränkte sich deshalb
darauf, die Tatsachen an zwei schematischen Zeichnungen zu erklären.
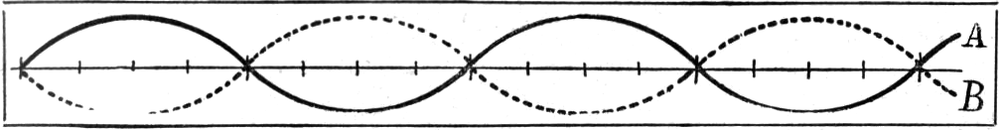
Abb. 201. Interferenz zweier Wellenzüge.
Denken wir uns einen Schallwellenzug schematisch durch eine wirkliche
Wellenlinie aufgezeichnet (A in Abb. 201); gleichzeitig sei ein
zweiter Wellenzug dargestellt (B), der um eine halbe Wellenlänge
gegen den ersten verschoben ist. Wir sehen, daß die Resultierende
aus beiden Linien gleich Null ist, das heißt die beiden Töne müssen
einander auch in der Wirklichkeit, wenn sie so zusammenfallen,
aufheben, sie müssen verstummen.
Diese Tatsache wird mit dem Interferenzrohr nachgewiesen, dessen
Einrichtung aus Abb. 202 hervorgeht. Wir sehen hier ein Rohrsystem,
das bei c seinen Eingang hat, sich bei α in den oberen festen
Gang A und den unteren veränderbaren B teilt, sich bei β
wieder vereinigt und bei d ausläuft.
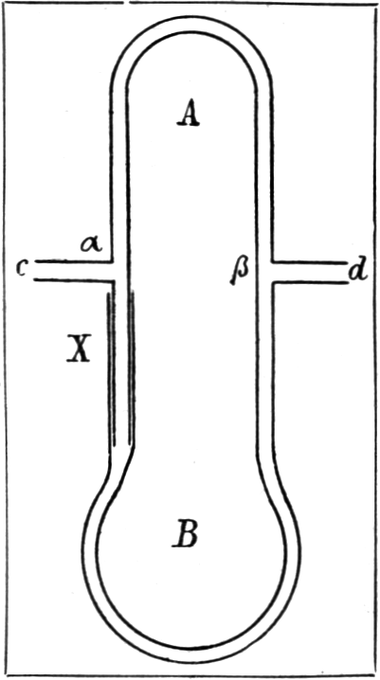
Abb. 202. Interferenzrohr.
Erzeuge ich bei c einen Ton, so entstehen Luftwellen, die
sich durch A und B fortpflanzen und bei d
ausströmen; man wird also bei d den Ton hören — oder nicht
hören, je nachdem sich die Länge des Weges A zu der des Weges
B verhält. Höre ich bei d, während der Ton bei c
andauert, und verändere gleichzeitig die Länge des Weges B durch
Zusammenschieben oder Auseinanderziehen der Röhren bei x, so
werde ich wahrnehmen, daß der Ton bald verstummt, bald wieder ertönt.
Das rührt daher, daß bei einem gewissen Verhältnis der Weglänge
A zu der Weglänge[S. 246] B die sich bei β vereinigenden
Schallwellen so treffen, wie es in Abb. 201 gezeichnet ist: Ein
Wellenberg und ein Wellental treffen gerade zusammen und heben einander
auf, die Tonstärke ist gleich Null. Dies kann bei verschiedenen Längen
von B der Fall sein; dann ist die Strecke, um die ich B
verlängern oder verkürzen muß, um den Ton gerade zweimal zum Verstummen
zu bringen, ein unmittelbares Maß für die Gänge der betreffenden
Schallwelle.
Eine ganz ähnliche Erscheinung können wir bei den elektrischen Wellen
nachweisen. Die Apparate, die zu diesen Versuchen nötig sind, können
wir uns leicht selbst herstellen.
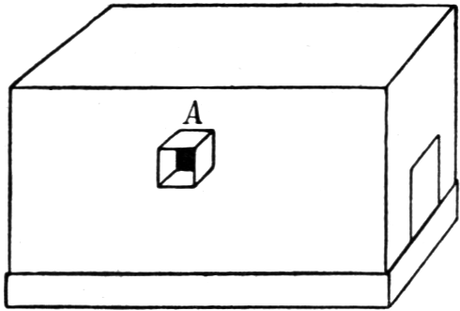
Abb. 203. Blechkasten für den Funkeninduktor.
Zuerst müssen wir uns einen Blechkasten fertigen, in dem der
Funkeninduktor samt der ihn treibenden Akkumulatorenbatterie
untergebracht werden kann. Der Blechkasten muß einen Deckel haben,
dessen Ränder weit übergreifen und fest anliegen. Ferner muß an ihm
vor der Stelle, von der die elektrischen Wellen ausgehen, ein offenes
Ansatzrohr A (Abb. 203) befestigt sein, das einen quadratischen
Querschnitt mit etwa 4 cm Seitenlänge und eine Länge von etwa 5
cm hat. Vorteilhaft ist es, wenn man die Apparate in dem Deckel
zusammenstellt und dann den Kasten umgekehrt darüberstülpt. An dem
Blechkasten muß auch außerdem noch eine Öffnung sein, durch die man zu
der Kontaktvorrichtung für den primären Strom gelangen kann, um die
Tätigkeit des Funkeninduktors hervorrufen oder abstellen zu können.
Diese Öffnung muß aber durch eine Schiebeklappe gut verschließbar sein.
Der zweite Apparat, der ebenfalls noch in dem Kasten Platz finden muß,
ist der Sender oder Radiator, von dem die elektrischen Wellen erzeugt
werden. Dieser Radiator wird ähnlich hergestellt wie der auf Seite 252
beschriebene und in Abb. 207 dargestellte[10], nur unter Verwendung[S. 247]
von etwas kleineren Kugeln (etwa 3 cm Durchmesser). Wie der
Radiator so über dem Funkeninduktor anzubringen ist, daß er möglichst
wenig Platz in Anspruch nimmt, überlasse ich der Phantasie des Lesers.
Nur darauf sei noch hingewiesen, daß die Wände des Kastens überall von
den Klemmen des Funkeninduktors genügenden Abstand haben müssen, da die
Entladung sonst statt durch den Radiator durch das Blech vor sich geht.
Wir kommen jetzt zur Herstellung des Interferenzrohres. Wer im
Bearbeiten von Blech bewandert ist, verfertigt sich diesen Apparat ganz
aus dünnem Weißblech; wer sich das jedoch nicht zutraut, macht ihn aus
Pappe, die innen und außen vollkommen mit starkem Stanniol überzogen
wird. Das Rohr, dessen Schnitt Abb. 204 zeigt, hat einen quadratischen
Querschnitt mit 4 bis 5 cm Seitenlänge. Der Teil B ist,
wie schon aus der Abbildung erhellt, so eingerichtet, daß er, ähnlich
wie eine Posaune, ausgezogen oder eingeschoben werden kann. Dabei
müssen die äußeren Rohrwände sich möglichst genau den inneren anlegen.
Zur Verminderung der Reibung öle man die in Betracht kommenden Teile
ein. Bei α und β setze man gemäß Abb. 204 je zwei Spiegel ein, die aus
Stanniol mit Unterlage von Pappe angefertigt werden. Sie dienen zur
Reflexion der Wellen.
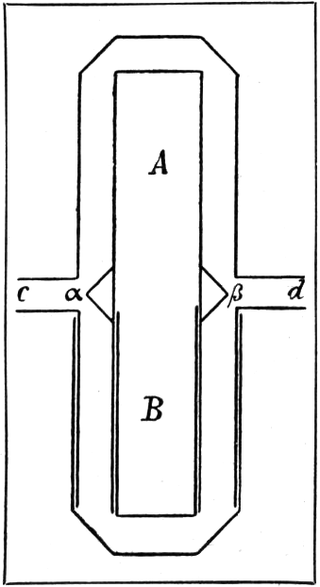
Abb. 204. Interferenzrohr.
Nun wollen wir sehen, wie Rudi die Experimente mit diesen Apparaten
ausführte.
Auf einer hinreichend hohen Unterlage stellte Rudi den Blechkasten
mit den eingeschlossenen Apparaten derart auf, daß das Ansatzrohr
nach rechts zeigte; über letzteres schob er den Ansatz c des
Interferenzrohres, dessen feste Hälfte A auf dem Boden des
Tisches aufstand. Ungefähr 30 cm von der Öffnung d
entfernt, aber genau in gleicher Höhe vor derselben, stellte er den[S. 248]
oben beschriebenen Fritter auf, in den für diesen Versuch möglichst
wenig Feilspäne einzufüllen sind und den er so mit einer elektrischen
Glocke zusammengestellt hatte, wie aus Abb. 205 hervorgeht. An den
Klöppel der Klingel hatte er einen starken Draht a angelötet,
der so gebogen war, daß er, wenn die Glocke in Tätigkeit gesetzt wurde,
an den Fuß des Fritters schlagend diesen erschütterte. Das Glockenbrett
war durch eine Schraube fest mit dem Fritterbrett verbunden. Wie er zur
Vorführung der Experimente die Apparate mit einem Element in leitende
Verbindung brachte, erhellt aus Abb. 205.
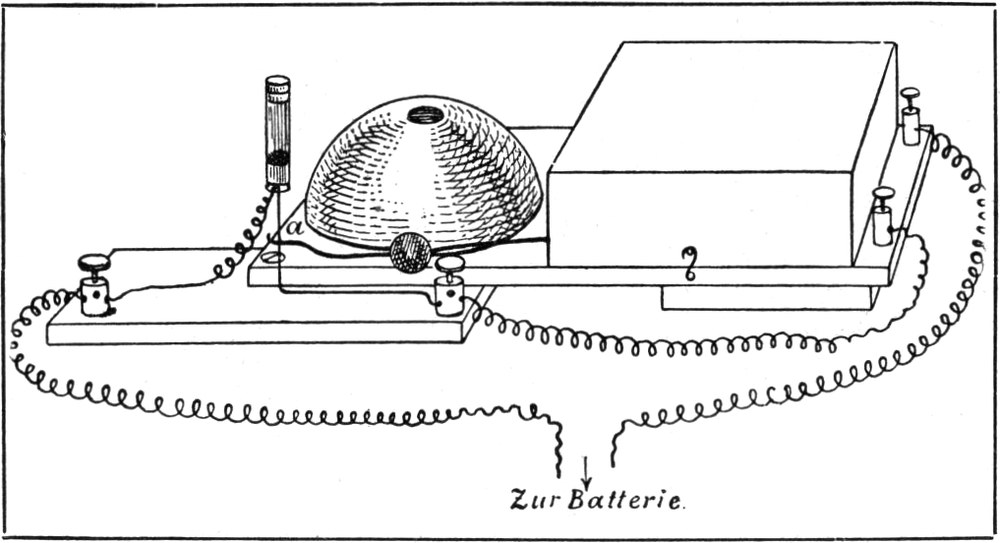
Abb. 205. Fritter mit Glocke und Schüttelvorrichtung.
Sobald nun Rudi den Funkeninduktor in Bewegung setzte, begann die
Glocke zu ertönen, da der Fritter von elektrischen Wellen getroffen
wurde und deshalb dem vom Elemente kommenden Strome keinen Widerstand
mehr entgegensetzte. Die Glocke ertönte aber nur so lange, als
der Funkeninduktor in Tätigkeit war; denn die Leitungsfähigkeit
des Fritters wurde durch das Anschlagen des Drahtes a mit
jedem Hammerschlage der Glocke aufgehoben, um, so lange als er von
elektrischen Wellen getroffen wurde, sofort wieder hergestellt zu
werden. Blieben die Wellen aus, so blieb auch die Leitungsfähigkeit des
Fritters aus, und die Glocke mußte verstummen.
Diesen Vorgang erläuterte Rudi ziemlich eingehend,[S. 249] da er für die
praktische Anwendung der drahtlosen Telegraphie sehr wichtig ist.
Jetzt erst führte Rudi den eigentlichen Interferenzversuch aus. Er
setzte den Funkeninduktor in Tätigkeit, so daß die Glocke ertönte;
dann zog er den Teil B des Interferenzrohres langsam aus; der
Glockenton wurde schwächer und hörte plötzlich ganz auf, weil jetzt der
Weg B um eine halbe Wellenlänge länger war als der Weg A
und deshalb die Wellen bei β in der schon oben angegebenen Weise
einander trafen und aufhoben.
Die Stelle des einen Schenkels des Interferenzrohres, die der Rand
des Auszugrohres bezeichnete, als die Glocke aufhörte zu klingeln,
markierte Rudi durch Ankleben eines gummierten Papierstreifchens.
Darauf zog er das Rohr langsam weiter aus; die Glocke begann wieder
zu tönen und verstummte wieder. Sobald als die Glocke wieder ruhig
geworden war, zog Rudi das Rohr nicht mehr weiter aus, sondern beließ
es an der Stelle und maß darauf die Strecke von der Papiermarke bis zum
Rand des Rohres B. Es zeigte sich, daß die gemessene Strecke
etwa 3 cm lang war; daraus ergibt sich also eine Wellenlänge von
6 cm.
Reflexion und Brechung.
Für die nächsten Versuche stellte Rudi die Apparate in dem Blechkasten
ohne Unterlage auf den Tisch. Statt des Interferenzrohres steckte er
ein etwa 15 cm langes und 4 cm weites, gerades Rohr
auf den Ansatz des Blechkastens. Wenn nun in dem Radiator Funken
übersprangen, so kam aus dem Rohr ein gerades Bündel von elektrischen
Wellen heraus. Rudi konnte mit dem mit der Glocke verbundenen Fritter
genau die Stellen des Raumes bestimmen, welche von elektrischen Wellen
durchsetzt waren. Er stellte den Fritter 1 m von der Rohrmündung
entfernt so auf, daß die Glocke ertönte, und schob dann zwischen die
beiden Apparate zuerst ein großes Brett, dann einen Pappendeckel; die
Gegenstände müssen groß sein, da sich die verhältnismäßig langen Wellen
ähnlich den Schallwellen leicht um sie herumbeugen; die Glocke tönte
unverändert weiter; als er aber eine Blechscheibe dazwischenstellte,
schwieg die Klingel. Die Blechscheibe war den Wellen[S. 250] also ein
Hindernis, das sie nicht überwinden konnten, während sie durch eine
Glasscheibe, durch eine Tortenplatte aus Steingut oder Porzellan, durch
Hartgummi hindurchgingen. Es zeigte sich also, daß die Metalle, also
die Stoffe, die im allgemeinen als Leiter der Elektrizität bekannt
sind, die elektrischen Wellen aufhalten, während die Isolatoren ihnen
den Durchtritt gestatten.
Der nächste Versuch bestand darin, daß Rudi den Fritter ganz aus dem
Bereiche des elektrischen Wellenstrahles herausrückte, so daß die
Glocke verstummte. Dann hielt er eine ebene Blechscheibe so in die
Richtung des Wellenstrahles, daß dieser, in einem bestimmten Winkel
auffallend unter dem gleichen Winkel nach der anderen deren Seite
zurückgeworfen (reflektiert), den Fritter traf, was das Ertönen der
Glocke anzeigte. Abb. 206 zeigt im Aufriß die Aufstellung der Apparate
und den Gang des Wellenstrahles.
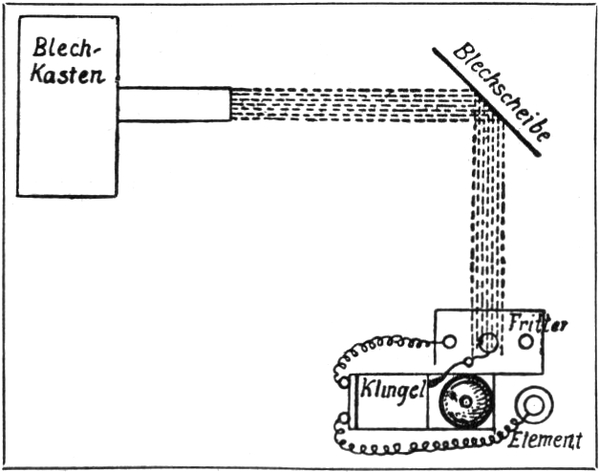
Abb. 206. Schema zum Reflexionsversuch.
Ein weiterer Versuch zeigte die Brechbarkeit der elektrischen Wellen
beim Durchgang durch verschieden dichte Medien. Wie eine Konvexlinse
die Lichtstrahlen, die parallel die Linse treffen, so bricht, daß sie
sich hinter der Linse in einem Punkt vereinigen, so kann man auch die
elektrischen Wellenstrahlen in einer Konvexlinse sammeln.
Rudi stellte den Fritter so weit von dem Blechkasten entfernt auf —
aber genau in der Richtung des Ansatzrohres —, daß die Glocke eben
nicht mehr ertönte. Dann hielt er vor den Fritter einen mit Petroleum
gefüllten Glaskolben — eine Kochflasche von 1 bis 1½ Liter Inhalt
—, und die Glocke ertönte laut. Die in jener Entfernung schon sehr
zerstreuten Strahlen wurden in der Kochflasche gesammelt und hinter
ihr gerade im Fritter in einem Punkte vereinigt.[S. 251] Die geeignetste
Entfernung der Flasche vom Fritter stellte Rudi schon vor dem Vortrage
durch Probieren fest.
„Durch diese Versuche,“ sprach Rudi weiter, „und noch manche andere,
die ich hier nicht vorführen kann, hat man die große Ähnlichkeit der
elektrischen Wellen mit den Lichtwellen nachgewiesen, und man darf
als bewiesen annehmen, daß sowohl dem Licht wie auch der Elektrizität
dasselbe Medium, der an sich freilich noch hypothetische Äther, zur
Fortbewegung dient. Der Äther erfüllt den ganzen Raum. Wir können in
ihm sich rasch fortpflanzende Schwingungen erzeugen und haben auch
die Möglichkeit, das Vorhandensein solcher Schwingungen nachzuweisen.
Damit ist theoretisch das Problem der drahtlosen Telegraphie gelöst.
In der Praxis aber gestalten sich die Verhältnisse doch sehr viel
umständlicher. Sie haben schon bei dem letzten Versuche gesehen,
daß mit wachsender Entfernung die Wirkung der elektrischen Wellen
auf den Fritter abnimmt und schließlich aufhört. Man hat deshalb
zuerst versucht, die elektrischen Wellen ähnlich wie das Licht in
einem Scheinwerfer, in einem Parabolspiegel zu erzeugen und ebenso
mit einem Parabolspiegel, in dessen Brennlinie sich der Fritter
befand, aufzufangen. Ich könnte Ihnen diese Parabolspiegelversuche
hier vorführen; doch da sie eigentlich nichts Neues zeigen, so nehme
ich davon Abstand. Wichtiger ist es, daß man die Fernwirkung der
elektrischen Wellen dadurch sehr wesentlich verstärken kann, daß man
mit den die Wellen erzeugenden und empfangenden Teilen der Apparate
lang ausgestreckte und frei endende Drähte verbindet.“
Bevor wir die nun folgenden Ausführungen Rudis anhören, wollen wir
sehen, wie er sich die verschiedenen für die Experimente nötigen
Apparate hergerichtet hatte.
Der Sender.
Der Sender wurde schon erwähnt, aber noch nicht genau beschrieben.
Er ist in Abb. 207 gezeichnet. Zwei Metallkugeln A und
A′ von 5 bis 6 cm Durchmesser (über die Herstellung
der Metallkugeln siehe Seite 7) werden gut angewärmt und ganz mit
einem Überzug von rotem Siegellack, dem, um ihm die Sprödigkeit zu
nehmen, einige Tropfen Leinöl zugefügt sind, überzogen. Ein dicker
Schellacküberzug (siehe Seite 5)[S. 252] tut die gleichen Dienste. Bei jeder
Kugel wird dann an zwei einander gegenüberliegenden Stellen eine 0,5
bis 1 cm große Stelle von dem Überzug befreit.
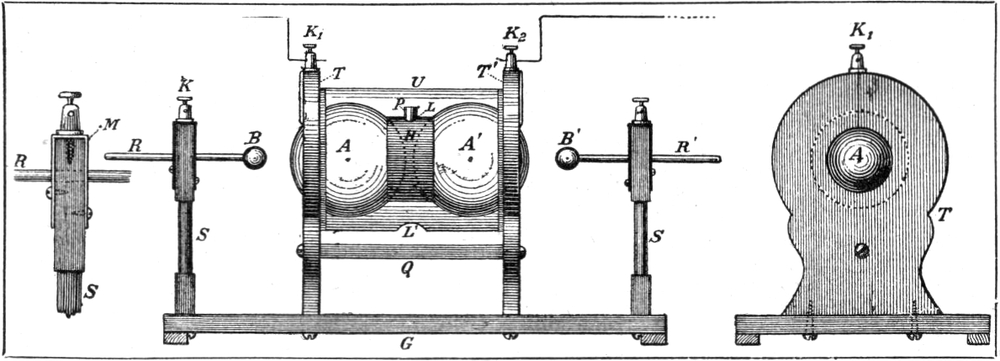
Abb. 207. Der Sender.
Die Befestigung der Metallkugeln in einem Holzgestell ist hinreichend
deutlich aus der Abbildung zu erkennen: Auf dem Grundbrett G
sind zwei mit runden Ausschnitten versehene Trägerbrettchen T
befestigt und durch die Querleiste Q fest miteinander verbunden.
Auf den Trägern sitzen, durch Vulkanfiberklötzchen vom Holze isoliert,
die beiden Klemmen K₁, welche mit A, und K₂,
welche mit A′ metallisch verbunden ist. Bevor wir jedoch diese
Verbindung herstellen und die Entfernung von T und T′
bestimmen, werden die beiden Kugeln durch den Ring H fest
miteinander verbunden. Der Ring, der so weit und breit sein muß, daß,
wie aus der Abbildung ersichtlich, die daraufgesteckten Kugeln mit je
einer vom Siegellack befreiten Stelle etwa 1 bis 5 mm — je
nach der Stärke der Stromquelle — voneinander entfernt sind, wird aus
in Paraffin gekochter Pappe zusammengeklebt und wie die Kugeln mit
einer Siegellack- oder Schellackschicht innen und außen überzogen.
An einer Stelle L ist zum Einfüllen von Petroleum die Öffnung
L gelassen, die mit dem Pfropfen P verschlossen werden
kann. U ist eine Umhüllung (nicht notwendig) um A und
A′, ebenso hergestellt wie der Ring H, die die Kugeln
aber nicht berührt und mit einem Loch L′ versehen ist, das nach
dem Einfüllen des Öles in den Ring H[S. 253] nach unten gedreht wird.
Die beiden Kugeln werden mit dem Ringe dadurch dauernd verbunden, daß
die beiden Berührungsfugen mit heißem Siegellack (bei Verwendung von
Schellack mit Schellackkitt Seite 5) ausgegossen werden. Jetzt wird
das Kugelpaar in die Ausschnitte der beiden Träger eingeklemmt. Es
schauen jetzt die äußeren beiden vom Siegellack befreiten Stellen über
die Träger heraus; diesen blanken Stellen gegenüber stehen die kleinen
Kügelchen B und B′, die an den in S verschiebbaren
Stangen R und R′ angelötet sind. Die Säulen S
sind aus Glas herzustellen und mit Holzköpfen zu versehen, über
welche (siehe die links stehende Sonderzeichnung in Abb. 207) je ein
Blechstreifchen M gebogen wird, auf dem eine Klemme K
angelötet ist. Die Säulenköpfe mit dem Blechstreifen M sind
derartig durchbohrt, daß die Stangen R in der Bohrung unter
Reibung an M hin und her geschoben werden können.
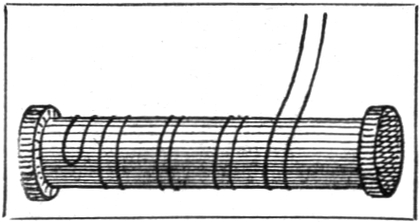
Abb. 208. Bifilare Wickelung.
Der Empfänger.
Um den Empfänger möglichst empfindlich zu machen, müssen wir in die
schon oben beschriebene Zusammenstellung von Glocke und Fritter ein
Relais (siehe Seite 121) einschalten. Ferner müssen wir das Entstehen
der Unterbrechungsfunken an der elektrischen Klingel verhindern, da
von diesen Funken der Fritter in unerwünschter Weise beeinflußt werden
kann. Im allgemeinen wird es genügen, das Werk der Glocke mit einer
Metallkapsel zu überdecken. Ist der Fritter jedoch sehr empfindlich,
so müssen die beiden Teile der Unterbrechungsstelle des Wagnerschen
Hammers durch einen Widerstand von 500 bis 1000 Ohm — durch Versuche
genauer zu ermitteln — verbunden werden. Verwenden wir für diesen
Widerstand einen entsprechend langen und dünnen Nickelindraht, so
ist es vorteilhaft, ihn bifilar auf eine Spule zu wickeln.
Eine bifilare Wickelung stellt man folgendermaßen her: Man biegt
den Draht in der Mitte seiner ganzen Länge um und wickelt ihn dann
doppelt, so wie aus Abb. 208 hervorgeht, auf eine Spule auf. Solche
Spulen[S. 254] besitzen keine Selbstinduktion. Man kann auch Graphitstäbe aus
Bleistiften als Widerstand benutzen.
Die beim Relais auftretenden Funken können dadurch unschädlich
gemacht werden, daß wir diesen Apparat mit einem völlig geschlossenen
Metallkasten überdecken. Auch kann das Relais weiter vom Fritter
entfernt aufgestellt werden.
Wollen wir nun, daß die vom Sender gegebenen Zeichen vom Empfänger
nicht nur durch das Ertönen der Glocke angezeigt, sondern auch gleich
niedergeschrieben werden, so müssen wir zu den bereits erwähnten
Apparaten noch einen Morseapparat (Seite 115) schalten.
Wie die einzelnen Apparate zu verbinden sind, ersieht man aus dem
Schema Abb. 209; in dieser Abbildung ist auch die Schaltungsweise der
Sendeapparate angegeben.
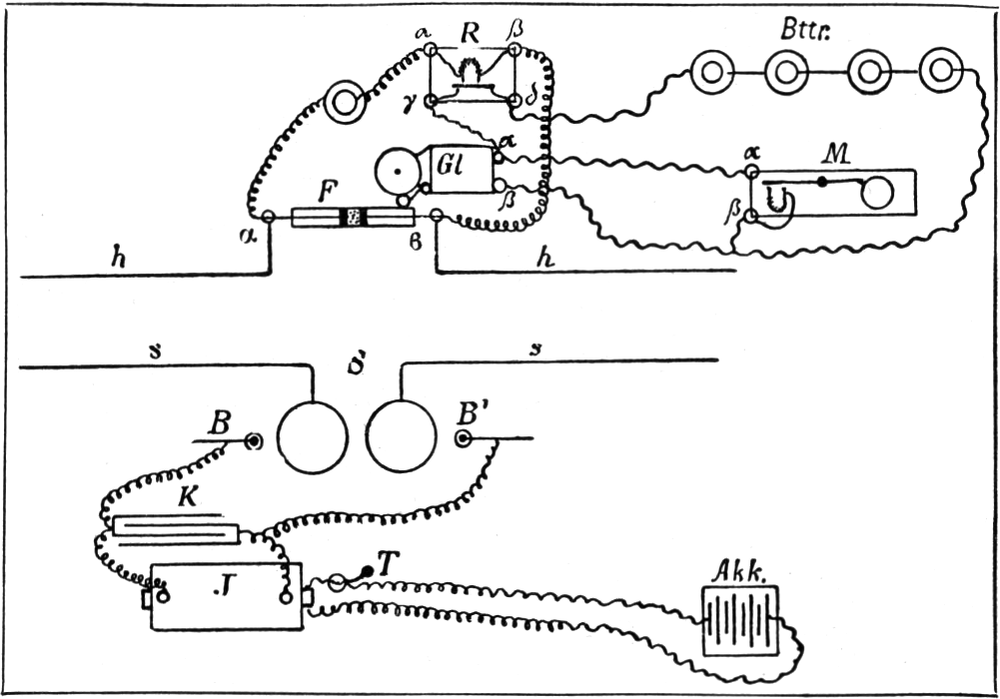
Abb. 209. Anordnung der Apparate zur drahtlosen
Telegraphie.
Mit Akk. ist die Akkumulatorenbatterie bezeichnet, die den
Funkeninduktor J speist. Die Leitung ist durch den Taster
T unterbrochen, mit dessen Hilfe wir den Strom nach Belieben
kurz oder lang einschalten können. Die Sekundärpole des Induktors
verbinden wir unter Einschaltung[S. 255] eines Kondensators K mit den
Kugeln B und B′ des Senders S. Unter Umständen
funktionieren die Apparate aber ohne Kondensator besser,
was sich, wie auch die günstigste Größe des Kondensators, leicht
durch einige Versuche ausfindig machen läßt. An die beiden Klemmen
K₁ und K₂ des Senders (Abb. 207) schließen wir
die beiden frei endenden, 50 bis 100 cm langen und völlig
gerade gestreckten Drähte s an, die beide genau in einer Linie
verlaufen sollen.
Genau in der gleichen Weise werden die beiden Drähte h
(siehe auch Abb. 196) an die Klemmen α und β des Fritters F
angeschlossen. α von F wird dann mit dem einen Pol eines
Salmiakelementes, dessen anderer Pol mit der Klemme α des Relais
R und dessen Klemme β mit β von F verbunden. Die Glocke
(Gl) und der Morseapparat (M) werden nebeneinander
geschaltet mit den Klemmen γ und δ des Relais und Batterie
(Bttr.) verbunden, wie das hinreichend deutlich aus der
Abbildung hervorgeht.
Sollte sich, was man durch einen Versuch feststellen mag, ein
Hintereinanderschalten von Glocke und Morseapparat als vorteilhafter
erweisen, so fallen die Verbindungen von βM nach βGl und
von αM nach αGl weg, dafür wird αM mit βGl
verbunden.
Da zum Zeichengeben auf größere Entfernungen der Fritter möglichst
empfindlich sein soll, so füllen wir, im Gegensatz zu den oben
erwähnten Versuchen (vergleiche Seite 248) eine ziemlich hohe Schicht,
etwa 5 bis 10 mm, von Feilspänen in das Röhrchen. Da beim
Gebrauch des Morseapparates das fortdauernde Tönen der Glocke unnötig
ist, die Erschütterung des Fritters durch den Glockenklöppel aber nicht
ausbleiben darf, so steckt man unter die Glockenschale, um deren Schall
etwas zu dämpfen, etwas Papier.
Rudi erklärte, während Käthe die einzelnen Apparate zeigte, die
ganze Einrichtung, wie sie in Abb. 209 dargestellt ist. Dann machte
sich die eifrige Assistentin daran, die Türen der drei hinter dem
Vortragsraum gelegenen Zimmer zu öffnen und die Sendapparate auf
einen im hintersten Zimmer bereitgestellten Tisch zu transportieren.[S. 256]
Unterdessen stellte Rudi die Empfangsapparate so auf, daß die
Fangdrähte (hh Abb. 209) des Empfängers denen des Senders
(ss) parallel verliefen, und wies auf die Notwendigkeit dieses
Umstandes hin. Ferner erwähnte er, daß die Entfernung der beiden
Apparate jetzt etwa 17 bis 18 m betrage.
Darauf gab Rudi einer sich auf seine Frage hin freiwillig meldenden
Dame aus dem Kreise seiner Zuhörer einen Briefkarton mit Bleistift
und Umschlag und bat sie, einige Worte darauf zu schreiben und den
Karton dann in den Umschlag zu stecken und diesen zuzukleben. Er
begab sich gleich wieder hinter seinen Experimentiertisch. Als die
Dame mit Schreiben fertig war, winkte Rudi seiner Schwester, welche
den verschlossenen Brief mit in das hinterste Zimmer nahm, in dem die
Sendapparate standen. Die letzte Türe schloß Käthe, die beiden anderen
Türen — damit man ja sah, daß alle drei Türen geschlossen seien —
schloß Rudi.
Er stellte sich ganz auf die Seite des Tisches, so daß er die Apparate
nicht erreichen konnte. Er bat seine Hörer, sich einen Augenblick
zu gedulden. Plötzlich begann das geheimnisvolle Geklapper des
Morseapparates — Rudi hatte sich einen solchen mit einem Uhrwerk
hergestellt, so daß er ihn nicht bedienen mußte (siehe Seite 117
u. f.) — und der stumpfe Ton der abgedämpften Klingel. Käthe, die die
Morseschrift (Seite 120) und die Handhabung des Morsetasters gelernt
hatte, hatte den Brief geöffnet und ließ durch kürzeres und längeres
Schließen und Öffnen des Primärstromkreises den Inhalt des Schreibens
durch die drei Zimmer wandern, so daß er in Form von kurzen und langen
Strichen auf dem Papierstreifen des Morseapparates niedergeschrieben
wurde.
Als die Apparate aufhörten zu arbeiten, riß Rudi den beschriebenen
Papierstreifen ab und schrieb dessen Inhalt zuerst in Morseschrift,
dann in Kursivschrift auf eine große Tafel, die er so aufstellte,
daß alle sie sehen konnten. Unterdessen war Käthe gekommen und hatte
den geöffneten Brief den Zuhörern zum Herumgeben überreicht, so daß
sie sich überzeugen konnten, daß auf der Tafel genau dieselben Worte
standen wie in dem Brief.
[S. 257]
„So wunderbar diese drahtlose Telegraphie manchem erscheinen mag, so
ist sie im Grunde kaum wunderbarer als die Tatsache, daß Sie meine
Stimme vernehmen. Zwischen mir und Ihnen sind auch keine Drähte
gespannt; und da weder in meinem Halse noch in Ihren Ohren Drähte sind,
so kann ich das Sprechen mit viel größerem Rechte eine ‚drahtlose‘
Telegraphie nennen, als das Verfahren hier, zu dem ich Apparate
brauche, die nichts weniger als ‚drahtlos‘ sind.“
Damit schloß Rudi diesen Teil seines Vortrages ab, um zum zweiten
Teil, den er zu Anfang schon gestreift hatte, zu den Versuchen mit
Wechselströmen hoher Frequenz, den sogenannten Teslaströmen
überzugehen.
Bevor wir jedoch Rudi in seinen Ausführungen fortfahren lassen, wollen
wir zuerst wieder erklären, wie die Teslaapparate herzustellen und die
Versuche auszuführen sind.
Teslatransformatoren.
Wir haben aus dem vierten Vortrage gelernt, daß der Grad der
Plötzlichkeit der Unterbrechung des Primärstromes in einem
Induktionsapparat und die Häufigkeit der Unterbrechung oder Änderung
der Stromrichtung in einer Sekunde von besonderer Bedeutung für den
sekundären Strom ist. Nun ist am Anfang dieses Vortrages schon darauf
hingedeutet worden, daß in dem Entladungsstromkreis einer Leidener
Flasche ein Wechselstrom von außerordentlich hoher Wechselzahl fließt,
sowie eine Entladung vor sich geht.
Einen solchen Entladungsstrom schicken wir durch die Primärspule
eines Transformators. In der Sekundärspule entstehen dann Ströme mit
scheinbar ganz abgeänderten Eigenschaften.
Das Schema dieser Anordnung zeigt Abb. 210. J ist der
Funkeninduktor mit den Klemmen K und K′. Von K
geht ein Draht zu dem äußeren Belag einer Leidener Flasche L,
von hier zur Klemme K₁ des Transformators T;
K₁ ist mit dem einen Ende der Primärspule S von
T verbunden, das andere Ende der Spule führt über die
verstellbare Funkenstrecke F zur Klemme K₂, und von
hier geht ein Verbindungsdraht über den inneren Belag der Leidener
Flasche zu K′. Wenn also der Funkeninduktor[S. 258] in Tätigkeit ist,
so wird L geladen und entladet sich durch F. In der
Spule S fließt also der Entladungsstrom der Leidener Flasche
und induziert in der sekundären Spule S′, die im Verhältnis zu
S aus vielen Windungen eines dünnen Drahtes besteht, einen sehr
hochgespannten Strom, der an den Kugeln E₁ und E₂
zur Entladung kommt.
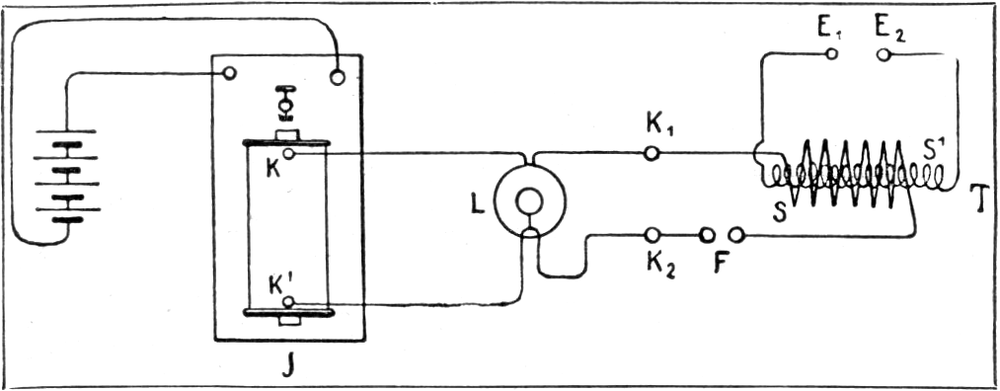
Abb. 210. Schaltungsschema des Teslatransformators.
Die Anordnung von primärer und sekundärer Spule ist beim Teslaschen
Transformator etwas anders als bei den gewöhnlichen Induktoren. So
ordnet man z. B. die primäre Spule gewöhnlich außerhalb der sekundären
an. Ferner sind die Verhältnisse der Drahtmaße ganz anders. Die
Primärspule besteht aus einem sehr dicken Draht mit nur einigen, weit
voneinander abstehenden Windungen; die Sekundärspule aus einem sehr
dünnen Draht, der aber bei weitem nicht so lang sein muß, als bei dem
gewöhnlichen Funkeninduktor.
Die im folgenden angegebenen Maße eignen sich besonders bei Verwendung
von Funkeninduktoren von 10 bis 20 cm Funkenlänge, oder einer
etwa entsprechenden Influenzmaschine. Beim Gebrauch von kleineren
Induktoren nehme man von den angegebenen Maßen ⅔ bis ½. Näheres über
Drahtlängen ist bereits auf Seite 134 u. f. gesagt.
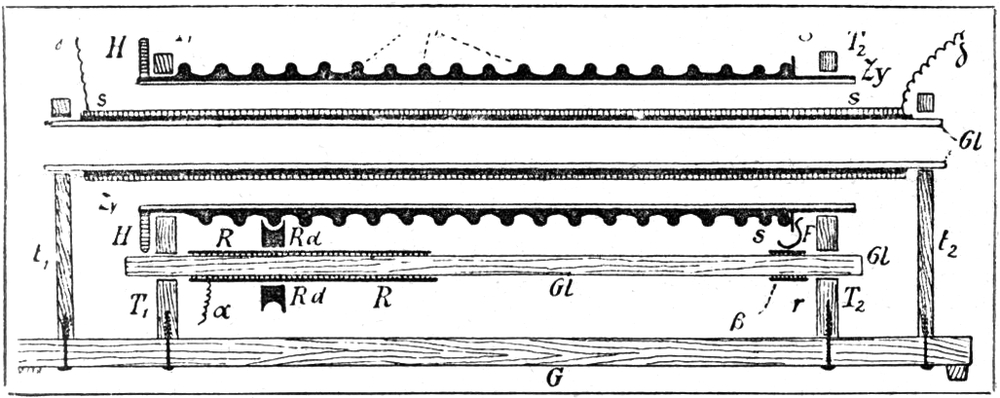
Abb. 211. Teslatransformator (Schnitt).
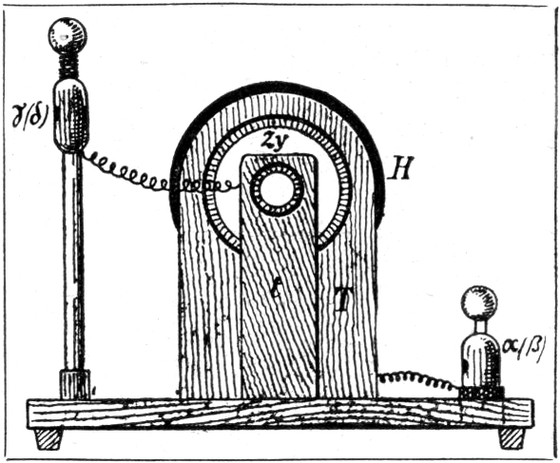
Abb. 212. Teslatransformator (Seitenansicht).
Abb. 211 zeigt den Apparat im Schnitt, Abb. 212 von der Seite gesehen.
Wir fertigen uns zuerst die primäre Spule. Dazu beschaffen wir uns
einen Zylinder (Zy) von einem Auerbrenner; der Zylinder darf
keine Einschnürung haben, die Wandungen müssen ihrer ganzen Länge nach
parallel sein. Auf den Zylinder winden wir[S. 259] einen 2,5 bis 3 mm
starken, gut durchgeglühten, blanken Kupferdraht so auf, daß jede
Windung von der folgenden einen Abstand von 1 cm hat (Sp
in Abb. 211). Läßt man nach dem Wickeln den Draht los, so wird die
Spirale etwas auseinanderfedern und somit nicht mehr dicht am Zylinder
anliegen. Wir überziehen deshalb und auch zur besseren Isolation
letzteren nachträglich mit einer möglichst gleichmäßigen Schicht
von Schellackkitt (Seite 5), dem wir, um leichtere Arbeit zu haben,
ziemlich viel Schellacklösung zusetzen. Der Überzug muß so dick sein,
daß die über den Zylinder geschobene Spirale fest aufsitzt. Der Draht
an dem einen Ende der Spirale wird so gebogen, daß ein geschlossener
Kreis entsteht. An diesen Kreis wird ein flacher Ring (S) aus
Kupfer- oder Messingblech gelötet, dessen innerer Durchmesser gleich
dem der Spirale ist, und dessen äußerer etwa 5 mm mehr beträgt.
Auf der anderen Seite endet die Spirale offen. Um ihr noch mehr
Halt auf dem Zylinder zu geben, streicht man den Raum zwischen den
einzelnen Windungen mit einer dicken Schellacklösung aus. Dabei ist
jedoch[S. 260] besonders darauf zu achten, daß die Außenseite des Drahtes,
besonders da, wo sie das Kontakträdchen Rd berühren soll, nicht
mit Schellack überzogen wird. An einem Rande des Zylinders wird nun
noch ein 1 bis 1,5 cm breiter Ring H aus Hartgummi mit
Schellackkitt angekittet, der dazu dient, den Zylinder, während der
Apparat in Tätigkeit ist, zu drehen.
Die Träger T₁ und T₂ des Zylinders werden aus
Holz oder besser aus Vulkanfiber hergestellt. Sie erhalten, wie aus
den beiden Figuren deutlich hervorgeht, runde Ausschnitte, welche die
beiden Enden des Zylinders in sich aufnehmen.
Ferner werden die beiden Träger T₁ und T₂ unterhalb
des eben erwähnten Ausschnittes noch mit zwei Bohrungen versehen, in
die ein Glasstab oder ein dickwandiges Glasrohr aus gut isolierendem
Glas eingekittet werden kann. Dieser Stab ist nur in Abb. 211 zu sehen
und mit Gl bezeichnet. Nahe dem rechten Ende dieses Stabes
wird ein kurzes Messingrohrstückchen r aufgekittet, an dem die
Schleiffeder F (aus gehämmertem Kupferblech) und der Kupferdraht
β angelötet wird. F soll an dem schon oben erwähnten Messingring
S schleifen.
Außerdem kitten wir ein Messingrohr R, das etwa ⅓ so lang ist
als der Glasstab, nahe dessen linkem Ende fest. An R wird der
Draht α angelötet. Auf R soll sich das Rädchen Rd leicht
drehen und hin und her schieben lassen. Rd wird aus Messing
hergestellt und erhält auf seiner Peripherie eine halbkreisförmige
Rinne, in welche gerade der Draht der primären Spirale hineinpaßt, wie
aus Abb. 211 hervorgeht. Die Größe des Rädchens und der Abstand des
Glasstabes vom Zylinder sind natürlich entsprechend zu wählen.
Durch Drehen des Zylinders kann man bei dieser Anordnung bewirken, daß
das Rädchen entweder das äußerste Ende der Drahtspirale berührt, oder
eine beliebig weiter innen gelegene Stelle. Man kann also den bei α
ein- und bei β austretenden Strom nach Belieben durch mehr oder weniger
Windungen der Spirale gehen lassen, was deshalb große Vorteile bietet,
weil wir dadurch das[S. 261] günstigste Verhältnis der Windungszahlen zwischen
primärer und sekundärer Spule durch Probieren ausfindig machen können.
Da sich dieses günstigste Verhältnis bei Verwendung verschiedener
Leidener Flaschen, ja sogar verschiedener Verbindungsdrähte ändert, so
ist der Vorteil, den diese Möglichkeit der Abstimmung bietet, nicht zu
unterschätzen.
Wir kommen jetzt zur Herstellung der sekundären Spule. Wir beschaffen
uns ein gut isolierendes Glasrohr (Glr) oder besser noch
der Sicherheit halber ein gleich bemessenes Hartgummirohr (über
Isolierfähigkeit des Glases siehe Seite 6), 6 bis 8 cm länger
als der Lampenzylinder und 2 bis 3 cm weit. Das Rohr wird, indem
jedes Ende 1 cm weit frei bleibt, mit einem ohne Umspinnung
0,5 bis 0,7 mm starken, mit guter Seide isolierten
Kupferdrahte bewickelt, indem wir Windung dicht an Windung legen. Wir
stellen nur eine Lage her, die wir mit heißem Paraffin bestreichen.
Besser ist es, das ganze bewickelte Rohr in einem geeigneten Gefäß so
lange in kochendes Paraffin zu legen, bis keine Luftbläschen mehr aus
den Drahtwindungen aufsteigen.
Dies ist das einfachere Verfahren zur Herstellung der sekundären
Wickelung. Eine viel sicherere Isolation — und die ist bei den
hochgespannten Strömen sehr wichtig — erzielen wir folgendermaßen.
Wir überziehen das Glasrohr mit einer 3 bis 4 mm dicken
Schicht von Schellackkitt und drehen auf der Drehbank — falls wir
keine besitzen, lassen wir das von einem Mechaniker machen — diesen
Überzug bis auf etwa 2 mm Dicke ab. In diesen Schellacküberzug
schneiden wir dann ein Schraubengewinde ein. In den Gewindegängen wird
dann ein 0,5 bis 0,7 mm starker nackter Kupferdraht
aufgewunden. Das Gewinde dient also nur dazu, daß man den unisolierten
Draht aufwickeln kann, ohne daß die einzelnen Windungen einander
berühren. Dasselbe kann man aber auch dadurch erreichen, daß man auf
den mit einem gleichmäßigen Schellackkittüberzug versehenen Glasstab
zwei Drähte gleichzeitig nebeneinander aufwickelt, die Enden des einen
festbindet und den anderen[S. 262] wieder entfernt. Die beiden Drahtenden
müssen selbstverständlich einige Zentimeter frei von der Spule abstehen.
Jetzt wird das bewickelte Glasrohr ganz etwa zehn Minuten in Spiritus
gelegt und gleich nach dem Herausnehmen mit einer nicht zu dicken
Schellacklösung bestrichen. Nach dem völligen Trocknen dieses
Überzuges wird ein zweiter, dann ein dritter und vierter Überzug
hergestellt, bis die Drahtwindungen völlig in Schellack eingebettet
sind. Zur Herstellung der Schellacklösung verwende man nur ganz reinen
Spiritus und achte darauf, daß in die Lösung kein Staub und dergleichen
gerät. Die Schellacküberzüge, vor allem der erste, müssen völlig
luftblasenfrei hergestellt werden.
Ist so die sekundäre Spule fertiggestellt, so wird sie so in den beiden
Trägern aus Holz (oder Vulkanfiber) befestigt, daß sie genau in der
Mitte des Zylinders Zy liegt. Diese Anordnung geht hinreichend
deutlich aus den beiden Abb. 211 und 212 hervor.
Zur Fertigstellung des Apparates wären jetzt nur noch die Drahtenden
α und β der primären und γ und δ der sekundären Spule zu Klemmen zu
führen.
Die Klemmen dürfen, wie Abb. 212 zeigt, keine scharfen Kanten oder
Ecken haben. Die beiden Klemmen α und β werden in einem Abstande, der
etwa der Länge des Zylinders Zy entspricht, nahe der einen
Längsseite des Grundbrettes G in diesem isoliert befestigt.
Wir kitten zu diesem Zweck für jede Klemme mit rotem Siegellack
ein hinreichend weites Stückchen Glas- oder Ebonitrohr in eine
entsprechende Bohrung des Holzes. In dieses Rohr wird dann die Klemme
mit Schellackkitt oder Siegellack eingekittet.
[S. 263]
Die Klemmen, zu denen die Drahtenden γ und δ führen sollen, werden
auf hohen Glasfüßen befestigt, wie Abb. 212 zeigt. (Wegen Befestigung
der Glasfüße vergleiche Seite 5.) Die Drahtenden der sekundären Spule
werden nicht, wie in der Abb. 212 der Deutlichkeit halber gezeichnet
ist, in Spiralwindungen zu den Klemmen geführt, sondern möglichst
gestreckt ausgespannt. Außerdem wird ein enger, aber dickwandiger
Gummischlauch (Ventilschlauch) über sie gezogen.
Damit ist der Teslatransformator für unsere Versuche fertig, und es
fehlt uns nur noch das Funkenmikrometer.
Das Funkenmikrometer.
Abb. 213 zeigt diesen Apparat im Querschnitt und von der Seite gesehen.
G ist das Grundbrett, auf das längs der langen Seiten zwei
Leistchen L geleimt sind, zwischen denen sich der Schlitten
Sch mit ein wenig Reibung hin und her schieben läßt. In dem
Schlittenbrettchen Sch ist das Messingröhrchen R und in
diesem die Glassäule Gl eingekittet. Ebenso ist an dem einen
Ende des Grundbrettes eine Glassäule befestigt. Auf jeder Glassäule
ist ein kurzes, zylindrisches und an beiden Enden abgerundetes
Zinkstück Z, das mit einer Querbohrung versehen ist,
aufgekittet. Diese beiden Zinkstücke sind von einem noch ungebrauchten
Zinkstab eines Salmiakelementes abgesägt, und die Enden sind rund
gefeilt oder auf der Drehbank abgedreht worden. Außerdem ist an
jeden ein Haken H angelötet oder eingeschraubt. Der einfache
in Zentimeter und Millimeter geteilte Maßstab M ist so auf
L angeschraubt, daß er übergreifend den Schlitten Sch am
Herausfallen verhindert. Letzterer trägt eine Marke, die, wenn sich die
beiden Zinkköpfe gerade berühren, auf den Nullpunkt des Maßstabes zeigt.
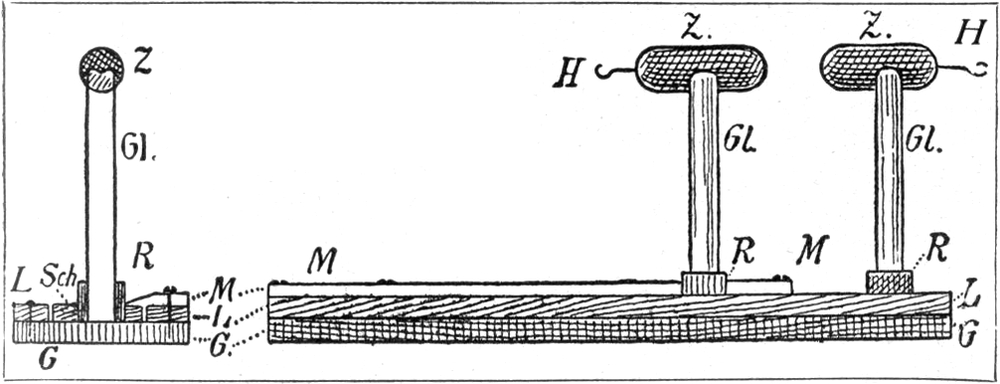
(Querschnitt.) Abb. 213. Funkenmikrometer. (Von der
Seite gesehen.)
Einfacher Teslatransformator.
Man kann sich auch einen etwas einfacher konstruierten Teslaapparat
fertigen. Abb. 214 zeigt einen solchen in perspektivischer Ansicht.
Die primäre Drahtspule steht mit senkrechter Längsachse frei; in ihr
steht die sekundäre[S. 264] Drahtspule, die ähnlich herzustellen ist wie die
für den oben beschriebenen Apparat. Der Durchmesser beider Spulen
kann hier etwas größer gewählt werden: für die primäre Spule 7 bis
8 cm, für die sekundäre etwa 4 cm. Man kann in diesem
Fall den Glaszylinder eines Auerbrenners als Träger für die sekundäre
Spirale verwenden. Das Funkenmikrometer ist hier auf dem Grundbrette
des Apparates selbst angebracht. Im übrigen müssen die entsprechenden
Teile in derselben Weise sorgfältig isoliert sein wie bei dem oben
beschriebenen Transformator.
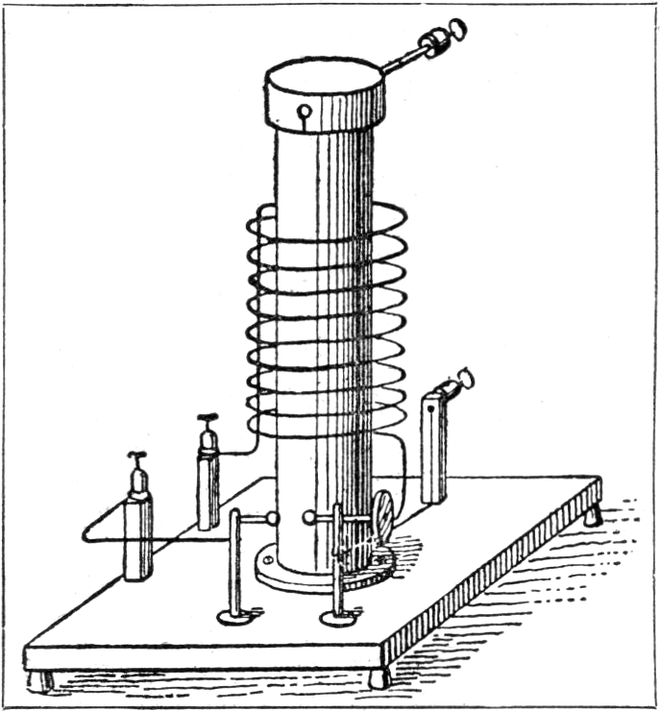
Abb. 214. Teslascher Transformator.
Ein dritter Typus von Teslatransformatoren, dessen Herstellung aber
nicht sehr zu empfehlen ist, unterscheidet sich von den beiden anderen
dadurch, daß der primäre Draht nicht zu einer Spule, sondern zu
einer in einer Ebene liegenden Spirale (Schnecke) aufgewunden
ist. Die sekundäre Spule ist ebenfalls scheibenförmig und wird genau
so hergestellt, wie die einzelnen Scheiben des auf Seite 168 u. f.
beschriebenen Funkeninduktors. Die Drahtmaße der primären Spule sind
hier den oben erwähnten gleich. Die sekundäre Wickelung wird jedoch
aus einem 0,2 bis 0,3 mm starken und etwa 4- bis 5mal so langen
Draht, als wir für den erstbeschriebenen Apparat benötigten, in der
bereits erwähnten Weise hergestellt. Einen derartig gefertigten
Apparat besaß Rudi. Wir sehen diesen auf dem die Reproduktion einer
Photographie darstellenden Bilde Seite 157.
[S. 265]
Teslaversuche.
Wir kommen jetzt dazu, die Experimente zu besprechen, die Rudi in
seinem Vortrag mit dem Teslatransformator ausführte.
Rudi erklärte zuerst die Konstruktion und die Schaltungsweise der
Teslatransformatoren und wies dann auf die abgeänderten Eigenschaften
der Wechselströme hoher Frequenz hin:
„Ich habe hier zum Betrieb meiner Apparate einen Akkumulator, der mir
10 Volt liefert. Ich kann die Polklemmen anfassen, ohne irgend etwas
zu spüren. Der Strom hat eine zu geringe Spannung, um durch den Körper
hindurchzugehen. In dem Funkeninduktor, der eine Schlagweite von 15
bis 20 cm besitzt, wird der Strom auf Kosten seiner Intensität
auf einige tausend Volt transformiert. Würde ich beide Pole
dieses Apparates gleichzeitig anfassen, wenn er in Tätigkeit
ist, so bekäme ich einen Schlag, der unter Umständen heftig genug
wäre, mir einen oder beide Arme für mein ganzes Leben zu lähmen. Nun
wird dieser Strom durch die Leidener Flaschen in einen Wechselstrom
von sehr hoher Frequenz verwandelt; darüber sprach ich ja zu Anfang.
Diesen Wechselstrom transformiere ich, wie schon erwähnt, im
Teslatransformator auf eine noch höhere Spannung.
Wie sich nun die hierbei entstehenden Ströme verhalten, will ich Ihnen
hier zeigen. Ich habe in die eine Polklemme des Transformators einen
senkrecht in die Höhe stehenden Draht eingeschraubt, der frei endet.“
Käthe verdunkelte das Zimmer, und Rudi setzte die Apparate in
Tätigkeit. Von allen freien Metallteilen, besonders von den Klemmen der
Apparate, zuckten feine blaue Lichtfädchen, die mitunter dichte Büschel
bildeten, nach allen Seiten. Der blendende Entladungsfunke (siehe
die Kritik Seite 270) der Leidener Flaschen, der am Funkenmikrometer
übersprang, machte einen solchen Lärm, daß Rudi nicht weitersprechen
konnte. Der senkrecht in die Höhe ragende, mit einer Klemme des
Transformators verbundene Draht war zu einem funkensprühenden
Lichtstreif geworden, von dessen Ende sich ein blauer, fein verästelter
Lichtbaum unheimlich hin und her schwebend[S. 266] im Dunkel verlor. Jetzt
faßte Rudi, der von dem unheimlichen Lichtschimmer schwach beleuchtet
war, zum großen Erstaunen der Zuschauer mit der rechten Hand die freie,
feuersprühende Klemme des Teslaapparates an und näherte den Zeigefinger
der linken Hand, den er durch ein aufgeschobenes Stückchen Messingrohr
verlängert hatte, dem vorhin erwähnten senkrecht stehenden Draht. Unser
Bild Seite 157 zeigt die dabei auftretende Lichterscheinung. Rudi
spürte kaum ein leichtes Zucken durch den Körper. Wenn man die nackte
Haut den einschlagenden Funken aussetzt, so können brandwundenähnliche
Verletzungen entstehen; man schützt sich deshalb, indem man die Funken
in ein Metallstück, das man in der Hand hält, oder in der erwähnten
Weise auf den Finger steckt, schlagen läßt.
Darauf machte Käthe Licht, und Rudi stellte die Apparate ab.
„Sie haben gesehen, daß ich den ganzen Strom durch meinen Körper gehen
lassen konnte, ohne im mindesten Schaden zu nehmen. Man erklärt diese
Tatsache damit, daß die Wechselströme von so außerordentlich hoher
Wechselzahl überhaupt nicht in den leitenden Körper eindringen, sondern
sich nur über dessen Oberfläche verbreiten.
Interessant sind auch die Induktionserscheinungen dieser Wechselströme.
Sie werden sich von meinem vorletzten Vortrag her erinnern, was
man unter Impedanz versteht (Seite 189). Die Impedanz tritt bei
Teslaströmen so stark auf, daß der Strom eher einen großen Widerstand
zu überwinden, als durch einen fast widerstandslosen Draht zu fließen
vermag.
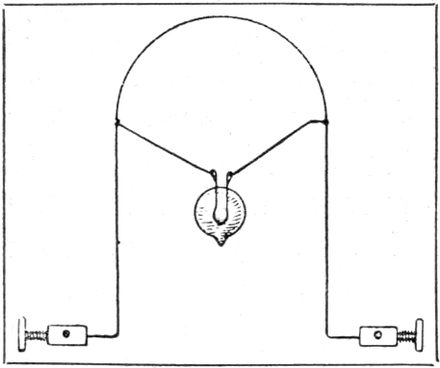
Abb. 215. Zu Versuchen über Induktionserscheinungen.
Ich habe hier (Abb. 215) einen Bogen aus dickem Kupferdraht; an den
beiden Enden des Bogens ist diese Glühlampe befestigt. Würde ich
die beiden Pole eines Akkumulators mit den Enden des Drahtes hier
verbinden, so ginge aller Strom durch den dicken[S. 267] Kupferdraht, und die
Lampe bliebe so gut wie stromlos. Leitet man dagegen einen Teslastrom
durch dieses System — Käthe führte den Versuch aus, indem sie die
Elektroden des Teslaapparates mit den mit Klemmen versehenen Enden des
Drahtbogens verband und dann die Apparate in Tätigkeit setzte — so
geht, wie Sie sehen, fast der ganze Strom durch den großen Widerstand
der Lampe, da in dem dicken Kupferdraht die Selbstinduktion so groß
ist, daß die Extraströme den ursprünglichen Strom fast aufheben
(vergleiche vierter Vortrag Seite 189).
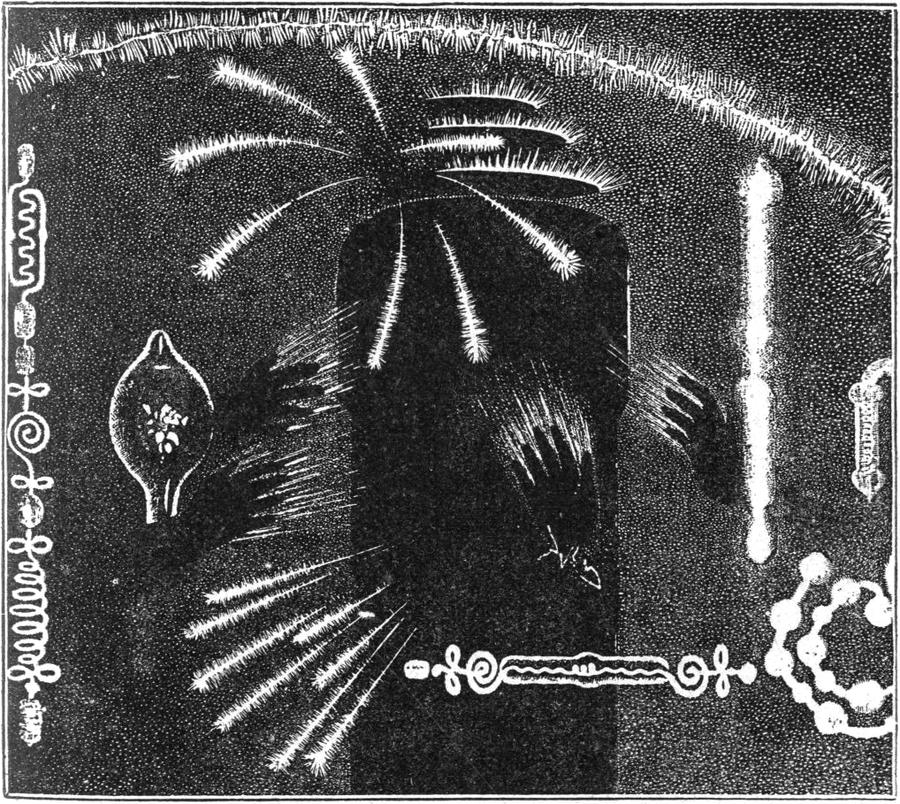
Abb. 216. Versuche am Teslaschen Transformator.
Der Raum zwischen zwei Leitern, die mit den Elektroden verbunden
sind, ist ganz durchsetzt mit elektrischen Wellen. Ich habe hier zwei
Blechscheiben, die auf isolierenden Füßen stehen. Sie werden mit den
Elektroden des Teslaapparates verbunden und etwa 50 bis 70 cm
voneinander entfernt aufgestellt.“
[S. 268]
Käthe stellte die Apparate auf und verfinsterte das Zimmer. Rudi
brachte in den Raum zwischen den Blechen verschiedene Geißlersche
Röhren, die, ohne die Bleche zu berühren, hell aufleuchteten. Ferner
brachte Rudi, während er den linken Blechschirm anfaßte, die rechte
Hand in die Mitte zwischen die beiden Bleche: Es sah aus, als wenn
die Hand eigenes Licht ausstrahlte Die Abb. 216 versucht annähernd,
derartige Erscheinungen wiederzugeben.
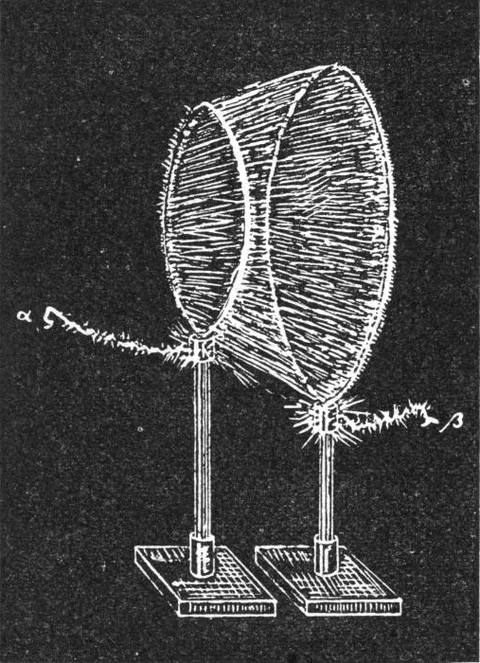
Abb. 217. Lichterscheinungen zwischen zwei mit dem
Teslatransformator verbundenen Drahtkreisen.
Der nächste Versuch bestand darin, daß Rudi zwei Drahtkreise von
verschiedenen Größen (10 und 15 cm Durchmesser), die wie die
Blechscheiben auf isolierenden Glasfüßchen standen, mit den Elektroden
des Teslatransformators verband. Die Aufstellung der Drahtkreise und
den Verlauf der Lichtstrahlen zeigt Abb. 217. Lebhafte Lichtbüschel
sprühten zwischen beiden Kreisen hin und her.
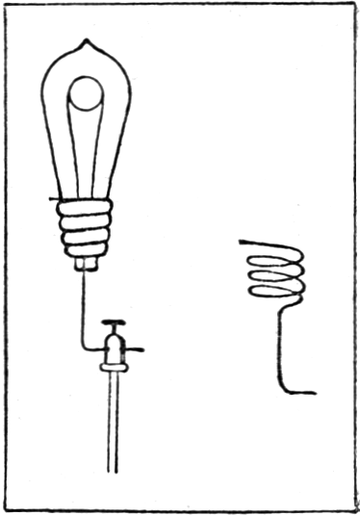
Abb. 218. Zum ersten Teslaschen Glühlampenversuch.
Für den folgenden Versuch hatte Rudi um die Gewindefassung
(Edisonfassung) einer gewöhnlichen, etwa 16kerzigen Glühlampe einen
1,5 mm starken, blanken Kupferdraht gewunden und dessen Ende in
einer der Transformatorklemmen befestigt, wie Abb. 218 zeigt. Als er
dann im Dunkeln die Apparate in Tätigkeit setzte, leuchtete der ganze
Hohlraum der Glühlampe in einem zarten, grünlichblauen Lichte. Der
Kohlenfaden sah wie mit feinen, leuchtenden Dornen besetzt aus. Näherte
man[S. 269] der Glasbirne den Finger, so schien dieser das Licht anzuziehen;
an der dem Finger gegenüberliegenden Stelle des Glases aber war unter
Umständen ein deutlicher hellgrüner Fleck zu sehen, der sich der
Bewegung des Fingers entsprechend hin und her bewegte.
Endlich wies Rudi noch auf die außerordentlich starke Induktionswirkung
der Wechselströme hoher Frequenz hin. Er hatte sich aus 1,5 mm
starkem isoliertem Draht eine einfache Schnecke von vier Windungen
gedreht. Der Durchmesser der Schnecke war nahezu gleich dem der
primären Wickelung seines Transformators (Seite 264). An die Enden des
Drahtes war eine Glühlampe angeschlossen, deren Voltzahl mit der der
zum Betriebe der Apparate nötigen Akkumulatoren übereinstimmte. Brachte
Rudi diesen einfachen Drahtkreis in die Nähe der primären Spule des
Transformators und parallel zu ihr — die sekundäre Spule hatte er
entfernt — so leuchtete die Glühlampe hell auf, aber nicht wie vorhin,
sondern der Faden glühte gerade so, als wenn die Lampe unmittelbar an
den Akkumulator angeschlossen wäre.
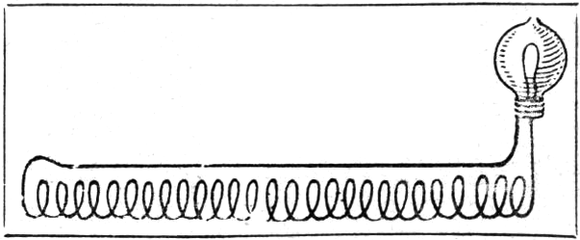
Abb. 219. Zum zweiten Teslaschen Lampenversuch.
Für Transformatoren mit spiraligen statt schneckenförmigen Spulen muß
für diesen Versuch natürlich die Glühlampe auch an einen spiralig
gewundenen Draht angeschlossen werden, wie Abb. 219 zeigt. Dabei
ist aber darauf zu achten, daß die Steighöhe der Spirale (das heißt
der Abstand zwischen den einzelnen Windungen) gleich der der
primären Wickelung des Transformators ist. Die Längsachsen der Spiralen
müssen einander parallel sein, wenn Induktionswirkungen auftreten
sollen.
Das war Rudis letzter Versuch. Mit einem Dank für das zahlreiche
Erscheinen seiner Zuhörer schloß er den Vortrag ab.
Während nun Rudis Mutter die verschiedenen Tanten noch mit einem
Tee erfrischte, mußte der jugendliche[S. 270] Dozent noch manche Frage
beantworten; aber gar häufig blieb ihm nichts anderes übrig als
zu sagen: „Das wissen wir nicht.“ Dann kam auch sein uns
schon bekannter kritischer Onkel zu ihm und machte ihn auf manches
Wissenswerte aufmerksam. Wir halten es darum für angebracht, des Onkels
Kritik der Hauptsache nach noch anzuführen:
Kritik.
„In der Einleitung des Vortrages hast du gesagt, einen Naturvorgang
erklären heiße ihn mit einem anderen vergleichen. Das ist ja im
allgemeinen ganz richtig. Du führtest aber da ein Beispiel an, in
welchem der Vergleich eben gerade nicht einer Erklärung
entspricht: Ich vergleiche den elektrischen Strom mit dem Wasserstrom
in einer Leitung nur, um mir ein Bild zu machen. So sagt man z. B.,
der elektrische Strom fließt vom positiven zum negativen Pol.
Mit diesem Ausdruck hantieren wir in dem ganzen Gebiet der praktischen
Elektrotechnik; aber eine Erklärung ist dieses Bild nicht.
Für wirkliche Erklärungen können die Vergleiche gelten, die wir
zwischen den Erscheinungen im Äther und den Wellenbewegungen der von
unseren Sinnen erkennbaren Materien wie Luft, Wasser, ausgespannte
Seile u. s. w. anstellen. Wenn mich also jemand fragte: ‚Was ist
Licht?‘ so würde ich sagen: Licht ist eine Wellenbewegung, durch
bestimmte Ursachen hervorgerufen in einem Medium, das wir mit unseren
Sinnen nicht unmittelbar erkennen können. Bei dieser Erklärung liegt in
dem Worte Wellenbewegung der Vergleich. —
Eine Definition des Äthers geben zu wollen, ist heute noch sehr gewagt;
theoretisch müssen wir den Äther als festen Körper auffassen; aber
abgesehen von dem rein äußerlichen Widerspruch dieser Annahme wird sie
von einer ganz anderen Seite mit großem Erfolg angegriffen. Ebenso
haben auch die neuesten Forschungen auf dem Gebiet der Ätherphysik
die von dir zitierte Anschauung, daß alle Naturerscheinungen auf die
mechanischen Grundtatsachen zurückzuführen seien, vollkommen
überwunden; nicht mehr mechanisch, sondern elektromagnetisch
erklärt man heute alle Physik, auch die Mechanik.
Der Drehspiegelversuch ist ja scheinbar sehr schön gelungen,[S. 271] aber
nur scheinbar; dieser Versuch läßt sich mit so einfachen Mitteln gar
nicht ausführen, da die Schwingungen viel zu schnell sind, als daß
sie von einem so verhältnismäßig langsam rotierenden Spiegel zerlegt
werden könnten. Was man bei deinem Experiment sah, waren nicht die
Perioden der Oszillation, sondern wahrscheinlich die des Unterbrechers
am Funkeninduktor. Immerhin war das Experiment anschaulich und hat das
Wesen derartiger Untersuchungen gut wiedergegeben.
Ferner halte ich die Reihenfolge der einzelnen Experimente bei zwei
Gruppen von Versuchen für ungeschickt gewählt. Erstens hätte ich bei
dem Drehspiegelversuch das kontinuierliche Lichtband der Kerzenflamme
vor den unterbrochenen Funkenbildern gezeigt. Ebenso wäre es
bei der Resonanz besser gewesen, zuerst den Pendelversuch, dann die
akustische und zuletzt die elektrische Resonanz zu zeigen, da es zum
Verständnis immer besser ist, das Einfachere, das am leichtesten
Begreifliche zuerst zu bringen.
So hätte ich auch vor den Ausführungen über Ätherwellen ein
sinnenfälliges Beispiel gebracht. Du hättest z. B. ein Seil mit einem
Ende irgendwo befestigen können; das andere Ende hättest du dann in
die Hand genommen und das mäßig gespannte Seil geschlingert, so daß
es die Bewegung regelrechter Wellen deutlich zeigte. Außerdem hätte
ich den sehr wesentlichen Unterschied zwischen Schall- und Ätherwellen
hervorgehoben. Die Schallwellen sind sogenannte Longitudinalwellen,
das heißt Wellen, die dadurch entstehen, daß sich die einzelnen — in
diesem Falle Luft- — Teilchen in der Fortpflanzungsrichtung
hin und her bewegen. Die Ätherwellen dagegen sind Transversalwellen,
bei denen sich die einzelnen Teilchen senkrecht zur
Fortpflanzungsrichtung bewegen.
Eine richtige Longitudinalwelle kann man oft bei in Reih’ und Glied
aufgestellten Soldaten sehen. Wenn die einzelnen Leute mit zu großen
Abständen stehen, so daß man also überall noch hindurchsehen kann, und
der rechte Flügelmann macht, einem Befehl gehorchend, einen großen
Schritt nach links und dann, erkennend, daß der Schritt zu groß war,
einen kleinen wieder nach rechts, so kann[S. 272] man folgendes Bild sehen:
Bei dem ersten Schritt hat der Flügelmann seinen Nachbar angestoßen;
dieser stößt, ebenfalls nach links tretend, den dritten Mann, der
wieder den vierten u. s. f. Im ersten Augenblick kann man also zwischen
den ersten drei oder vier Mann nicht mehr hindurchsehen, was
zur Folge hat, daß diese Stelle des Gliedes gewissermaßen dunkler
erscheint. Nun geht aber der erste Mann, der zweite u. s. f. wieder
etwas zurück, dadurch werden die Abstände wieder etwas größer, die
Stelle im Glied, die eben uns dunkel erschien, sieht jetzt wieder
heller aus, dafür sieht die nächste Gruppe von drei oder vier Mann
wieder dunkel aus und wird dann wieder hell, und so geht das fort.
Es hat das Aussehen, als ob ein dunkler Fleck sich ziemlich rasch
vom rechten zum linken Flügelmann fortbewegte. Steht nun der linke
Flügelmann recht fest und weicht dem Anstoß nicht, so wandert der
dunkle Fleck wieder zurück. Man hat dabei nicht nur das Bild
einer Longitudinalwelle, sondern tatsächlich eine solche Welle selbst.
Die Vorstellung einer Ätherwelle ist schon viel schwieriger. Das vorhin
erwähnte Seil gibt nur ein unzulängliches Bild einer Ätherwelle, obwohl
beide, sowohl die Seil- wie die Ätherwelle Transversalwellen sind.
Jedoch zur Demonstration reicht das völlig aus.
Man hat ja Apparate konstruiert, welche Bilder der verschiedenen
Wellengattungen geben. Du hättest dir ganz einfach einen
Longitudinalwellenapparat konstruieren können. Den macht man so: Man
stellt sich aus Holzleisten einen 20 cm hohen rechteckigen Rahmen
her, der senkrecht stehend auf einem Grundbrett befestigt wird. Die
eine der senkrechten Seiten sei aus dickem Holz und gut im Grundbrett
befestigt, die andere eine dünne, elastische Leiste. Die Länge ergibt
sich von selbst. An der oberen Querleiste des Rahmens werden an 10 bis
15 cm langen Fäden 20 bis 50 gleich große und gleich schwere
schwarze Holz- oder Steinkugeln so aufgehängt, daß zwischen je zwei
eine 3 bis 5 mm große Strecke frei bleibt. Die erste und die
letzte Kugel soll gerade an der betreffenden senkrechten Seite des
Rahmens anliegen. Hinter den schwarzen Kugeln stellt man einen weißen
Karton auf.
[S. 273]
Um nun eine Longitudinalwelle hervorzurufen, schlägt man mit einem
kleinen Hammer leicht außen an die Stelle der dünnen Seitenleiste,
an der innen die erste Kugel anliegt. Die Erscheinung ist dann genau
dieselbe, wie ich sie vorhin bei den Soldaten beschrieben habe. —
Jetzt noch eines. Bei den Teslaversuchen haben die Entladungsfunken
nicht nur durch ihren Lärm, sondern auch durch ihr sehr blendendes
Licht gestört. Du hättest das Funkenmikrometer in ein Kästchen aus
Hartgummi- oder Vulkanfiberplatten einschließen sollen. Man könnte auch
über die Zinkstücke runde Korkscheibchen schieben und darüber eine
hinreichend weite Glasröhre stecken.“
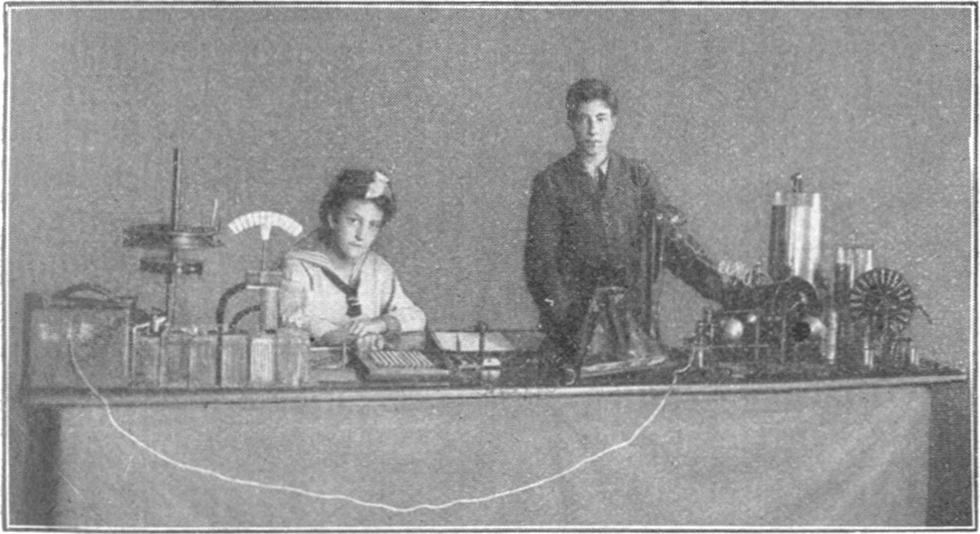
Abb. 220. Rudi an seinem Experimentiertisch.
Die Apparate sind von links nach rechts gesehen:
Akkumulatorenbatterie, Teslatransformator, Vertikalgalvanoskop, Rheostat,
Funkenmikrometer, Lichtschutz für den Fluoreszenzschirm, Röntgenröhre,
Righischer Radiator, Funkeninduktor, Influenzmaschine, Leidener Flasche.
Das war der letzte Vortrag, den Rudi aus dem Gebiet der Elektrophysik
hielt. Er hatte sich noch eine ganze Anzahl von Apparaten hergestellt,
die für jeden jungen Elektrotechniker Interesse haben, und die darum
noch einzeln beschrieben werden sollen.
Wie man sich
eine Telephonanlage herstellen kann.
Da Stahlmagnete, wie sie für Telephone gebraucht werden, nicht im
Handel zu bekommen sind, auch ziemlich teuer wären und wir sie kaum mit
genügender Sorgfalt selbst herstellen könnten, so verwenden wir statt
dessen Elektromagnete. Wir können dann auch den immerhin umständlich
herzustellenden Transformator ganz weglassen, das heißt, ihn durch eine
ganz besondere Anordnung ersetzen.
Für eine Fernsprechanlage sind natürlich zwei vollkommen gleiche
Stationen nötig. Im folgenden werden alle Angaben nur für eine Station
gemacht, man hat sich also alles angegebene Material doppelt zu
beschaffen.
Das Mikrophon.
Aus Zigarrenkistenholz sägen wir uns zwei Ringe; ihr innerer
Durchmesser sei 7, ihr äußerer 9 cm. Zwischen sie wird mit gutem
Tischlerleim ein in Wasser aufgeweichtes Pergamentpapier geklebt;
dabei sollen die Fasern des Holzes der beiden Ringe einander senkrecht
kreuzen. Außerdem müssen die Ringe mit einer nicht zu geringen Anzahl
von Drahtstiftchen zusammengenagelt werden.
Die Kohlenkontakte stellen wir uns aus Reststücken von
Bogenlampenkohlen oder aus Elementkohlen her. Letztere dürfen
aber noch nicht viel in der Elementfüllung gestanden haben. Wir
brauchen zwei rechteckige Stücke; Form und Größe geben wir ihnen
durch Sägen und durch Schleifen auf einem rauhen Stein. Jedes Stück
ist 40 : 15 : 10 mm groß. Außerdem brauchen wir vier kleine
Walzen mit kegelförmig zugespitzten Enden; diese sind 20 mm
lang, 7 mm dick. In die rechteckigen Stücke werden mit einem[S. 275]
Versenker (Krauskopf) vier trichterförmige Vertiefungen gebohrt. Abb.
221 zeigt in a und b diese Kohlenteile. Darauf werden,
wie aus Abb. 222 hervorgeht, die beiden Kohlenstücke, die mit ihren
Vertiefungen die vier Rollen zwischen sich aufgenommen haben, so auf
die Pergamentmembrane m aufgeleimt, daß die kleinen Walzen nicht
herausfallen können, aber doch völlig freien Spielraum haben, sich
nirgends klemmen, und nur ganz lose aufliegen.
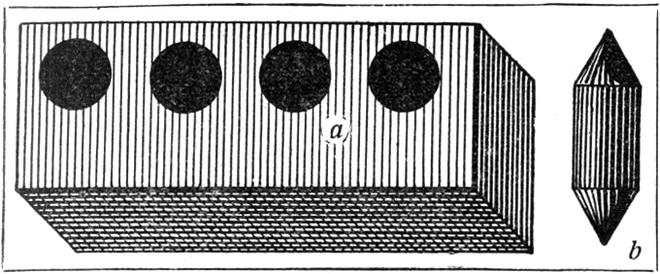
Abb. 221. Kohlen zum Mikrophon.
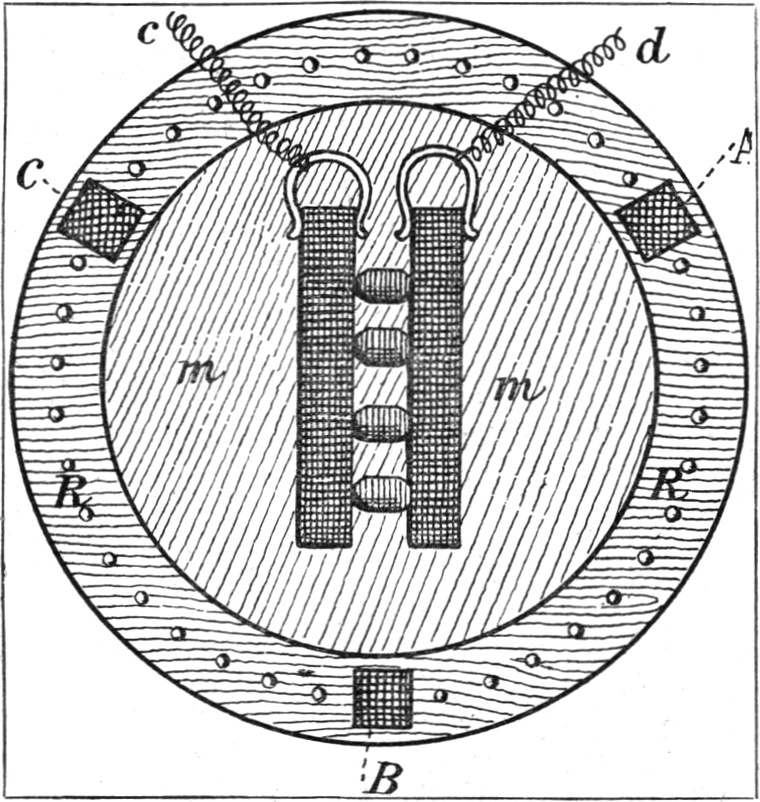
Abb. 222. Mikrophon.
Aus starkem Messingdraht biegen wir zwei hufeisenförmige Klammern,
löten an jeder einen Kupferdraht (c, d) fest, den wir
zur Spirale drehen. Die Klammern werden so über die Kohlen geschoben
(Abb. 222), daß diese mit Federkraft fest umschließen. Endlich wird
der Holzring R noch mit drei je 2 cm hohen Holzstollen
A, B, C versehen.
Das Telephon.
Weniger einfach gestaltet sich die Herstellung des Hörapparates, des
Telephones. Den Kern für den Elektromagnet biegt man[S. 276] sich (in
kaltem Zustande) aus gewöhnlichem Bandeisen in Hufeisenform. Aus Abb.
223 gehen alle Maße deutlich hervor. Die Enden des Hufeisens feilt
man auf eine Ausdehnung von 18 mm zu Zylindern von 7 mm
Durchmesser (Abb. 224).
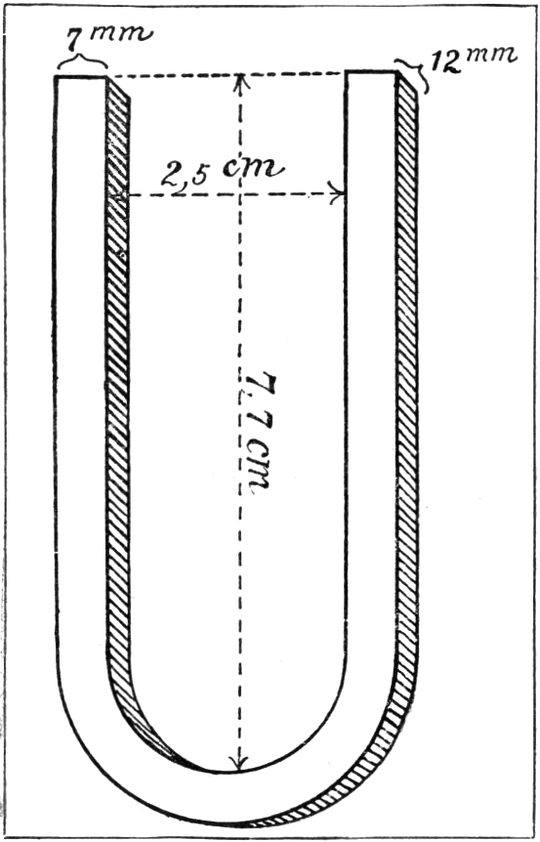
Abb. 223. Hufeisenmagnet für das Telephon.
Die Rähmchen für die Drahtspulen fertigen wir aus dünnem (Messing-,
Kupfer- oder) Zinkblech. Sie sollen genau über die Schenkel
des Magnetkernes passen und 4 cm hoch sein. Ihre Form geht
hinreichend deutlich aus Abb. 225 hervor. Die Spulen werden mit einer
dicken Schellacklösung (Seite 5) überstrichen und nach dem Trocknen
bewickelt.
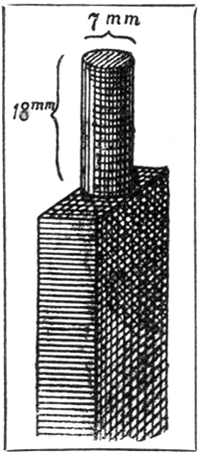
Abb. 224. Zylinderende des Magneten.
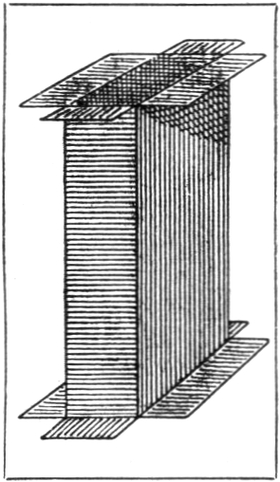
Abb. 225. Spule.
Für jede Spule brauchen wir 6 bis 7 m mit Baumwolle
isolierten, 0,7 mm starken Kupferdraht. Die Bewicklung ist
sorgfältig auszuführen; jede Lage ist von der nächsten durch ein
in Schellacklösung getränktes Papier zu trennen. Wir stellen vier
oder fünf Lagen zu je 35 bis 40 Windungen her. Die fertigen Spulen
werden über die Schenkel des Magnetkernes geschoben und die zwei
entsprechenden Drahtenden (siehe Seite 103 u. 133) miteinander
verlötet.
Wir kommen jetzt zur Herstellung der sekundären[S. 277] Spulen, die auf das
18 mm lange zylindrische Ende der Magnetschenkel geschoben
werden sollen. (Über Anfertigung von Drahtspulen vergleiche Seite
91, 165, 174 u. f.) Zur Anfertigung einer solchen Spule verfahren
wir folgendermaßen. Wir umwinden eines der runden Schenkelenden mit
einer regelmäßigen Lage von Nähfaden. Darüber wickeln wir in 3 bis 4
Lagen dünnes Paraffinpapier in einem 16 mm breiten Streifen.
Darauf wird diese Paraffinhülle über einer Flamme etwas erwärmt, so
daß sich das Paraffin zwischen den einzelnen Lagen vereinigt. Ist das
durch die Erwärmung weich gewordene Papier wieder erstarrt, so ziehen
wir den Faden zwischen Papier und Kern heraus und nehmen das kleine
Papierröllchen ab. Es bildet die Grundlage für die Drahtspule. Bevor
wir jedoch mit dem Bewickeln beginnen, umwickeln wir, wie vorhin das
Polende, ein 7 mm dickes, rundes Holzstäbchen mit Faden und
schieben die kleine Papierhülle darauf, so daß sie fest sitzt.
Zur Bewicklung nehmen wir 0,15 bis 0,2 mm starken, mit
Seide isolierten Kupferdraht. Wir können eine Lage zu 60
Windungen rechnen, 20 bis 30 Lagen sind erforderlich; für eine Windung
brauchen wir im Durchschnitt 3,8 cm Draht, somit brauchen wir
für jede Spule (25 Lagen angenommen) 25 · 60 · 38 mm gleich 57
m von 0,2 mm starkem Draht. Sollen die beiden Stationen
sehr weit auseinanderliegen (über 1 bis 2 km), so empfiehlt
es sich, 0,15 bis 0,1 mm starken Draht zu gebrauchen und
entsprechend mehr Windungen (bis 50 Lagen zu je 60 Windungen) zu nehmen.
Das Bewickeln führen wir am besten mit der Hand aus (Spulapparat Seite
165 ist hierfür nicht zu empfehlen). Wir nehmen das Holzstäbchen mit
dem Papierröllchen in die linke Hand, nachdem wir den Drahtanfang nahe
dem Röllchen am Holzstäbchen befestigt haben. Dann drehen wir das
Stäbchen zwischen Daumen und Zeigefinger der Linken und lassen den
Draht durch die Rechte gleiten, mit dessen Daumen und Zeigefinger wir
ihn lenken. Es muß Lage sorgfältig neben Lage gelegt werden. Sind wir
nahe dem Ende des Papierröllchens angelangt, so ist die[S. 278] erste Lage
beendet; sie wird mit heißem Paraffin bestrichen und mit einem dünnen
Paraffinpapierplättchen umgeben. Schellack eignet sich hier deshalb
nicht als Isoliermaterial, weil er zu langsam trocknet und die Finger
in unangenehmer Weise klebrig macht. Darauf wird die zweite Lage gelegt
u. s. w., bis die gewünschte Anzahl vorhanden ist.
Spulenrähmchen mit Randscheiben zu verwenden, ist nicht vorteilhaft, da
sie viel schwieriger zu bewickeln sind. Bei dem angegebenen Verfahren
ist nur darauf zu achten, daß jede Lage genau so viel Windungen
hat wie die vorhergehende; um das zu erreichen, brauchen die Lagen
nicht gezählt zu werden, denn man sieht durch das durchscheinende
Paraffinpapier, das beiderseits etwa 1 mm überstehen soll,
hindurch und erkennt leicht, wenn die eine Lage gerade so weit
gewickelt ist als die vorhergehende.
Die fertigen Spulen werden schließlich noch 2 bis 3mal mit einer dicken
Schellacklösung überstrichen. — Man achte darauf, daß die freien
Drahtenden nicht abbrechen. Ist der letzte Schellacküberzug getrocknet,
so werden die Spulen auf die Zylinderfortsätze der Elektromagnete
geschoben, und die entsprechenden Drahtenden in derselben Weise wie die
der primären Spulen miteinander verlötet.
Abb. 226 zeigt die Anordnung der weiteren Teile des Telephons. Die
primären Spulen (B, a und b), — die in der
Abbildung übrigens versehentlich anstatt oval mit kreisrundem Schnitt
gezeichnet sind, wie auch die Löcher in a und b oval
sein müssen — klemmen wir zwischen zwei Brettchen c und
c₁, die wir mittels der Holzschrauben x, y
und z zusammenziehen. Auf diese Brettchen leimen wir eine aus
Zigarrenkistenholz gesägte runde Scheibe (C, I), die zwei
ovale Öffnungen (a und b) hat, um die beiden Primärspulen
des Magneten durchzulassen. Bei A sehen wir die primären Spulen
a und b, das vordere Brettchen c, die Köpfe der
drei Schrauben x, y und z (in der Ansicht) und die
Scheibe I (im Schnitt) an dem Elektromagnet befestigt.
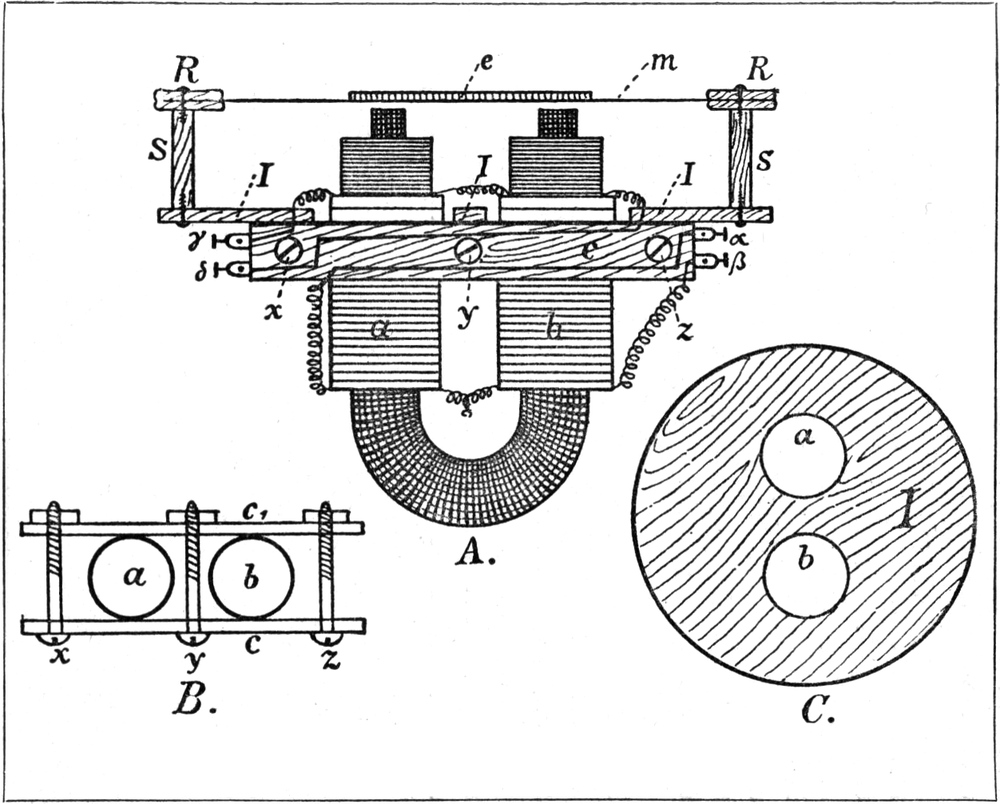
Abb. 226. Die einzelnen Teile zum Telephon.
Am Rande der Scheibe I errichten wir vier oder sechs nicht zu
schwache Holzsäulen S, die in gleichmäßigen Abständen[S. 279] von unten
her festzuschrauben sind. Diese Säulen müssen einen Rahmen R
tragen, der genau so hergestellt wird, wie der Rahmen R des
Mikrophons (Abb. 222). Sein äußerer Durchmesser sei gleich dem der
Scheibe I, sein innerer mindestens 7 cm. Genau in die
Mitte der Pergamentmembrane m, auf die von den Magnetpolen
abgewendete Seite, ist ein dünnes kreisrundes Blechscheibchen
e aufzukleben, dessen Durchmesser 4 bis 4,5 cm, also
etwas mehr betragen soll, als der Abstand der äußeren[S. 280] Ränder der
Polenden des Elektromagneten. Die Blechscheibe schneide man aus
möglichst dünnem Weißblech mit einer gewöhnlichen Schere aus und
achte dabei darauf, daß die Scheibe völlig eben und frei von Beulen
bleibe. Das Aufleimen geschieht mit gewöhnlichem Tischlerleim oder
Schellack.
Darauf wird ein hinreichend langer Streifen Pergamentpapier, der so
breit ist, als die Säulen S hoch sind, etwas angefeuchtet,
mit einem Ende an einer der Säulen angeklebt, dann mehrmals außen
um die übrigen Säulen herumgewunden, und schließlich wird sein Ende
wieder angeklebt. Es entsteht dadurch zwischen den Säulen ein völlig
geschlossener Raum, in welchem die Magnetpole mit den sekundären Spulen
eingeschlossen sind.
An den Brettchen c und c₁ bringen wir noch vier kleine
Klemmschrauben α, β, γ und δ an. In der Abb. 226 sind die Klemmen β und
δ so gezeichnet, als säßen sie auch an c, während sie an dem
verdeckten c₁ zu befestigen sind. Die Drahtenden der primären
Spule werden an α und β, die der sekundären an γ und δ angelötet. Wo es
sich irgend ermöglichen läßt, sollen Drahtverbindungen immer angelötet
werden.
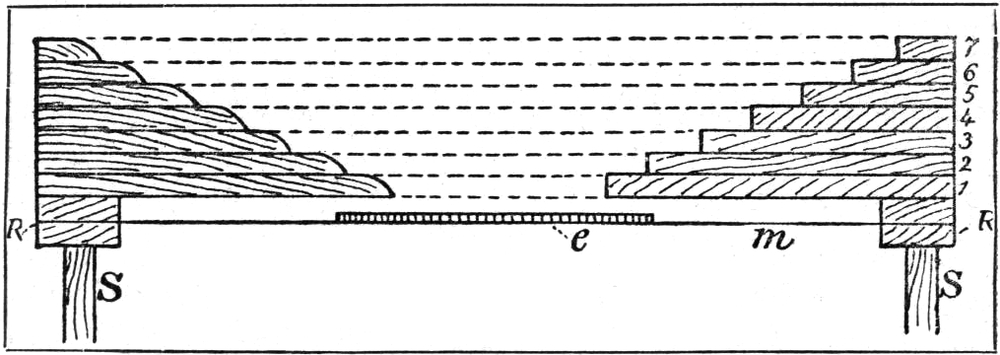
Abb. 227. Schnitt durch den Schallbecher.
Wir müssen jetzt noch über der Membrane einen Schallbecher anbringen.
Wer eine Drehbank besitzt, dreht sich den Schallbecher aus einem Stück
Holz. Wir können ihn aber auch ohne Drehbank sehr einfach auf folgende
Weise herstellen. Wir sägen aus dünnem Zigarrenkistenholz oder
aus starkem Pappendeckel sieben runde Scheiben (1 bis 7 in Abb. 227)
von der Größe der in Abb. 226 c dargestellten und versehen[S. 281]
jede mit einer einzigen zentralen Öffnung; die in Nr. 1 soll 1,5 bis
2 cm Durchmesser haben, die von Nr. 2 etwas mehr u. s. w. bis
bei Nr. 7 der Durchmesser 6 bis 7 cm groß ist. Diese sieben
Brettchen — wenn wir dickere Brettchen verwenden, genügen auch fünf
— werden, wie aus Abb. 9 zu erkennen ist, aufeinandergeleimt; dann
feilen wir die Kanten der treppenartigen Innenseite (in Abb. 227
rechts) etwas rund (in Abb. 227 links) und leimen den
Schalltrichter auf den Ring R auf.
Die Entfernung der Membrane von den Magnetpolen soll 0,5 bis 1
mm betragen; jedenfalls darf sie nicht zu nahe stehen, so daß
sie durch die Anziehung des Elektromagneten auf das Blechplättchen
mit den Magnetpolen in Berührung kommt. Man kann den Abstand leicht
regulieren, indem man die Schrauben x, y, z (in
Abb. 226) etwas lockert, die Membrane mit dem ganzen Gehäuse in die
richtige Lage bringt und danach die drei Schrauben wieder fest anzieht.
Die für jede Station nötige Anrufklingel können wir uns ebenfalls
selbst herstellen, nach der auf Seite 113 gegebenen Beschreibung.
Ferner brauchen wir für jede Station 3 bis 4 gute Salmiakelemente
(siehe Seite 58 u. f.).
Die Schaltvorrichtung.
Das Mikrophon und den Umschalter, vielleicht auch die Glocke, montieren
wir auf einem mit Rückleisten versehenen starken Brette von passender
Größe. Oben in der Mitte wird das Mikrophon M befestigt, die
Kohlenkontakte nach dem Brette zugekehrt (Abb. 228). Bei P
ist der Drehpunkt eines Hebels a, der von einer hinreichend
starken Spiralfeder F nach oben gezogen wird. Der Hebel
wird aus einer dünnen Eisenstange oder einem hinreichend starken,
nötigenfalls doppelten Blechstreifen hergestellt. An seinem Ende ist
er so gebogen, daß das Telephon T eingehängt werden kann, von
dessen Gewicht er nach unten gezogen wird. Dieser Hebel wird mit einem
mit Schellacklösung getränkten Leinenstreifen umwickelt. Darauf wird an
drei Stellen (1, 2, 3) je ein Streifen aus Messing- oder Kupferblech um
den bewickelten Hebel herumgewunden. Die drei Streifen müssen völlig
voneinander isoliert unverrückbar festsitzen, was man[S. 282] durch Anwendung
von etwas Schellackkitt (Seite 5) am sichersten erreicht.
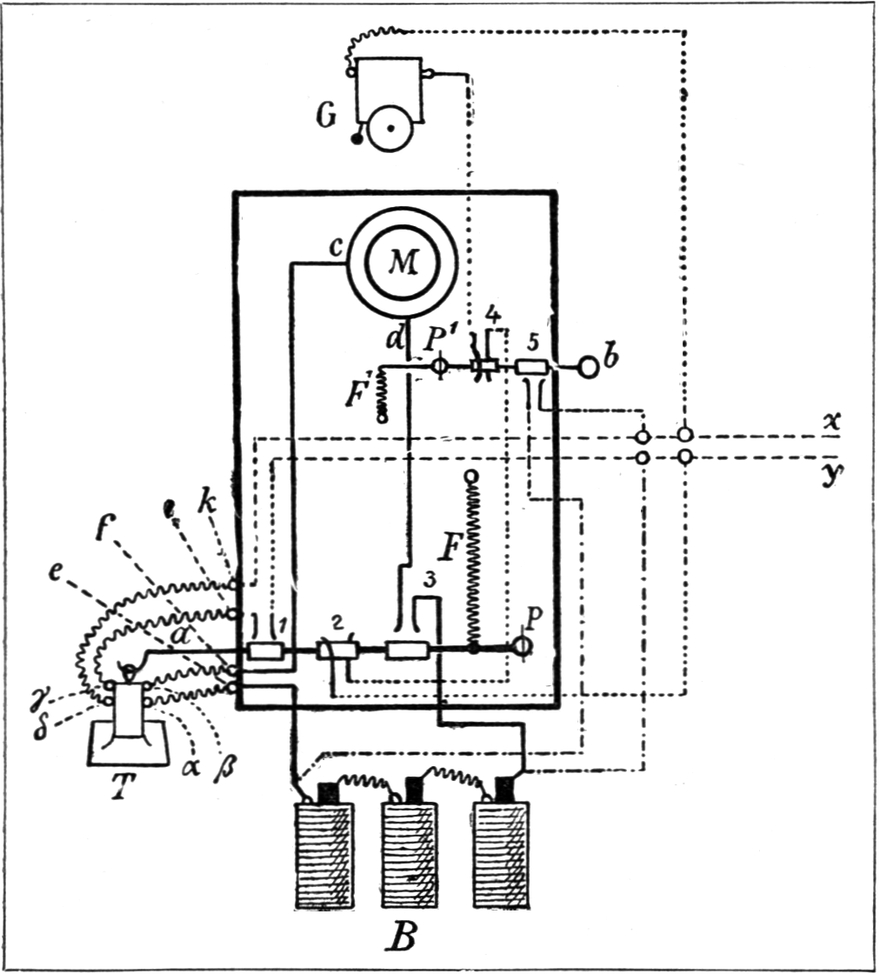
Abb. 228. Schaltungsschema der Telephonanlage.
Jetzt schrauben wir unter dem mittleren (2) Blechring zwei
Messingblechstreifen parallel nebeneinander so auf dem Grundbrett
fest, daß sie federnd von hinten gegen den Ring 2 des niedergezogenen
Hebels drücken und dadurch zwischen ihnen eine metallische Verbindung
hergestellt wird. Zwei andere Paare von Messingblechstreifen stehen in
ähnlicher Beziehung zu den Blechstücken 1 und 3, mit dem Unterschied,
daß sie sich nicht unter, sondern über ihm befinden, der Kontakt also
nur dann hergestellt wird, wenn[S. 283] durch das Aushängen des Telephons der
Hebel von der Feder in die Höhe gezogen wird, in welcher Lage dann die
beiden Messingstreifen bei 2 wieder voneinander isoliert sind.
Ein zweiter Arm b ist als zweiarmiger Hebel um die Achse
P¹ drehbar und wird durch eine Feder F¹ links nach
unten, also rechts nach oben gezogen. Er ist gerade wie der Hebelarm
a mit einem in Schellack getränkten Leinenstreifen zu umwickeln
und trägt zwei Blechstücke (4 und 5), die genau wie bei a zu
befestigen sind. Über 4 und unter 5 sind ebenfalls zwei
Blechstreifen angebracht.
Es ist nun noch zu besprechen, wie die einzelnen Teile miteinander
zu verbinden sind. In der Abb. 228 sind die einzelnen Drähte weit
auseinandergerückt gezeichnet, um das Schema übersichtlicher zu
gestalten. In Wirklichkeit bohren wir bei den Stücken, an welche die
Verbindungsdrähte angeschlossen werden sollen, Löcher durch das Brett
und führen den Draht auf der Rückseite den kürzesten Weg zur nächsten
Verbindungsstelle. Die Verbindungen sind mit isolierten, etwa 1
mm starken Kupferdrähten herzustellen.
Der erste Stromkreis ist in der Abbildung durch einen ausgezogenen
Strich dargestellt: er beginnt bei dem Zinkpol der Batterie B
und führt zur Klemmschraube e; von da führt eine weiche,
etwa 1 m lange Leitungsschnur zu der Klemme α der primären
Telephonwickelung, von dessen Klemme β wiederum eine Leitungsschnur zu
der Klemme f; sie ist mit dem Drahtende c des Mikrophons
verbunden, dessen Drahtende d mit dem einen Metallstreifen bei 3
in leitender Verbindung steht. Der andere Blechstreifen bei 3 ist mit
dem positiven Pole der Batterie verbunden.
Der Strom des zweiten Kreises nimmt folgenden Weg: er kommt durch
die Fernleitung x zu Klemme k, geht von da durch eine
Leitungsschnur zu δ, durch die sekundären Spulen zu γ, von γ durch eine
Leitungsschnur zur Klemme i, von da zu dem einen Blechstreifen
bei 1 und von dem anderen Blechstreifen zur Fernleitung y.
Dieser Weg ist in der Figur einfach gestrichelt.
Der dritte Stromkreis (punktiert) geht von der Fernleitung[S. 284] x
durch die Glocke G, den Kontakt 4, dann durch den Kontakt 2 zur
Fernleitung y.
Der vierte Stromkreis (strich-punktiert) nimmt vom negativen Pole der
Batterie seinen Weg durch den Kontakt 5 zur Fernleitung x und
kommt durch y zum positiven Pole der Batterie zurück.
Hiermit ist die Ausrüstung einer Station beendet; wenn zwei solcher
Stationen vorhanden sind, so braucht man sie nur noch durch eine
doppelte Fernleitung miteinander zu verbinden, also die beiden x
miteinander und ebenso die beiden y.
Ist die Fernleitung sehr lang, so wird es unter Umständen nötig, für
die Klingel ein Relais einzuschalten. Über die Herstellung eines
Relais und dessen Schaltung siehe Seite 121.
Will man nun von Station I mit Station II sprechen, so drückt man
kurze Zeit den Hebel b herab, um zunächst anzurufen. Dadurch
wird folgender Stromkreis geschlossen: von dem positiven Pole der
Batterie B nach y, von da durch die Fernleitung nach dem
y der Station II, daselbst zum Kontakte 2, dann zum Kontakte 4,
zur Glocke G, nach x, durch die Fernleitung zurück zum
x der Station I, zum Kontakte 5 (der hier durch das Herabdrücken
des Hebels b geschlossen ist) und zurück zur Batterie. Demnach
wird an der Station II die Klingel ertönen. Nun werden an beiden
Stationen die Telephone abgehängt und die Hebel a gehen in die
Höhe; dadurch ist an jeder Station folgender Stromkreis geschlossen:
von dem positiven Pole der Batterie B durch den Kontakt 3 nach
d am Mikrophone, durch dessen Kohlenkontakt 1 nach c,
von hier über f nach β am Telephon, durch dessen primäre Spule
nach d und e, endlich zurück zur Batterie. Durch den so
fließenden Strom wird der Elektromagnet des Telephons erregt. Wird
nun gegen das Mikrophon gesprochen, so wird die Membrane durch die
aufschlagenden Luftwellen erschüttert und mit ihr die Kohlenstücke.
Durch die Bewegung der letzteren schwankt aber der Widerstand des
Kohlenkontaktes, damit auch die Stärke des den Magnet umfließenden
Stromes. Neben den hier dargelegten Lokalstromkreisen[S. 285] ist aber auch
noch ein Fernstromkreis geschlossen, der beide Stationen verbindet;
dieser verläuft von x an der Station I nach k, dann nach
δ am Telephon, durch dessen sekundäre Spule nach γ, über i durch
den Kontakt 1 nach y durch die Fernleitung zum y der
Station II, daselbst durch den Kontakt 1 über i nach γ, durch
die sekundäre Spule des Telephons nach δ, über k nach x
und durch die Fernleitung zurück zum x der Station I. In Abb.
229 ist die Hauptsache dieser Darlegungen in einem Schema übersichtlich
zusammengefaßt: rechts ein Lokalstrom, der die Batterie B, das
Mikrophon M und die primäre Spule des Telephons T in sich
schließt, links ein ebensolcher mit B₁, M₁ und
T₁; zwischen beiden Stationen ist die Fernleitung, die rechts
und links durch die sekundären Spulen von T und T₁
geschlossen ist.
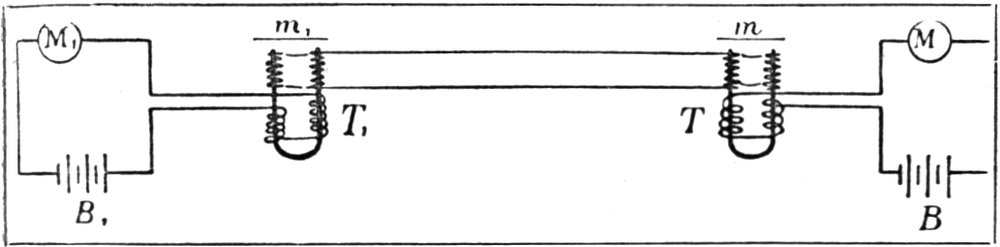
Abb. 229. Wirkungsschema der Telephonanlage.
Es wurde schon erwähnt, daß durch Sprechen gegen die Membran des
Mikrophons der Station I die Magnetkraft in dem dortigen Telephon
zum Schwanken komme; dieses Schwanken ruft in den sekundären Spulen
Induktionsströme hervor (vergleiche Seite 137), die durch die
Fernleitung fließen und an der Station II in den sekundären Spulen des
dortigen Telephons die Magnetpole umkreisen, deren Magnetkraft dadurch
ebenfalls ins Schwanken gebracht wird. Dieses Schwanken erfolgt genau
in dem Rhythmus der das Mikrophon treffenden Schallwellen, weshalb die
mit dem Blechscheibchen beklebte Pergamentmembran die gleichen Töne
wiedergibt, die gegen das Mikrophon gesprochen werden (vergleiche auch
Seite 200 bis 204).
[S. 286]
Wie man sich Rheostate
herstellen kann.
R
R
heostate oder Regulierwiderstände sind beim Arbeiten mit
stärkeren Strömen fast unentbehrlich. Es sei darum im folgenden die
Herstellung von Rheostaten beschrieben.
Gewöhnlich verwendet man für Regulierwiderstände schlechtleitende
Metalllegierungen wie Nickelin oder Konstantan. Diese sind jedoch
ziemlich teuer, und es wird deshalb manchem jungen Physiker erwünscht
sein, zu erfahren, wie man sich Widerstände aus billigerem Material
herstellen kann.
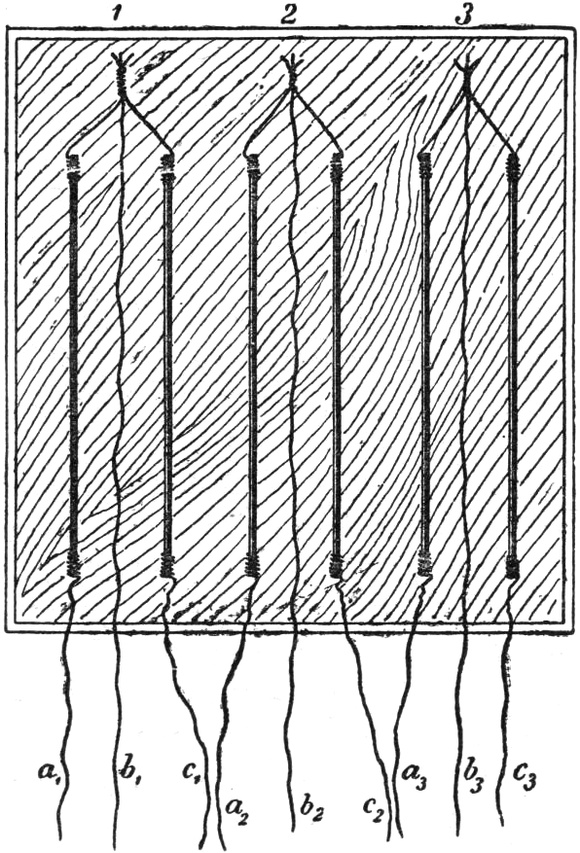
Abb. 230. Graphitstäbe des Rheostaten mit ihren
Drahtansätzen.
Wir verwenden den ziemlich schlecht leitenden Graphit, den wir in Form
von Stäben der geringsten Sorte von Bleistiften entnehmen. Auf die Güte
des Graphits und des Holzes zu Zeichenzwecken kommt es nicht an, es ist
nur darauf zu sehen, daß die Graphitsäulen nicht schon von vornherein
in der Holzfassung gebrochen sind. Das Holz entfernt man, indem man es
abbrennt.
Wir brauchen für unseren Rheostat sechs Graphitstäbe; jeder einzelne
Stab wird an beiden Enden mit dünnem, blankem Kupferdraht fest
umwickelt, und die einzelnen Windungen dieser Umwicklung werden
verlötet. Diese Drahtansätze sollen an den oberen Enden 5 cm,
an den unteren 10 cm lang sein. Die kurzen Drähte von je zwei
Stäben drehen wir mit einem weiteren Drahte, der[S. 287] um 15 cm
länger als ein Graphitstab ist, zusammen und erhalten so drei
Stabpaare, deren jedes unten drei Drahtenden (a, b,
c in Abb. 230) aufweist. Diese drei Stabpaare werden auf einem
quadratischen Brett von etwa 25 cm Seitenlänge in Gips oder
Zement eingebettet. Man streicht auf das Brett eine 1 bis 1,5 cm
hohe Gipsschicht; der Gips soll nicht zu dünnflüssig, aber doch gut
plastisch sein. Nachdem man die auf den Brei gelegten Graphitstäbe
mit einem ebenen Brette gleichmäßig eingedrückt hat, schlägt man an
acht bis zehn Stellen je einen Nagel mit breitem Kopf so weit in das
Brett ein, daß er noch etwa 5 mm weit über die Gipsschicht
herausragt, welche daraus reichlich mit Wasser übergossen und dann mit
einer zweiten Gipsschicht von etwa 1 cm Dicke überdeckt wird.
Oberfläche und Ränder des Gipsblockes werden nun noch glatt gestrichen
und das Ganze läßt man dann in horizontaler Lage trocknen.
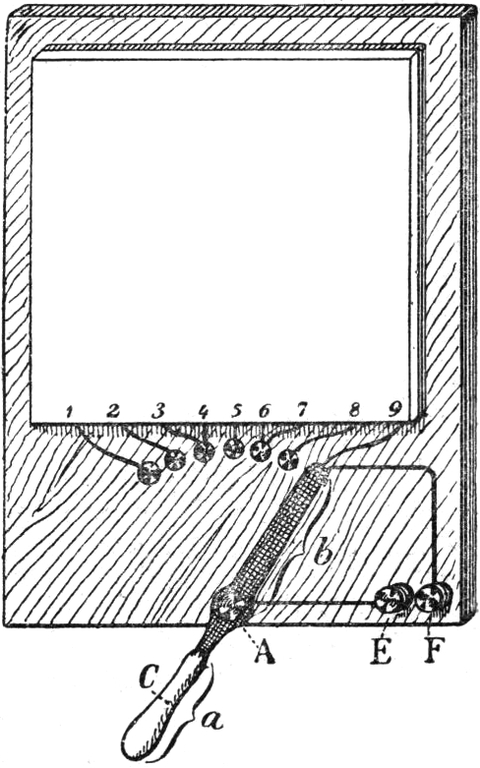
Abb. 231 Der fertige Graphitrheostat.
Darnach wird, wie aus Abb. 231 hervorgeht, das Brett mit dem Gipsblock
auf ein zweites größeres Brett aufgeschraubt, auf welchem auch der
Schalthebel und die Klemmen angebracht werden.
Man schlägt um den Punkt A einen Kreisbogen mit dem Radius
b und markiert sich darauf sieben Punkte, mit gegenseitigen
Abständen von etwa 2 cm. In jedem dieser Punkte wird ein
Ziernagel mit flachgewölbtem Messingkopf eingeschlagen, jedoch vorerst
so, daß die Köpfe das Brett nicht berühren. Um die sieben Ziernägel
werden die neun Drahtenden in folgender Weise herumgewickelt: Draht
1 um Nagel 1, Draht 2 um Nagel 2, Draht 3 und 4 um Nagel 3, Draht 5
um Nagel 4, Draht 6 und 7[S. 288] um Nagel 5, Draht 8 um Nagel 6, Draht 9
um Nagel 7, um welch letzteren man außerdem einen nachher zur Klemme
F zu führenden, dicken Kupferdraht schlingt. Darauf werden die
Ziernägel vollständig eingeschlagen und die Drähte außerdem noch mit
den Nagelköpfen verlötet.
Der Kontakthebel C wird aus einem Streifen starken Kupfer-
oder Messingblechs hergestellt, das bei A eine Bohrung erhält
und dessen eines Ende mit einem Holzgriff a versehen wird. Die
Befestigung des Kontakthebels geschieht in folgender Weise (Abb. 232).
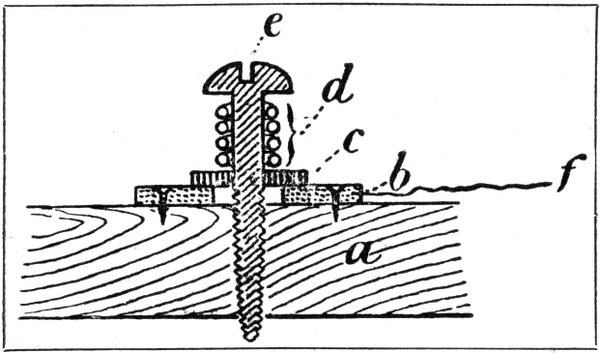
Abb. 232. Befestigung des Kontakthebels.
Eine kreisrunde Scheibe b aus dickem Kupfer- oder Messingblech
wird in der Mitte mit einem Loche versehen und dann mittels zweier
Schrauben mit versenkten Köpfen auf dem Holze a befestigt;
darauf legen wir den Kontakthebel c so auf die Scheibe b,
daß seine Durchbohrung auf deren Mitte liegt, bedecken diese Bohrung
mit einer kleinen Spiralfeder d und stecken durch diese, durch
den Hebel und durch die Scheibe die Schraube e, die in a
eingeschraubt wird. An der Scheibe b wird ein Kupferdraht
f angelötet, der zu der Klemme E (Abb. 231) führt.
Steht der Kontakthebel so wie in Abb. 231, so ist kein Widerstand
eingeschaltet. Wird er aber nach links gedreht, so muß der Strom seinen
Weg zuerst durch einen, dann durch zwei und schließlich durch
alle sechs Graphitstäbe nehmen.
Die Graphitstäbe könnte man auch freistehend oder liegend befestigen;
da sie jedoch sehr zerbrechlich sind, so ist das angegebene Verfahren
vorzuziehen. Auch ist dann, wenn die Stäbe durch starke Ströme glühend
werden, eine Gefahr ausgeschlossen.
Haben die Graphitstäbe einen Querschnitt von 3 qmm, so ertragen
sie eine Stromstärke von 20 bis 25 Ampere.[S. 289] Soll ein solcher Rheostat
auch größeren Stromstärken standhalten, so müssen dickere Graphitstäbe
gebraucht oder jeweils zwei nebeneinander geschaltet werden.
Will man die Stromstärken feiner regulieren können, als es das
jeweilige Ein- oder Ausschalten eines ganzen Graphitstabes erlaubt,
so macht man das Grundbrett des oben beschriebenen Rheostaten etwas
größer und bringt noch einen zweiten Drehhebel an, der auch über eine
bogenförmige Reihe von Nagelköpfen schleift. Diese Nagelköpfe sind,
wie aus Abb. 233 hervorgeht, alle mit einem einzigen, ebenfalls in
den Gipsblock einzubettenden Graphitstab verbunden. Die Drähte, mit
deren Zahl die Feinheit der Regulierbarkeit wächst, sind in gleichen
Abständen voneinander um den Graphitstab herumzuwinden.
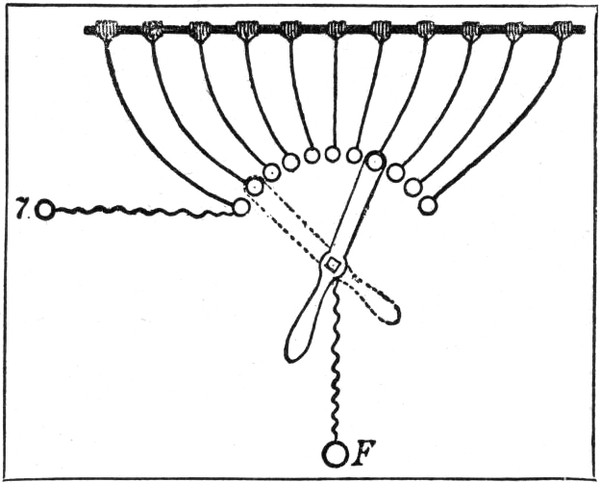
Abb. 233. Widerstand für feine Regulierung.
Um schlechte Kontaktstellen zu vermeiden — an solchen könnten bei
starken Strömen schädliche Lichtbogen auftreten — stelle man die
Verbindung der Drähte mit dem Graphitstab folgendermaßen her. Man
windet einen mit Glaspapier gereinigten etwa 0,6 mm starken,
weichen Kupferdraht an der betreffenden Stelle in fünf
regelmäßigen Windungen fest um den Graphitstab herum und dreht
dann den Anfang und das Ende dieses Drahtstückchens fest zusammen.
Auf diese Umwickelung wird dann ein starker (1 bis 1,5 mm)
Kupferdraht aufgelötet, der zu den Kontaktköpfen führt.
Dieser Sonderrheostat wird zwischen dem siebten Kontaktkopf und der
Klemme F eingeschaltet.
Da der eben beschriebene Apparat wohl allen Anforderungen des jungen
Lesers genügt, so will ich mit der Beschreibung anderer Konstruktionen
keine Zeit verlieren; sie seien nur der Vollkommenheit wegen kurz
erwähnt:
[S. 290]
Der Rheostat mit Nickelin oder Konstantandrähten ist im Prinzip genau
so konstruiert wie der Graphitrheostat. Die Drähte werden aber nicht
in Gips eingelegt, sondern zu Spiralen gedreht, die in Holzrahmen
ausgespannt werden. Abb. 234 zeigt eine derartige Einrichtung.
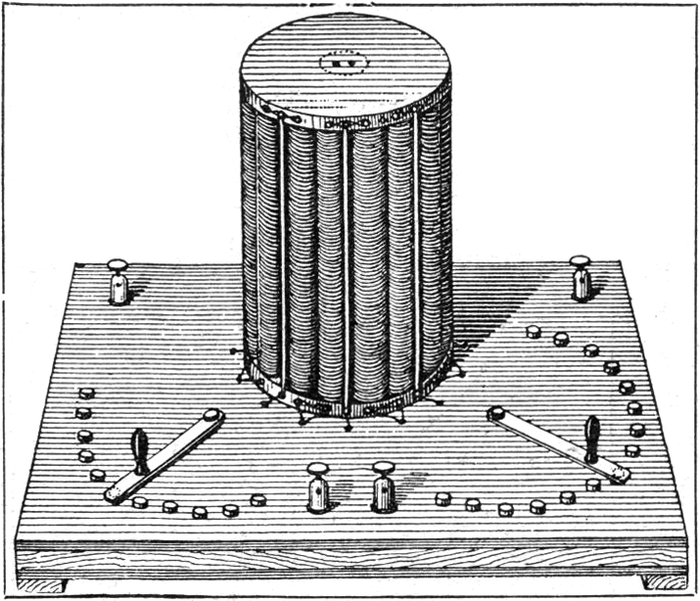
Abb. 234. Nickelinrheostat.
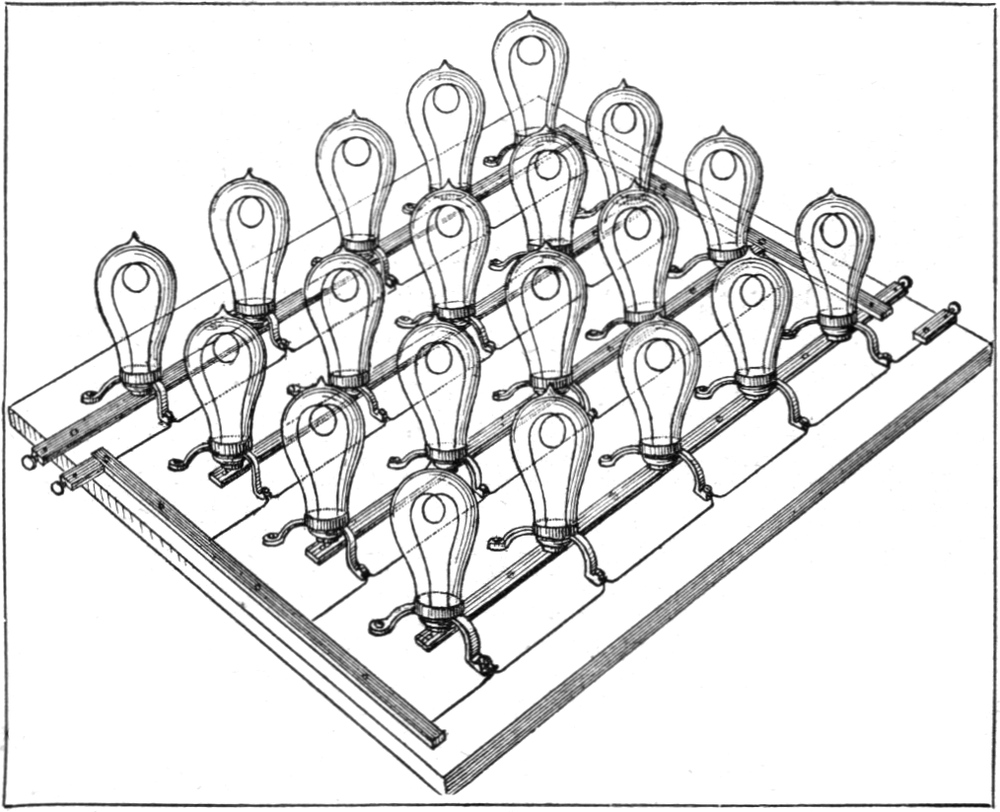
Abb. 235. Glühlampenrheostat.
Abb. 235 zeigt einen Glühlampenrheostat. Je mehr Glühlampen
nebeneinander in einen Stromkreis eingeschaltet werden, desto
geringer wird der Widerstand. Mit der[S. 291] Zahl der hintereinander
eingeschalteten Lampen wächst der Widerstand. Bei dem in Abb. 235
gezeichneten Apparat können 1 bis 20 Lampen nebeneinander in einen
Stromkreis eingeschaltet werden.
Es ist vorteilhaft, wenn die Widerstände, mit denen man arbeitet,
geeicht sind. Über das Messen von Widerständen siehe
Seite 109.
Der Taschenakkumulator.
D
Die Selbstherstellung eines Akkumulators wurde schon auf
Seite 72 bis 80 ausführlich beschrieben. Abgesehen davon, daß ein Akkumulator, den
man in der Tasche tragen können soll, viel kleiner, leichter und enger
gebaut sein muß, ist ein vollkommen dichter Abschluß des Gefäßes von
größter Wichtigkeit.
Die Außenmaße für den Behälter sollen betragen: 10 cm in der
Breite, 13 cm in der Höhe und 1,7 cm in der Dicke. Der
Akkumulator soll aus drei Zellen bestehen, also 6 Volt liefern; jede
Zelle enthalte 3 Platten, die parallel der Breitseite oder 5 Platten,
die parallel der Schmalseite eingebaut werden. Die Platten werden aus
1 mm dickem Bleiblech genau so hergestellt, wie schon auf Seite
73 u. 74 beschrieben wurde. Zwischen den beiden äußersten (negativen)
Platten einer Zelle und der Gefäßwand braucht kein Zwischenraum zu
bleiben.
Es handelt sich also nur noch um das Material, aus dem wir das Gefäß,
und um die Masse, aus der wir den Verschluß herstellen.
Für das Gefäß ist Zelluloid bei weitem das geeignetste, freilich auch
das teuerste Material. Wir beschaffen uns Platten in passender Größe
von etwa 1 mm Dicke. Dabei ist nicht zu vergessen, daß das
flache Gefäß drei Abteilungen, also zwei querteilende Zwischenwände
haben muß.
Die Zelluloidplatten bestellen wir uns am besten schon in passender
Größe, andernfalls schneiden wir sie mit einer guten Schere zurecht,
was sich aber nur dann gut bewerkstelligen läßt, wenn das Zelluloid
nicht spröde ist. In diesem Falle wird es mit der Messerspitze
angeschnitten, so zwischen zwei scharfkantige Brettchen gelegt, daß der
Schnitt[S. 292] mit den Kanten der Brettchen zusammenfällt, und dann gebrochen.
Zum Zusammenkitten der einzelnen Teile verwenden wir eine Lösung
von Zelluloid in Essigäther. Haben wir nicht genügend
Abfallstückchen, die wir zum Auflösen verwenden können, so befreien
wir einen alten oder schlechten Rollfilm von den Gelatineschichten
— die nichtrollenden Films sind auf beiden Seiten mit einer
Gelatineschicht versehen — durch Abwaschen mit heißem Wasser,
schneiden ihn dann in kleine Stückchen und legen diese in Essigäther.
Die Lösung soll dickflüssig sein. Die zu verbindenden Teile
werden beide mittelst eines Pinsels mit dieser Lösung bestrichen und
dann rasch zusammengesetzt. Nach völligem Trocknen wird noch etwas
von der Zelluloidlösung in die Kanten, die von den Wandungen gebildet
werden, eingegossen. Daraufhin lasse man das Gefäß einen Tag trocknen.
Einfacher und billiger, aber weniger dauerhaft ist ein Behälter aus
Pappe. Diesen kleben wir aus den Teilen zusammen, die wir aus hartem,
nicht zu dünnem Pappendeckel schneiden. Zum Kleben verwendet man
möglichst wenig Syndedikon (Fischleim). Nach dem Trocknen des Leimes
wird der Behälter in Kolophonium-Wachskitt (Seite 66 u. 80) mit viel
Leinöl etwa 30 Minuten lang gekocht. Darauf nimmt man ihn heraus und
läßt alles überschüssige Kolophonium abfließen. Die Außenseite wird
mit dünnem weißem Fließpapier belegt, welches ohne weiteres sofort
festklebt, wenn man es mit dem Handballen ein wenig ausstreicht. Nach
völligem Erkalten des Behälters werden seine drei Fächer mit
reinem Kolophonium (das heißt solchem ohne Leinöl), das
man bis zur Dünnflüssigkeit erhitzt hat, bis etwa 1 cm vom
oberen Rande angefüllt; man achte darauf, daß nichts auf die äußere
Papierbekleidung fließt. Diese Füllung darf nur einige Sekunden in dem
Behälter bleiben, dann ist sie rasch auszugießen. Dadurch werden die
Innenwände mit einem Überzug versehen, der nach dem Erkalten nicht mehr
klebrig ist. Dem zuletzt erwähnten Kolophoniumguß kann man etwas (1⁄10)
Asphalt zusetzen. Schließlich wird der äußere Papierbelag noch mit
Eisenlack angestrichen.
Die präparierten Bleiplatten werden, wie schon auf[S. 293] Seite 76 erwähnt
wurde, eingesetzt; sie sollen auch auf Glasröhrchen, nicht unmittelbar
auf dem Boden des Gefäßes stehen. Der obere Plattenrand soll 2,5
cm unterhalb des oberen Gefäßrandes zu liegen kommen. Die
Fortsätze der Platten sollen schmal sein und müssen kurz vor der
Herstellung des Verschlusses mit Schmirgelpapier sorgfältig gereinigt
werden.
Die Platten werden eingesetzt und die Zellen bis 2 cm vom oberen
Rande mit Wasser gefüllt. Statt der Glasröhrchen, die bei dem oben
beschriebenen Akkumulator zum Entweichen der Gase dienen, werden in
derselben Weise kleine, etwa 4 cm lange Gummischlauchstückchen
eingesetzt, in jede Zelle zwei. Der Abschluß wird durch fünf
verschiedene, je 4 mm dicke Güsse hergestellt.
Der erste Guß wird sorgfältig auf das Wasser aufgegossen und besteht
aus Kolophonium, dem man bis zu ⅓ Asphalt zusetzen kann. Nach dem
Erkalten werden die noch herausragenden Bleistreifen und die Wände des
Behälters mit Filtrierpapier sorgfältig getrocknet.
Der zweite Guß besteht aus Kolophonium-Wachskitt (Leinöl ziemlich
reichlich), der möglichst heiß eingegossen werden muß. Ein guter
Kontakt dieses Gusses mit den Wänden und mit dem Blei ist besonders
wichtig. Man führt ihn am sichersten herbei, wenn man an den
Berührungsstellen von Wand und Blei mit dem Kitt letzteren mit einem
dicken, weißglühenden Nagel noch einmal in Fluß bringt.
Der dritte Guß kann genau wie der zweite hergestellt werden. Weit
sicherer ist jedoch folgendes Verfahren: Wir beschaffen uns eine kleine
Blechbüchse mit Deckel, deren Boden- und Seitennaht nicht gelötet,
sondern durch Falz hergestellt ist. In den Deckel wird ein kleines
Loch geschlagen. Die Büchse umwickeln wir mit einem starken Draht, den
wir zu einem langen Stiel biegen. In diese Büchse geben wir kleine
Stückchen von einem alten Gummischlauch und halten sie über einen
Bunsenbrenner. Der Gummi schmilzt, und ein sehr übelriechender, grauer
Dampf strömt aus dem Loch des Deckels hervor. Der Dampf ist brennbar;
wir zünden ihn an, und vermindern dadurch den peinlichen Geruch[S. 294] dieses
Verfahrens ganz wesentlich. Ist der Gummi völlig geschmolzen, dann
geben wir eine mittelgroße Tube voll Gummilösung — wie man solche
zum Pneumatikflicken gebraucht — zu und vermischen diese tüchtig
mit dem geschmolzenen Gummi; darauf wird die Masse noch einmal unter
ständigem Umrühren kurz erhitzt; dann wird die Flamme gelöscht — in
einem Raum, in dem mit Benzin umgegangen wird, darf niemals eine offene
Flamme brennen — und so viel Benzin zugerührt, bis die Mischung ihre
Zähigkeit etwas verliert. Jetzt wird sie aufgegossen; dabei helfen
wir mit einem Holzstäbchen nach, damit sie sich überall gleichmäßig
verteilt. Man achte darauf, daß dieser erst nach vielen Monaten völlig
trocknende Gummibrei nur an die Stellen gelangt, für die er bestimmt
ist, da man ihn dort, wo er einmal klebt, nur sehr schwer entfernen
kann.
Der vierte Guß darf erst nach zwei bis drei Tagen auf den dritten
aufgegossen werden; er besteht aus Kolophonium, dem man nur wenig
Leinöl zugefügt hat.
Darauf kommt der fünfte Guß, der aus der käuflichen sogenannten
Akkumulatorenvergußmasse oder aus Paraffin hergestellt wird.
Die Bleistreifen werden in der richtigen Reihenfolge untereinander
verlötet (siehe Seite 77) und am negativen Pol der ersten und am
positiven der dritten werden Klemmschrauben angebracht.
Das Wasser läßt man jetzt durch die Schläuche abfließen. Mit Hilfe
eines Glastrichters, dessen Rohr zu einer hinreichend feinen Spitze
ausgezogen ist, um in die engen Gummischläuche eingesteckt werden zu
können, wird die Schwefelsäure eingegossen; sie soll den oberen Rand
der Platten gerade noch bedecken, so daß zwischen ihr und dem Verguß
ein 3 bis 4 mm breiter Raum frei bleibt. In die oberen Enden der
Gummischläuche werden zum Verschluß runde Holzstäbchen (Streichhölzer)
eingesteckt.
Herstellung eines
Universal-Volt-Ampere-Meters.
D
Das im folgenden beschriebene Instrument ist ein sogenannter
Dynamometer (Seite 207). Es ist deshalb sowohl für Wechsel- wie für
Gleichstrom zu verwenden;[S. 295] zufolge seiner Konstruktion kann es,
was Spannungen und Stromstärken betrifft, in sehr weiten Grenzen
gebraucht werden. Ferner kann es bei sauberer Arbeit zu einem richtigen
Präzisionsinstrument gemacht werden.
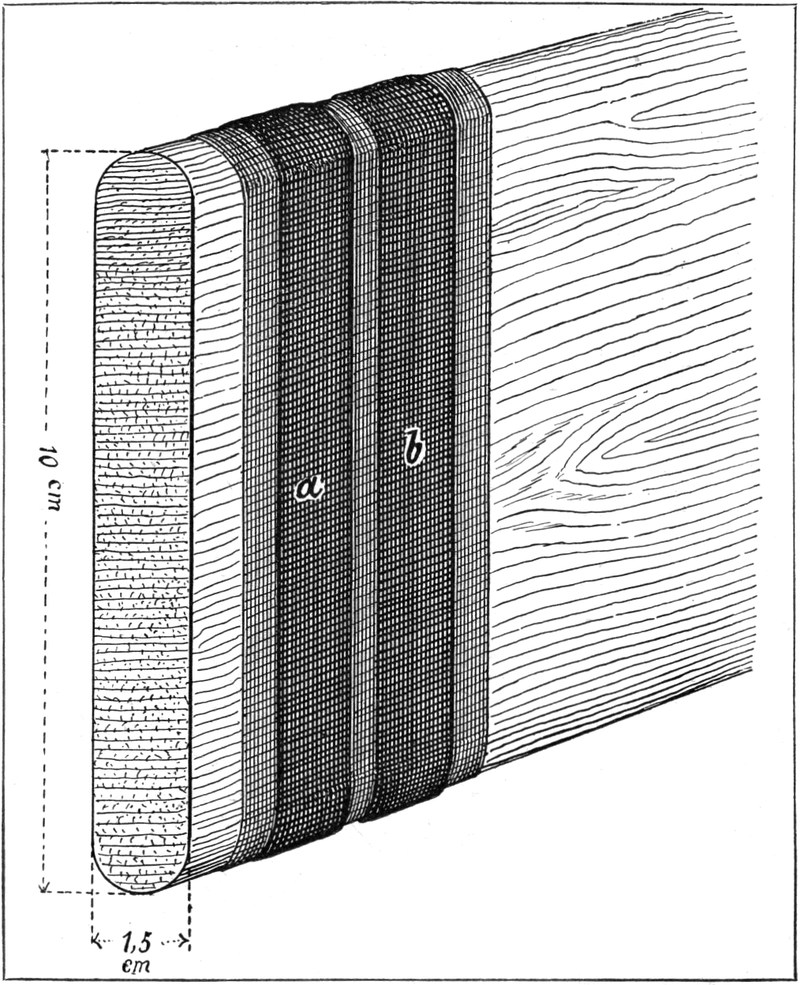
Abb. 236. Brett zum Wickeln der Spule.
Die Arbeit beginnt damit, daß man einem 1,5 cm dicken, 10
cm breiten und beliebig langen Brettchen durch Abrunden
der Kanten die Abb. 236 zu erkennende Form gibt. Dieses Brettchen
umwickelt man nahe dem einen Ende mit einem nicht zu starken Bindfaden
auf eine Strecke von[S. 296] etwa 7 cm, so daß Windung genau an
Windung liegt. Darüber spannt man einen Streifen Pergamentpapier,
dessen Enden man zusammenklebt, wobei man aber darauf achten muß,
daß er nicht an dem Bindfadenbelag kleben bleibt. Darüber wird ein
in einer dicken Schellacklösung getränktes Seidenpapier gelegt; ist
das etwas angetrocknet, so wickelt man einen isolierten 0,4 bis 0,5
mm starken Kupferdraht darauf[11], wiederum Windung genau an
Windung, bis man einen 2 cm breiten Belag erhalten hat. Darauf
läßt man, indem man den Draht auf einer Schmalseite des Holzes quer
herüberführt, einen 1,5 cm breiten Zwischenraum und legt einen
zweiten, ebenfalls 2 cm breiten Belag an (Abb. 236, a und
b). Die beiden Beläge werden mit Schellacklösung bestrichen und
mit Papier überzogen. Darauf wickelt man die zweite Lage; hat man von
links nach rechts zu wickeln begonnen, so wickelt man nun von rechts
nach links. Den Übergang von b nach a macht man auf der
dem ersten Übergang entgegengesetzten Seite; dann wird wieder mit
Schellack bestrichen, mit Papier belegt u. s. w., bis wir fünf oder
sieben Lagen gewickelt haben. Der Übergang von a zu b
wird oben, von b zu a immer unten gemacht. Die Drahtenden
sollen je 10 cm frei von der Spule abstehen.
Genau in derselben Weise werden fünf Lagen eines 1,0 mm, drei
Lagen eines 1,5 mm und eine Lage eines 2 mm starken,
isolierten Kupferdrahtes über die ersten Windungen gelegt.
Auf diese Weise sind zwei verbundene Drahtspulen entstanden; aus
jeder ragen vier 10 cm lange Drahtenden hervor. Die Windungen
müssen natürlich alle auf derselben Seite begonnen und in demselben
Drehungssinne ausgeführt sein.
Nun müssen die Spulen vom Holz abgenommen werden; da sie wahrscheinlich
sehr fest aufsitzen, muß man erst den Belag von Bindfaden unter der
Spule wegziehen. Um den Spulen mehr Halt zu geben, kann man jede quer
zur Längsrichtung der Drähte mit schmalem[S. 297] Isolierband umwickeln. Ein
dicker Schellacküberzug gibt auch hinreichend Halt.
Abb. 237 zeigt, wie das Spulenpaar a, b auf einem
Grundbrett c befestigt wird: es erhalten die beiden Brettchen
e₁ und e₂ je einen Ausschnitt, in den das untere
Ende der Spulen genau hineinpaßt. Die beiden Brettchen werden auf
c befestigt und auf ihrer Oberseite durch die Brettchen
i₁ und i₂ verbunden.
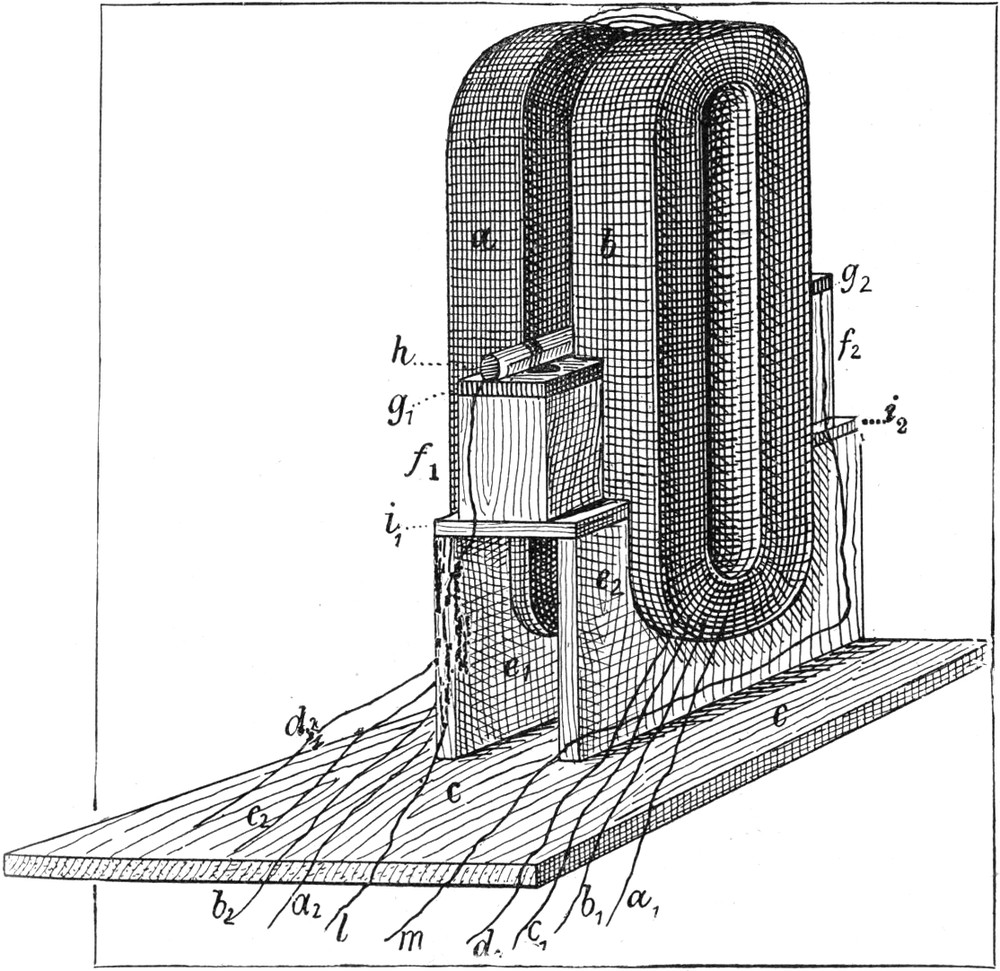
Abb. 237. Befestigung der Spulen auf dem Grundbrett.
Damit ist der erste Hauptteil des Apparates fertig. Der zweite, die
bewegliche innere Spule und ihre Lager, müssen mit besonderer Sorgfalt
hergestellt werden, da von der Genauigkeit der Ausführung dieser Teile
hauptsächlich die Zuverlässigkeit und Empfindlichkeit des Instrumentes
abhängt.
[S. 298]
Wir kaufen uns ein 10 cm langes, 3 mm starkes Stück
Rundstahl (Nickelstahl), das wir, falls es hart sein sollte, tüchtig
durchglühen. Dabei ist aber darauf zu achten, daß sich das Stück nicht
verbiegt. Ferner drehen wir uns aus einem sauberen, faser- und astlosen
Stück Hartholz oder besser aus Hartgummi das in Abb. 238 im Schnitt
mit Maßangaben und in Abb. 239 in der Außenansicht wiedergegebene
Fassungsstück; dieses besteht aus drei Teilen, die in Abb. 239 mit
a, b, c bezeichnet sind; es ist seiner ganzen
Länge nach durchbohrt; man achte darauf, daß die Längsbohrung genau
zentrisch sei. In den beiden mit b bezeichneten Teilen sind je
drei 2 bis 3 mm weite Löcher zu bohren, die in die Längsbohrung
einmünden und um 120° gegeneinander verschoben sein sollen; sie sind in
Abb. 238 durch zwei Paare punktierter Linien in b angedeutet; in
Abb. 239 sind natürlich nur je zwei dieser Löcher zu sehen. Der Teil
c wird längs einem seiner Durchmesser mit einer 2 mm
weiten Bohrung versehen. Ferner schneiden wir von einem starkwandigen
Messingrohr, das sich gerade noch über b schieben läßt, zwei
4 mm breite Ringe ab und versehen sie mit je drei Bohrungen,
die denen in b entsprechen, jedoch etwas enger als diese sein
sollen; sie werden außerdem mit Gewinden versehen, durch welche sich
Schrauben bis in die Längsbohrungen eindrehen lassen.
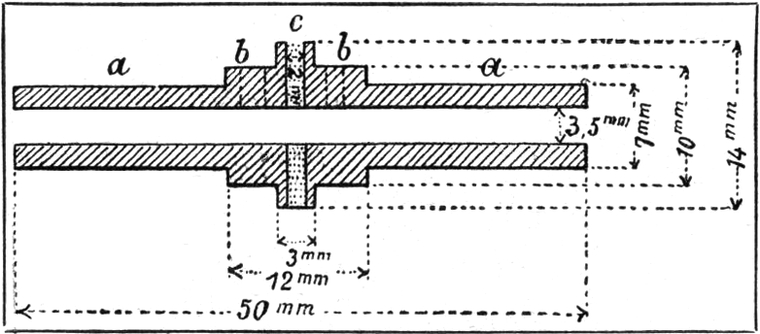
Abb. 238. Fassungsstück (Schnitt).
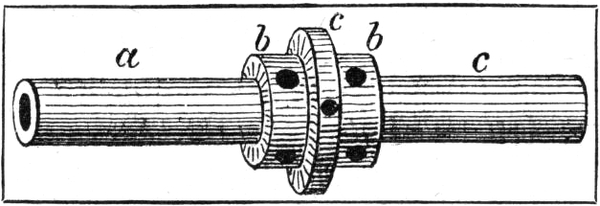
Abb. 239. Fassungsstück (Außenansicht).
Nun wird ein 10 cm langer, 2 mm starker Messing- oder
Kupferdraht (kein Eisen!) durch das Loch in c geschoben, so
daß nach beiden Seiten gleiche Teile hervorragen;[S. 299] der Draht muß fest
sitzen, was man nötigenfalls dadurch erreichen kann, daß man ihn in der
Mitte ein klein wenig verbiegt. Über die beiden dadurch entstandenen
Drahtschenkel wickelt man einen gut isolierten 0,4 bis 0,5 mm
starken Kupferdraht in regelmäßigen Windungen auf. Die Bewickelung
beginnt man bei einem Drahtschenkel da, wo er aus dem Mittelstück
c heraustritt; an dem Ende des Drahtes angelangt, wickelt
man wieder bis zur Anfangsstelle zurück, wo man den Draht mit einem
Bindfaden anbindet, um ein Aufschnurren der Spirale zu verhindern.
Darauf wird er um b herum zum anderen Drahtschenkel geführt, der
gerade so wie der erste bewickelt wird; dann wird wieder zum ersten,
dann noch einmal zum zweiten übergegangen. Es sind somit auf jeden
Schenkel vier Lagen aufzuwickeln. Das eine Drahtende ist auf dem einen,
das andere auf dem anderen Messingring anzulöten. Die beiden länglichen
Drahtspulen sind schließlich noch tüchtig mit Schellacklösung zu
bestreichen.
Jetzt schneiden wir das schon oben erwähnte Stahlstäbchen in der Mitte
auseinander und feilen jedem an einem Ende eine etwa 2 cm
lange Schneide an. Die Schneide ist zuerst mit einer gröberen, dann
mit einer feinen Schlichtfeile sehr sorgfältig herzustellen. Die
beiden die Schneide bildenden Flächen sollen einen Winkel von etwa
50° einschließen. Nun werden die beiden Stäbchen (h₁ und
h₂), wie aus Abb. 240 zu ersehen ist, beiderseits in die
Bohrung in a gesteckt; sie dürfen aber nicht miteinander in
leitende Berührung kommen, weshalb man sie am besten durch zwei
Kartonscheibchen von dem durch c laufenden Drahte trennt.
Die Bohrung in a ist etwas weiter (3,5 mm) als die
Lagerstäbchen dick sind (3 mm), weshalb diese nun etwas
Spielraum haben; die beiden Mündungen der Längsbohrung werden deshalb
durch eingeklebte Papierstreifen so weit verengt, daß die Stäbchen
h nur noch knapp hineingehen. Das innere Ende von h hat
dann wieder mehr Spielraum, wird aber durch die Schräubchen in b
fixiert; mittelst dieser werden die beiden Stäbchen so gestellt, daß
ihre Schneiden genau in einer Geraden liegen.
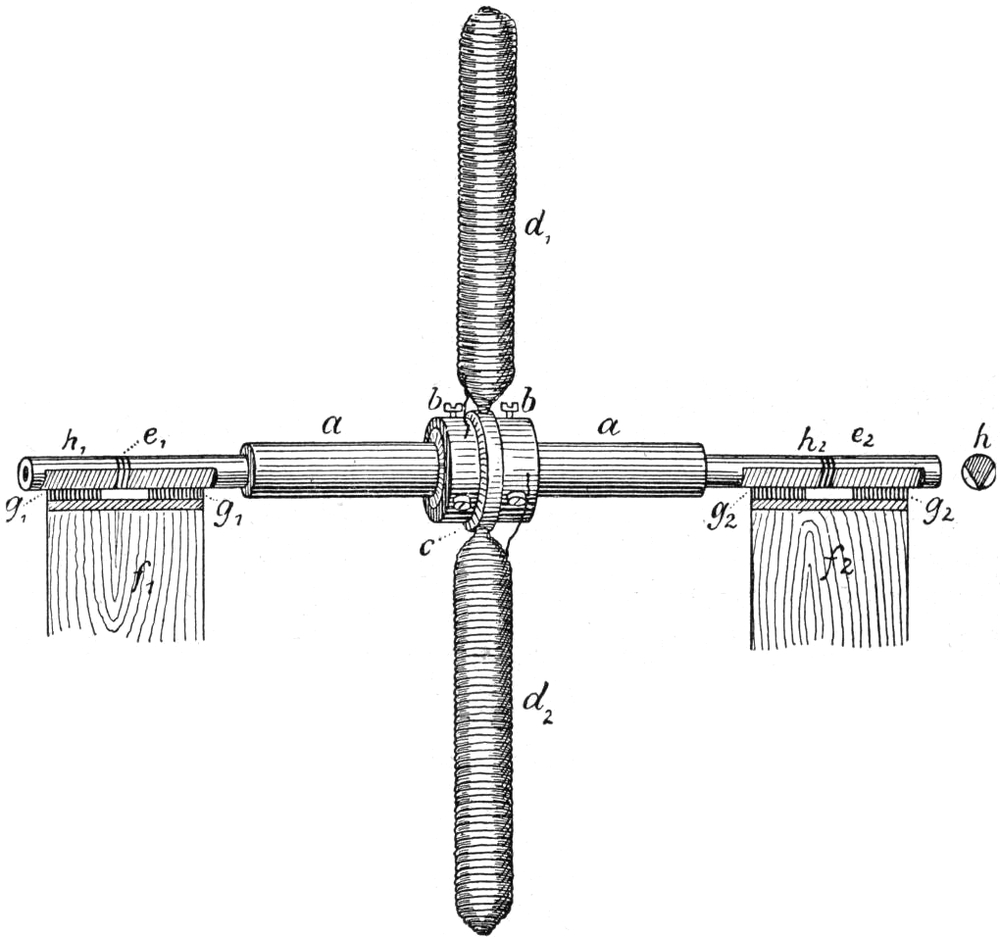
Abb. 240. Fertiger Anker (Ansicht).
Abb. 240 zeigt den fertigen Anker in der Ansicht; die[S. 300] Lager
f₁ und f₂ sind im Schnitt gezeichnet. Sie
bestehen je aus einem rechteckigen Eisenplättchen (g₁ und
g₂), das in der Mitte durchbohrt ist. Dies Eisenplättchen
wird auf einem ebenen Sandstein mit feinem Schmirgelpulver und Wasser
völlig eben geschliffen und schließlich mit dem Polierstahl (oder einem
Glasstab) poliert. Darauf spannen wir einen etwa 0,4 mm dicken
Federstahldraht in einen Laubsägebogen ein, der ihn straff spannt.
Das rechteckige Eisenplättchen befestigen wir mit ein paar seitlich
eingeschlagenen Nägeln auf einem starken Brett, legen den gespannten
Stahldraht parallel einer Seite quer über die Mitte des Plättchens und
geben auf den Draht, der sich aber dabei nicht verschieben darf, ein
paar kräftige Hammerschläge. Dadurch entsteht in g eine kleine
Rinne, in welche später die Schneide von h eingesetzt wird. Die
beiden Lagerplättchen und die Achsenstäbe werden nun auf helle Rotglut
erhitzt, in Öl abgeschreckt und schließlich dunkelbraun angelassen.
An jedes der Plättchen g wird ein einige Zentimeter langer
Kupferdraht angelötet. Diese Lager werden nun auf den Holzklötzchen
f₁ und f₂ befestigt, wie dies aus Abb. 237 erhellt.
Die oberen Flächen von g₁ und g₂ müssen genau
in einer Ebene, die beiden mit dem Stahldraht hergestellten Rinnen
genau in einer Geraden liegen. Um dies sicher zu erreichen,
verfährt man folgendermaßen. Man bringt auf die Endflächen von
f₁ und f₂ etwas Glaserkitt und legt g₁
und g₂ darauf. Mit einem ausgespannten Faden prüft man
zuerst, ob die Rinnen genau in einer Linie liegen; nötigenfalls[S. 301]
werden die Plättchen verschoben, bis sie richtig liegen. Darauf werden
sie beide gleichzeitig mit einer hinreichend großen, ebenen
Glasplatte (Spiegelglas) oder sonst einem Gegenstand, der sicher eben
ist, fest aufgedrückt; dann prüft man nochmals mit dem Faden, ob
die Rinnen noch richtig liegen, drückt die Glasplatte nochmals auf
u. s. f., bis man sicher ist, daß die beiden Lagerplättchen genau
richtig liegen.
Da wo die Schneiden der Achse über die Löcher in g zu liegen
kommen, werden sie mit Schmirgelpapier gereinigt und mit 2 bis 3
Windungen eines 1 mm starken nackten Kupferdrahtes umwickelt;
die Enden des Drahtes werden auf der Unterseite fest zusammengedreht,
kurz abgeschnitten und verlötet (e).
Die Mühe, das Lager in der eben beschriebenen Weise herzustellen,
lohnt sich nur dann, wenn unbedingt genau und sorgfältig gearbeitet
wird. Wer nicht genügend Handfertigkeit in diesen Arbeiten besitzt,
der erhält mit den im folgenden angegebenen einfacheren Ausführungen
wahrscheinlich ein genauer arbeitendes Instrument.
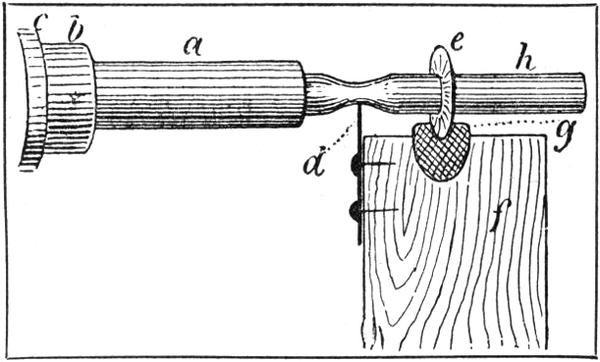
Abb. 241. Einfachere Lagerung.
Die Stäbchen h erhalten keine Schneide, dagegen dreht man ihnen
nahe der Stelle, wo sie aus a herausragen, eine Einschnürung
an, wie dies aus Abb. 241 zu erkennen ist. Mit der Einschnürung ruht
das Lagerstäbchen auf einem Streifen von Messingblech d, der
an f befestigt ist. Ferner wird an h, das in diesem
Fall auch aus gewöhnlichem Rundeisen hergestellt werden kann, aus
Kupferblech ein Scheibchen e angelötet und unter diesem in
f eine entsprechende Vertiefung angebracht.
Noch mehr vereinfachen kann man das Lager, wenn man statt des runden
Stäbchens h einen Messingblechstreifen verwendet, der mit
seiner Kante auf der des Lagerbleches d aufliegt. Es fällt
damit der mittlere, in Abb. 238 und 239 abgebildete Teil ganz weg.
Es wird einfach[S. 302] der etwa 1 mm starke Messingblechstreifen an
den Lagerstellen messerartig geschärft, und durch zwei eingesägte
Schlitze in der Mitte wird der Kupferdraht, der Kern der Spulen,
hindurchgesteckt und festgelötet. Die Zuleitungsdrähte zu den Spulen
werden nach rechts und links auf dem Blechstreifen nach außen geführt
und mit etwas Schellack- oder Kolophonium-Wachskitt auf dem Bleche
befestigt. Die Enden des Drahtes werden nach unten gebogen und von der
Umspinnung frei gemacht; sie sollen so lang sein, daß sie noch in die
in f eingebohrte Vertiefung hinabreichen.
Abb. 242 zeigt diese Anordnung, die an Empfindlichkeit den beiden
anderen kaum nachsteht und zudem viel einfacher herzustellen ist; sie
hat aber den Nachteil, daß sie keine gleichmäßigen Ausschläge liefert,
da sich die Schneiden des Lagers ständig verändern. Wir werden also
auf diese Weise kein Präzisionsinstrument herstellen können. Immerhin
werden wir mit den letztgenannten Anordnungen, wenn sie auch nur
einigermaßen sauber ausgeführt sind, weit genauere Resultate erzielen
als mit der ersten, wenn diese nicht sehr zuverlässig gearbeitet ist.
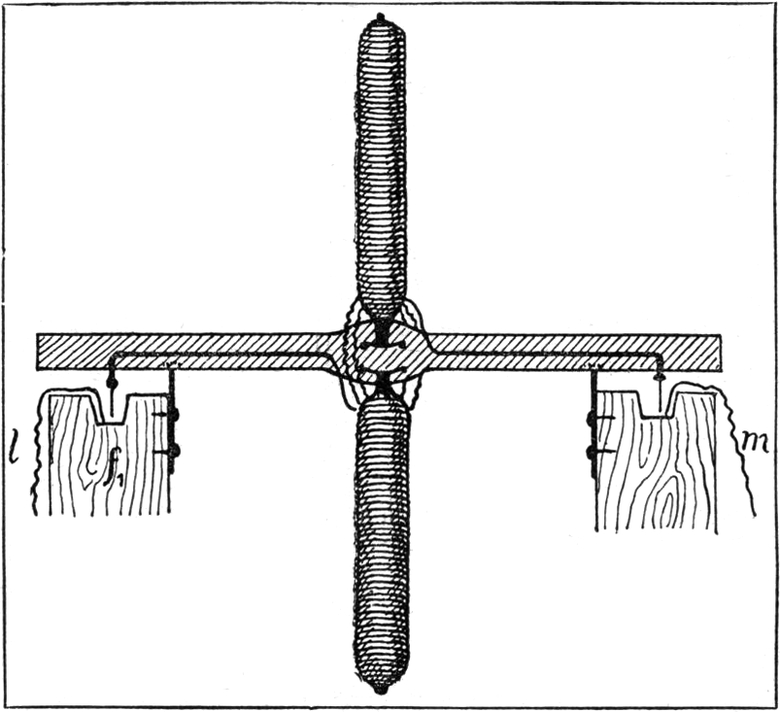
Abb. 242. Lagerung mit einem Blechstreifen.
Wie diese Teile nun montiert werden, geht wohl zur Genüge aus Abb. 237
hervor; es sei nur noch bemerkt, daß die beiden festen Spulen a
und b, die ursprünglich[S. 303] einen Abstand von 1,5 cm haben,
jetzt so nahe zusammengerückt werden, daß die Achse des Ankers gerade
noch freien Spielraum hat. Sie werden dann in der schon erwähnten Weise
mit etwas Schellackkitt auf dem Brettchen e befestigt.
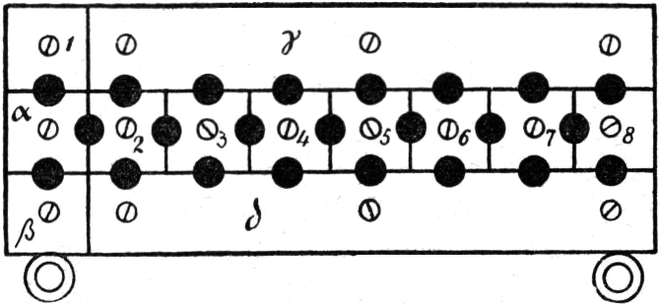
Abb. 243. Die Platte des Stöpselkontaktes.
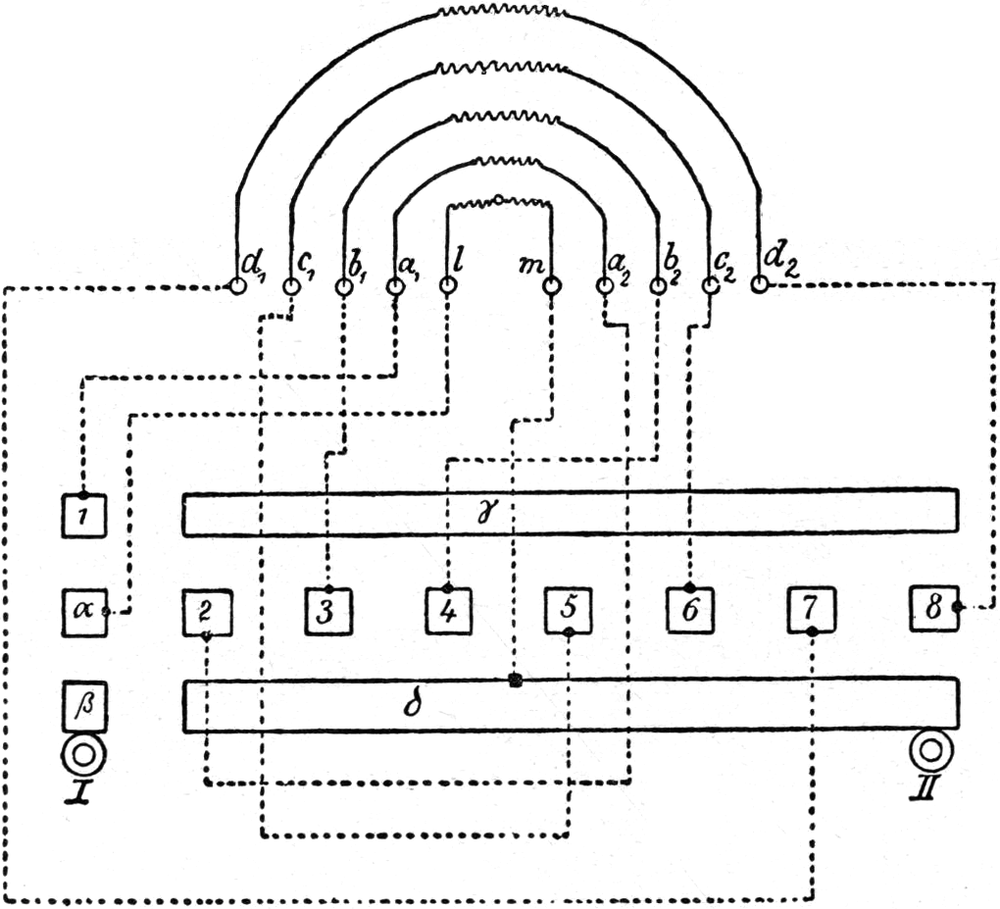
Abb. 244. Schema des Stöpselkontaktes.
Es sind nun noch die zehn Drahtenden (a¹|₂, b¹|₂,
c¹|₂, d¹|₂, l und m) mit einer aus
c (Abb. 237) anzubringenden Schaltvorrichtung zu versorgen.
Diese Schaltvorrichtung wird durch ein System von sogenannten
Stöpselkontakten hergestellt. Wir beschaffen uns zu diesem Zweck ein 8
cm langes, 3 cm breites und 2 mm starkes Kupfer-
oder Messingblech, in das wir die aus Abb. 243 hervorgehende Einteilung
einritzen; an den mit ![[senkrecht durchgestrichener Kreis]](images/circled_vertical_bar.png) bezeichneten Stellen werden 2 mm
weite Löcher gebohrt, durch welche die Schräubchen gehen sollen, mit
denen die einzelnen Teile[S. 304] auf ihrer Unterlage befestigt werden. An
den mit
bezeichneten Stellen werden 2 mm
weite Löcher gebohrt, durch welche die Schräubchen gehen sollen, mit
denen die einzelnen Teile[S. 304] auf ihrer Unterlage befestigt werden. An
den mit ![[schwarzer Punkt]](images/black_bullet.png) bezeichneten Stellen werden 3 bis 4 mm weite Löcher
eingebohrt. Darauf wird dieses Blech auf seine Unterlage gelegt, und
man bezeichnet genau die Stellen für die Schraubenlöcher. Dann werden
die einzelnen Teile auseinandergesägt und mit so langen Schrauben auf
ein Brettchen aufgeschraubt, daß sie durch das Brettchen hindurchgehen.
Die zehn Drahtenden werden nun so, wie dies aus dem Schema (Abb. 244)
hervorgeht, mit den einzelnen Teilen des Stöpselhalters verbunden,
indem sie an die unteren Enden der Schrauben angelötet werden. Außerdem
werden noch die beiden Klemmschrauben I und II mit den Stücken β und
δ verlötet. Ferner drehen wir uns noch aus einem 4 bis 5 mm
starken Kupferdraht zehn ein wenig konische Stöpsel, die gut in die
Löcher passen; zur besseren Handhabung kann man sie oben zu einer
Schlinge biegen.
bezeichneten Stellen werden 3 bis 4 mm weite Löcher
eingebohrt. Darauf wird dieses Blech auf seine Unterlage gelegt, und
man bezeichnet genau die Stellen für die Schraubenlöcher. Dann werden
die einzelnen Teile auseinandergesägt und mit so langen Schrauben auf
ein Brettchen aufgeschraubt, daß sie durch das Brettchen hindurchgehen.
Die zehn Drahtenden werden nun so, wie dies aus dem Schema (Abb. 244)
hervorgeht, mit den einzelnen Teilen des Stöpselhalters verbunden,
indem sie an die unteren Enden der Schrauben angelötet werden. Außerdem
werden noch die beiden Klemmschrauben I und II mit den Stücken β und
δ verlötet. Ferner drehen wir uns noch aus einem 4 bis 5 mm
starken Kupferdraht zehn ein wenig konische Stöpsel, die gut in die
Löcher passen; zur besseren Handhabung kann man sie oben zu einer
Schlinge biegen.
Es wäre endlich noch der Zeiger und die Skala herzustellen. Der Zeiger,
der an der Stirnseite des Stäbchens h mittels eines Schräubchens
angebracht wird, muß aus dünnem Messingblech hergestellt werden und
zweiteilig sein. An der unteren Hälfte wird aus dem gleichen Blech ein
rundes, auf dem Zeiger verschiebbares Scheibchen angebracht; außerdem
verfertigen wir noch zwei andere aus dickerem Blech, so daß wir drei
verschieden schwere Scheibchen haben, die wir sowohl einzeln als auch
alle drei zugleich auf die untere Zeigerhälfte schieben können.
Hinter dem Zeiger befestigen wir an dem Klötzchen f ein
kreisrundes Brettchen, dessen Durchmesser etwas mehr als die ganze
Zeigerlänge beträgt und auf dessen Vorderseite ein weißer Karton
aufgeklebt ist. In die in die Plättchen g₁ und g₂
gebohrten Löcher wird so viel Quecksilber gegossen, das es sich etwas
über die Fläche von g herauswölbt. Im Falle daß die in Abb. 241 oder
242 angedeutete Konstruktion verwendet wurde, werden die Vertiefungen
in f₁ und f₂, in die auch die Drähte l und
m hineinragen, mit Quecksilber ausgefüllt.
Nun bringen wir noch auf der Unterseite des mit Stollen zu versehenden
Grundbrettes drei verschiedene[S. 305] Nebenschlußwiderstände an. Über deren
genauere Bestimmung vergleiche Seite 108/109 und 97.
Zuletzt ist das Instrument zu eichen. Wir können mit Hilfe unseres
Stöpselschalters die vier verschiedenen Wickelungen hinter- oder
nebeneinander schalten, können auch einzelne ausschalten, ganz wie
wir wollen. Soll das Instrument z. B. als Amperemeter für starke
Ströme benutzt werden, so schieben wir auf den Zeiger alle drei
Ballastplättchen, das schwerste zu unterst, und schalten alle
Drahtwindungen nebeneinander, was durch folgende Verbindung geschieht.
Es werden durch Stöpsel verbunden (siehe Schema Abb. 243 und 244): β
mit α mit 1, dann γ mit 3, dann γ mit 5, dann γ mit 7, dann δ mit 2,
dann δ mit 4, dann δ mit 6 und endlich δ mit 8. Wollen wir dagegen
sehr schwache Ströme messen, so müssen wir alle Drahtwickelungen
hintereinanderschalten; dies geschieht durch die Verbindung von β mit α
mit 1, 2 mit 3, 4 mit 5, 6 mit 7, 8 mit δ.
Auf dem Skalenbrett haben wir sechs konzentrische Kreise aufgezeichnet
und mit den Ziffern 1 bis 6 versehen. Für jede Skala gilt nur eine ganz
bestimmte Schaltung und für Stromstärken in bestimmten Grenzen. So die
Skala 1 als Voltskala für große Spannungen, Skala 2 als Ampereskala
für große Stromstärken, Skala 3 als Voltskala für mittlere Spannungen,
Skala 4 als Ampereskala für mittlere Stromstärken; Skala 5 als
Voltskala für geringe Spannungen, Skala 6 als Ampereskala für geringe
Stromstärken.
Wie schon erwähnt, gehört zu jeder Skala eine besondere Schaltung;
es wird darum von Vorteil sein, auf dem Grundbrett des Apparates ein
Schaltungsschema anzubringen, auf dem mit verschiedenen Farben die
verschiedenen Schaltungen angedeutet sind; dabei darf die Angabe der
verwendeten Ballastplättchen und ihrer Lage am Zeiger nicht vergessen
werden. Wie solche Instrumente durch Vergleich mit anderen geeicht
werden, ist schon auf Seite 97 und 108 eingehend besprochen worden.
Soll das Instrument auch für Wechselströme Verwendung finden, so muß
dafür eine besondere Skala geeicht[S. 306] werden, an der auch die Periode des
Wechselstromes angeschrieben ist. (Vergleiche Seite 188.)
Schließlich können wir uns noch einen Schutzkasten mit einer Glaswand
auf der Vorderseite herstellen, der so über das Ganze paßt, daß nur die
Schaltvorrichtung freiliegt.
Herstellung eines Elektroskopes.
W
Wollen wir uns ein empfindlicheres Elektroskop herstellen, als das auf
Seite 9 beschriebene, so können wir folgendermaßen zu Werke gehen: Wir
lassen uns einen Streifen aus 2 mm starkem Eisen- oder besser
Messingblech schneiden, der 5 cm breit und 45 bis 50 cm
lang ist. Den Streifen biegen wir über irgend einen zylindrischen
Gegenstand von etwa 15 cm Durchmesser zu einem Reif zusammen, so
daß die Ränder des Blechstreifens etwa 2 cm übereinandergreifen,
in welcher Lage sie verlötet werden. Wir lassen uns beim Glaser zwei
etwa 3 mm starke Glasscheiben schneiden, deren Durchmesser
etwas größer ist als der des Blechreifens. An der Lötstelle wird der
Blechreifen auf einen Fuß gesetzt, wie aus der Abb. 245 zu ersehen
ist. Von oben wird ein Messingstab in das Gehäuse eingeführt, der
unten zugeschärft ist. Die Goldblättchen (siehe auch Seite 9 und 10)
werden diesmal nicht aufgeleimt, sondern in einen feinen Sägespalt
eingeklemmt. Die Stange, die die Goldblättchen trägt, wird durch
ein Hartgummirohr vom Gehäuse isoliert mit gutem roten Siegellack
eingekittet. Der Drehpunkt der Goldblättchen soll etwas über der Mitte
liegen. Eine Skala mit Gradeinteilung wird so angebracht, wie aus der
Abbildung ersichtlich ist. Endlich werden die beiden[S. 307] Glasplatten mit
Siegellack beiderseits auf das Gehäuse aufgekittet. Ein kleines Häkchen
am Fuß oder am Gehäuse dient zum Einhängen eines Drahtes oder einer
Kette, die das Gehäuse mit der Erde in leitende Verbindung bringen soll.
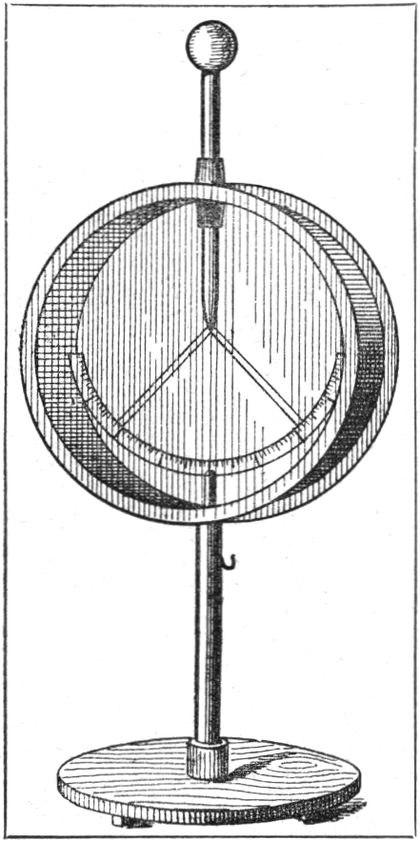
Abb. 245. Elektroskop.
Wie man mit selbst
hergestellten Apparaten auf grössere Entfernungen drahtlos telegraphieren
kann.
I
Im letzten Vortrage Seite 254 u. f. haben wir gesehen, wie man mit
den dort beschriebenen Apparaten auf 20 bis 30 m noch sehr gut
Telegramme übermitteln kann. Wir wollen nun noch darlegen, wie man es
anzufangen hat, wenn man auf eine Entfernung von etwa 500 m sich
mittels der Funkentelegraphie verständigen will.
Für jede einzelne Station brauchen wir einen Funkeninduktor (oder eine
Influenzmaschine) mit Sender, Taster usw. und einen Fritter mit Relais,
Glocke, Morseapparat usw., also die in Abb. 209 (Seite 254) schematisch
wiedergegebene Zusammenstellung von Apparaten. Die beiden Fangdrähte
sowohl des Senders wie die des Fritters bleiben weg. Dafür müssen wir
einen möglichst langen, senkrecht hängenden Draht an den einen Pol des
Senders bezw. Fritters anschließen, und den anderen Pol mit der Erde in
leitende Verbindung bringen.
Wir verfahren dabei etwa folgendermaßen: Aus einem Fenster im obersten
Stock unseres Hauses oder aus einer Dachluke lassen wir einen Draht von
hinreichender Länge bis zur Erde niederfallen. Den Draht befestigen wir
an einem an einer Stange angebrachten Isolierknopf. Die Stange stecken
wir so weit zum Fenster heraus, daß der Draht, der mit der Erde nicht
in leitende Berührung kommen darf, völlig frei hängt. Er soll sich
womöglich gerade vor dem Fenster des Zimmers befinden, in dem wir die
Apparate aufstellen wollen. Letzteres geschieht natürlich am besten in
einem Zimmer des untersten Stockwerkes, oder in einem nicht zu tief
liegenden Keller (Souterrain).
Die Apparate selbst können wir in beliebiger Anordnung aufstellen. Je
einen Pol des Senders und des Fritters verbinden wir mit der Gas- oder
besser mit der[S. 308] Wasserleitung; es muß eben eine gute Erdverbindung
hergestellt sein. Den anderen Pol des Fritters verbinden wir mit dem
unteren Ende des Fangdrahtes, damit ankommende elektrische Wellen auch
gleich in Glocken- oder Schriftzeichen umgesetzt werden können. Wollen
wir selbst elektrische Wellen in die Ferne schicken, so müssen wir
deshalb die Verbindung zwischen Fangdraht und Fritter lösen und den
Fangdraht mit dem noch freien Pol des Senders verbinden. Im übrigen
verändern sich die auf Seite 254 beschriebenen Verhältnisse nicht. Die
Fangdrähte der beiden Stationen seien in Bezug auf Material, Dicke und
Länge möglichst gleich.
Dieses System der Funkentelegraphie ist von Marconi zuerst angewendet
worden. Je nach den Umständen — besonders bei Verwendung etwas
primitiver Apparate — dürfte man jedoch mit dem von Professor Braun
angegebenen Verfahren bessere Erfolge erzielen. Das im folgenden
angegebene Verfahren entspricht nicht genau der Braunschen Schaltung,
sondern beruht nur auf dessen Grundprinzipien. Wir führen es hier an,
weil wir durch eigene Versuche gefunden haben, daß es bei Verwendung
einfacher Apparate — besonders kleinerer Funkeninduktoren — den
Anforderungen eines jungen Physikers am meisten entspricht.
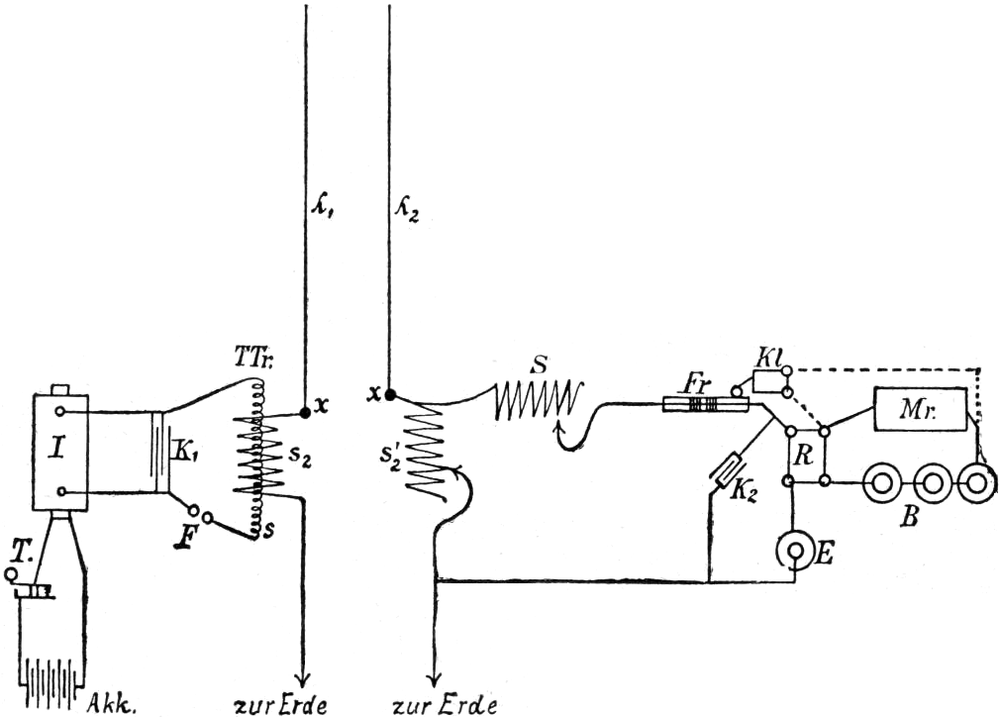
Abb. 246. Schaltungsschema der Apparate für drahtlose
Telegraphie.
Abb. 246 stellt schematisch die Schaltungsweise der Apparate dar,
indem Geber- und Empfängerapparate getrennt gezeichnet sind. An jeder
Station müssen natürlich beide Einrichtungen vorhanden sein; jedoch
ist nur ein Fangdraht nötig. Durch einen einfachen Umschalter,
den zu[S. 309] konstruieren wir der Phantasie des Lesers überlassen, kann der
Fangdraht λ bei x entweder an s₂ oder an s₂′
angeschlossen werden.
Der Sender besteht aus dem Induktor J, dessen Primärstrom
von dem Akkumulator Akk. geliefert wird und durch den Taster
T unterbrochen werden kann. An den Induktor wird in der bereits
beschriebenen Weise (Seite 258) ein Teslatransformator
(Seite 259 u. f.) TTr angeschlossen: K₁ ist der Kondensator,
s₁ die primäre Wickelung des Transformators, s₂
dessen sekundäre Wickelung und F die Funkenstrecke (Abb.
210). Statt dieser Schaltung kann man auch bei Verwendung von zwei
Leidener Flaschen die in Abb. 247 angegebene verwenden. Der eine Pol
der sekundären Spule des Transformators wird mit dem Luftdraht λ, der
andere Pol mit der Erde verbunden.
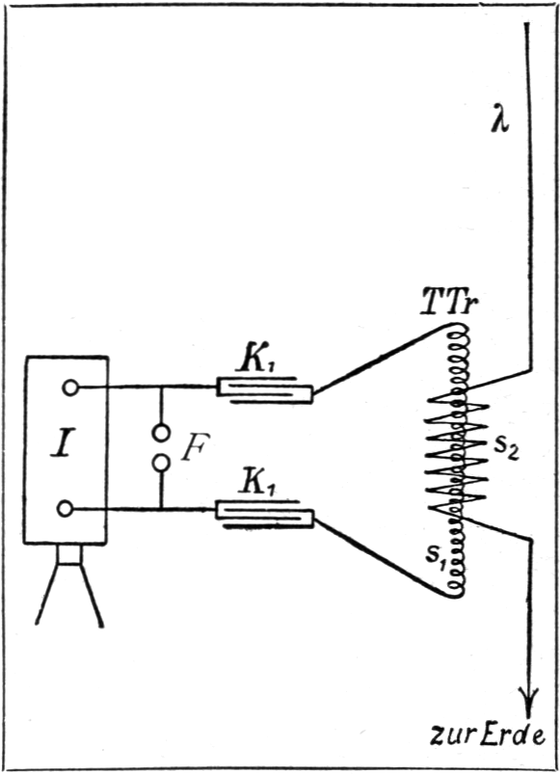
Abb. 247. Schaltung mit zwei Kondensatoren.
Für den Empfänger müssen wir uns zunächst zwei abstimmbare Spulen
herstellen, s₂′ und S. Zu diesem Zweck beschaffen wir
uns zwei weite, zylindrische Einmachgläser; auf jedes Glas sollen 20
bis 30 m eines 1 bis 2 mm dicken nackten Kupferdrahtes
so aufgewunden werden, daß die einzelnen Windungen einander nicht
berühren. Die Gläser müssen also ziemlich groß sein; statt ihrer
kann man auch mit Schellack überzogene Pappezylinder verwenden. Die
Drahtspirale darf nur lose auf dem Zylinder aufsitzen und wird nur an
den beiden Enden mittels Schellackkitt befestigt. Das eine Ende der
Spule endet leer, das andere[S. 310] in einer Klemmschraube. Bevor jedoch das
leer auslaufende Drahtende angekittet wird, wickeln wir um den Draht
der Spirale einen dünnen, nackten Kupferdraht in ein paar Windungen
auf, und drehen die Enden zusammen; es entsteht dadurch eine Hülse oder
Öse, die sich leicht auf der lose sitzenden Spirale verschieben läßt.
Erst wenn diese Hülse aufgeschoben ist, wird das leere Drahtende der
Spirale angekittet. Die zusammengedrehten Drahtenden der Hülse werden
zu einem Ringchen gebogen.
Wir brauchen also für jede Station zwei solcher Spulen, die wir
nebeneinander aufstellen. Die beiden mit Klemmen versehenen Drahtenden
werden bei x an den Luftdraht λ angeschlossen. In das
Ringchen des Schiebers der einen Spule s₂′ wird ein Draht
eingehängt, der mit der Wasserleitung verbunden wird. Den Schieber
der zweiten Spule S verbinden wir mit der einen Elektrode des
Fritters Fr, dessen andere Elektrode unter Zwischenschaltung
eines Relais R und eines Elementes E mit dem zur Erde
ableitenden Drahte verbunden wird. Parallel zu diesem Stromkreis
ist ein Kondensator K₂ (kleine Leidener Flasche)
eingeschaltet, wie aus der Figur deutlich zu erkennen ist. Wie der
Klopfer Kl, der Morseapparat Mr, das Relais R und
die Batterie B zu schalten sind, ist aus den Ausführungen Seite
254 zu erkennen, außerdem zeigt es Abb. 246 deutlich an.
Die günstigste Stellung der in der Abbildung mit Pfeilspitzen
bezeichneten Schieber an den Spulen s₂′ und S
ist durch Probieren ausfindig zu machen. Für S kann man im
allgemeinen sagen, daß die Länge des aufgewundenen Drahtes von x
bis zur Berührungsstelle des Schiebers gleich der Länge des Luftdrahtes
sein soll.
Wir können die Abstimmbarkeit unseres Systemes noch erhöhen, indem wir
auch die Kondensatoren so einrichten, daß wir die Kapazität variieren
können. Wir wissen, daß die Kapazität eines Kondensators von der Größe
der wirksamen Fläche abhängt; wir müssen daher versuchen, diese Größe
leicht ändern zu können: Wir befestigen auf einem Brett (a) eine
größere Anzahl dünner Blechscheiben (b), die etwa 1 cm
Abstand haben sollen. (In der Abb. 248 sind[S. 311] der Deutlichkeit halber
die Abstände größer gezeichnet.) An einer Messingstange c sind
halbkreisförmige Blechscheiben mit dem gleichen Abstand angelötet. Die
Achse c wird gut isoliert so gelagert (in der Abbildung sind
die Lager nicht gezeichnet), daß die Scheiben d genau zwischen
die Scheiben b hineingedreht werden können. Endlich werden alle
Scheiben b untereinander leitend verbunden, sie bilden den
einen, d den anderen Belag des Kondensators. Es ist klar, daß
wenn die Achse c so gedreht ist, daß die d ganz zwischen
den b sind, die Kapazität am größten ist und daß sie immer
kleiner wird, je weiter ich die Scheiben d nach oben drehe.
Solche Kondensatoren werden einfach den anderen parallel zugeschaltet.
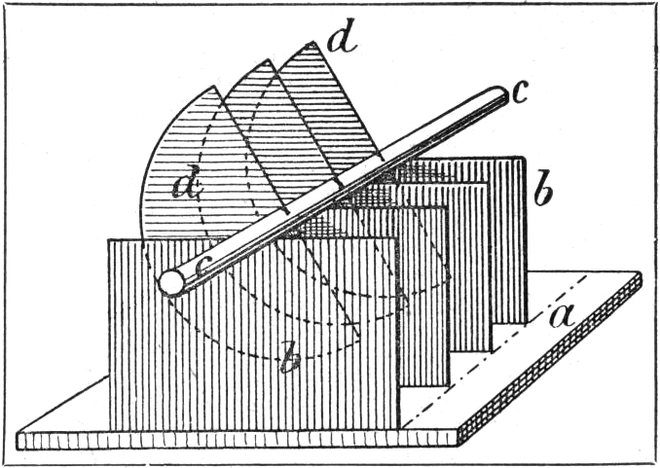
Abb. 248. Verstellbarer Kondensator.
Anfertigung einer
Kraftmaschine mit Gewicht.
Z
Zum Antrieb von Influenzelektrisiermaschinen, magnetelektrischen
Maschinen, Dynamos usw. eignet sich sehr gut die im folgenden
beschriebene Maschine.
Der ganze Apparat ist sehr einfach, nur dürfte seine Anbringung in
einer Wohnung auf einige Schwierigkeiten stoßen. Wir müssen nämlich
in der Decke eines nicht zu niedrigen Raumes einen Haken befestigen,
der eine Tragkraft von einigen Zentnern haben muß; ferner müssen die
Lagerträger einer Welle auf dem Boden angeschraubt werden. Wo dies
nicht möglich ist, muß der ganze Apparat in ein hinreichend hohes
Gestell aus starken Latten eingebaut werden.
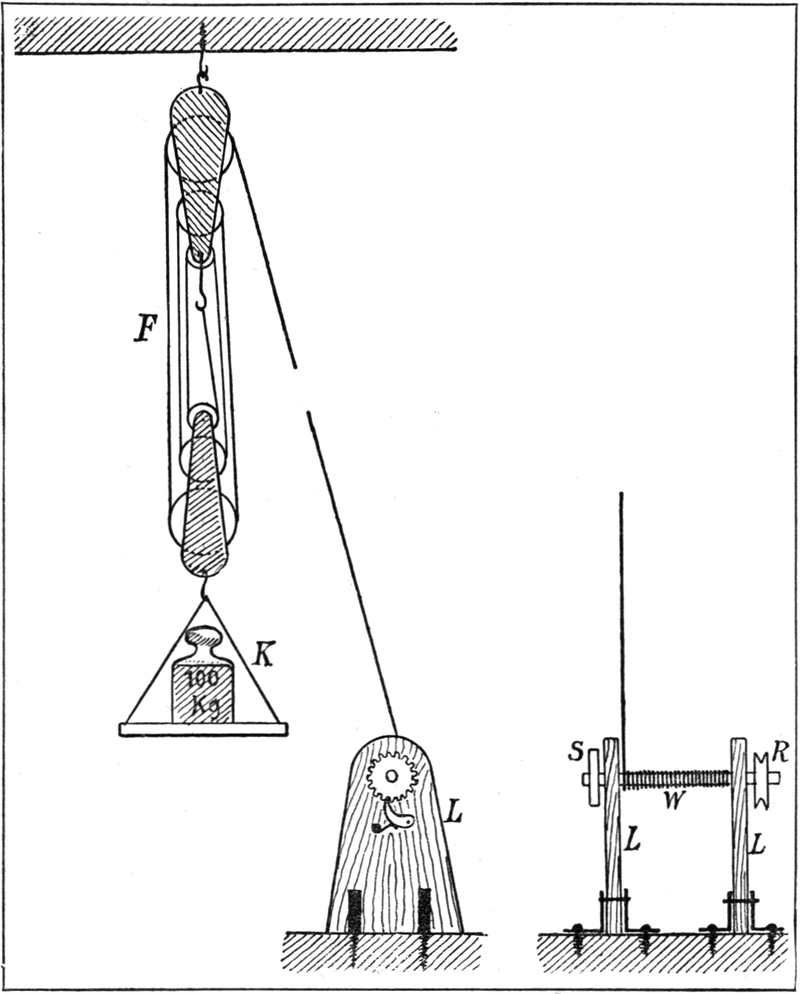
Abb. 249. Kraftmaschine mit Gewicht.
Abb. 249 zeigt die Kraftmaschine. Wir kaufen uns einen starken drei-
bis fünfrolligen Flaschenzug F, den wir uns übrigens auch selbst
herstellen können und den wir[S. 312] an der Decke befestigen. Auf dem Boden,
aber nicht unmittelbar unter dem Haken, sondern etwas seitlich davon
werden die beiden Lagerträger L befestigt, in denen die Lager
— Herstellung siehe Seite 22 — ruhen. In letzteren läuft die Welle
W, die man aus einem Gas- oder Wasserleitungsrohr herstellen
kann. Am linken Ende der Welle ist ein Sperrrad S, am rechten
eine Übersetzungsrolle R anzubringen. An den unteren Haken des
Flaschenzuges[S. 313] wird das Triebgewicht K angehängt. Außerdem ist
in der Figur noch ein Sperrrad zu sehen, mit dem die Welle festgestellt
werden kann; auch kann man noch eine Kurbel zum Aufwinden und bei einer
größeren Anlage auch noch eine Bremsvorrichtung anbringen.
Kann man von dem Fenster eines höher gelegenen Stockwerkes einen 2
bis 3 mm starken Draht nach unten frei ausspannen, so läßt man
das Gewicht an diesem Draht außen an der Hauswand entlang laufen. Es
erübrigt dann unter Umständen die Anwendung eines Flaschenzuges. Vor
allem muß aber mit einem eventuellen Reißen des Seiles gerechnet und
daher die nötigen Vorsichtsmaßregeln, zu denen auch der Laufdraht
gehört, getroffen werden.
Über die Handhabung dieses Apparates wird sich der junge Leser wohl
ohne weiteres im klaren sein.

Abb. 250. Rudis selbstgefertigte Apparate.
[S. 314]
|
Drahtmaße
Tabelle I. Nickelindrähte.
|
|
Durchmesser
|
Widerstand
für jedes Meter
|
Maximale
Belastung
|
|
mm
|
Ohm
|
Ampere
|
|
0,5
|
2,0
|
2
|
|
0,6
|
1,41
|
3
|
|
0,8
|
0,79
|
6
|
|
1,0
|
0,51
|
10
|
|
1,5
|
0,23
|
23
|
|
2,0
|
0,13
|
38
|
|
2,5
|
0,08
|
45
|
|
3,0
|
0,06
|
50
|
|
Tabelle II.
Kupferdrähte.
|
|
Durchmesser
|
Querschnitt
|
Widerstand
für jedes Meter
|
Länge für
jedes Ohm
|
Länge für
jedes Kilogramm
|
|
mm
|
qmm
|
Ohm
|
m
|
m
|
|
0,1
|
0,0079
|
2,21
|
0,45
|
14300
|
|
0,2
|
0,0314
|
0,55
|
1,8
|
3576
|
|
0,3
|
0,0707
|
0,24
|
4,0
|
1590
|
|
0,4
|
0,0314
|
0,13
|
7,2
|
894
|
|
0,5
|
0,196
|
0,08
|
12,28
|
570
|
|
0,6
|
0,283
|
0,06
|
16,25
|
397
|
|
0,7
|
0,385
|
0,04
|
22,12
|
292
|
|
0,8
|
0,50
|
0,03
|
28,90
|
223
|
|
0,9
|
0,64
|
0,027
|
36,57
|
176
|
|
1,0
|
0,79
|
0,022
|
45,14
|
143
|
|
1,1
|
0,95
|
0,018
|
54,62
|
118
|
|
1,2
|
1,13
|
0,015
|
65,00
|
100
|
|
1,3
|
1,32
|
0,013
|
76,29
|
85
|
|
1,4
|
1,54
|
0,011
|
88,48
|
73
|
|
1,5
|
1,76
|
0,009
|
101,6
|
63
|
|
1,6
|
2,01
|
0,008
|
115,6
|
53
|
|
1,7
|
2,27
|
0,007
|
130,5
|
50
|
|
1,8
|
2,54
|
0,006
|
146,2
|
44
|
|
1,9
|
2,83
|
0,006
|
163,0
|
39
|
|
2,0
|
3,14
|
0,0055
|
180,5
|
36
|
|
2,2
|
3,80
|
0,0045
|
218,5
|
29
|
|
2,3
|
4,15
|
0,0041
|
238,8
|
27
|
|
2,5
|
4,90
|
0,0035
|
282,1
|
23
|
|
2,6
|
5,30
|
0,0032
|
305,2
|
21
|
|
2,8
|
6,15
|
0,0028
|
353,9
|
18
|
|
3,0
|
7,07
|
0,0024
|
406,3
|
16
|
Die Ziffern bezeichnen die Seitenzahlen.
- Abstoßung und Anziehung, elektrische 37, 38, 40, 41.
- — magnetische 102–105.
- Achsenansätze 22–25.
- Achsenbefestigung an Glasscheiben 10–12.
- Achsenträger 13, 25–27.
- Akkumulatoren 72–81, 291–294.
- Akkumulatorenbehälter aus Glas 78–80.
- — aus Zelluloid 291, 292.
- Akkumulatorenbehandlung 80, 81.
- Amalgamieren 15.
- Ampere 84–88.
- Amperemeter 96–99.
- — Schaltung 108–109.
- Amperesche Schwimmerregel 105.
- Anker, Hufeisenanker 139.
- — Kurzschlußanker 199.
- — Ringanker 126–129.
- — _T_-Anker 126, 139.
- Anode und Kathode 217.
- Anziehung und Abstoßung,
- — elektrische 37, 38, 40, 41.
- — magnetische 102–105.
- Astatisches Nadelpaar 93–94.
- Ätzen von Glas mit Flußsäure 12.
- Aufkleben von Stanniolbelägen 8, 9, 33, 34.
- Ausgleich, elektrischer 49, 50.
- Ausgleicher 33.
- Bahnen, elektrische 152.
- Baryumplatincyanür 221.
- Batterie, galvanische 88, 89.
- Behandlung der Akkumulatoren 80, 81.
- Belag für Influenzmaschinen 33, 34.
- Belag für Leidener Flaschen 8, 9.
- Beleuchtungsmechanismus mit Zimmerverdunkelung 227.
- Bifilare Wickelung 253–254.
- Bleilöten 77.
- Bleiplatten für Akkumulatoren 73, 74.
- Blitz 51, 52.
- Bogenlampe 153.
- Brechung und Reflexion der elektrischen Wellen 249–251.
- Bunsenelement 67.
- — verbessertes 67–69.
- Chromsäureelement 70, 71.
- Crookessche Röhre 219–221.
- Dämpfung 161.
- Daniellelement 67.
- Dielektrizitätskonstante 45.
- Drahtlose Telegraphie 239, 251–257, 307–311.
- Drahtmaße 134–137.
- — Tabellen 182, 183, 314.
- Drahtspulen 91, 276, 295.
- Drehspiegel 233, 234.
- Drehstrom 191, 196.
- Dreieckschaltung 195.
- Dreiphasenstrom 193–196.
- — Demonstrationsapparat 196.
- Dynamomaschine 148–152.
- Dynamometer 207, 208.
- Eichen 98.
- Elektrische Bahn 152.
- Elektrische Klingel 113–115.
- Elektrische Lokomotive 152.
- Elektrische Oszillationen 232–236.
- Elektrisches Flugrad 17, 18, 44.
- Elektrisches Pendel 3, 39, 40.
- Elektrische Verteilung 41–43.
- Elektrischer Zigarrenanzünder 155, 156.
- Elektrisiermaschinen,
- — Induktionselektrisiermaschine 166–168.
- — Influenzelektrisiermaschine 19–35, 48, 49.
- — Reibungselektrisiermaschine 10–18, 48.
- Elektrizitäten, positive und negative 38, 39.
- Elektroden 217, 218.
- Elektrodenstangen 32.
- Elektrodynamometer 207, 208.
- Elektroinduktion 138.
- Elektrolytischer Unterbrecher 185, 186, 232.
- Elektromagnet 103–105, 114, 276.
- Elektromotore 121–137.
- — mit zweipoligem Hufeisenanker 122.
- — mit vierpoligem Hufeisenanker 124.
- — mit sechspoligem Sternanker 125–126.
- Elektromotorische Kraft 57, 58, 84–89.
- Elektrophor 4, 5, 43.
- Elektroskop 9, 10, 43, 306, 307.
- Elemente 58–84.
- — Bunsenelement 67.
- — Chromsäureelement 70, 71.
- — Daniellelement 67.
- — Kupferoxydelement 82.
- — Kupronelement 82.
- — Trockenelement 65–67.
- Elementschaltung 88–89.
- Empfänger 253–254.
- Entdeckung des galvanischen Stromes 55–56.
- Entladung, oszillierende 232–236.
- Erwärmung durch den elektrischen Strom 18–19, 51, 188.
- — durch Kathodenstrahlen 219–221.
- Federunterbrecher 166–168, 181, 183–186.
- Flugrad, elektrisches 17, 18, 44.
- Fluoreszenz 219, 221, 223, 225.
- Fluoreszenzschirm 223, 225, 228, 229.
- Franklinsche Tafel 8, 45.
- Fritter 236–239, 248, 249.
- Froschschenkel 55, 56.
- Funkeninduktoren 168–181.
- — Tabellen 182, 183.
- — Isoliermaße 183.
- Funkenmikrometer 263.
- Funkentelegraphie 239, 251–257, 307–311.
- Galvanisches Element 56, 58–84.
- Galvanischer Strom 56.
- Galvanoskope 90–96.
- — einfaches Galvanoskop 90.
- — Vertikalgalvanoskop 91, 92.
- — Multiplikator 92–95.
- Geißler-Röhre 215–219.
- Gesetze des galvanischen Stromes 84–89.
- Gipszylinder 60–63.
- Glas für elektrische Zwecke 2, 3, 8, 9.
- Glasätzen 12.
- Glasbehälter für Akkumulatoren 78–80.
- Glasglocke 214.
- Glaskitten 79, 80.
- Glasscheiben für Reibungselektrisiermaschinen 10.
- — Influenzmaschinen 19, 20.
- Glasscheibenbefestigung 11, 12, 29, 30.
- Glassprengen 214–215.
- Glimmlicht 217, 218.
- Glühlampenwiderstand 290.
- Graphitrheostat 286–289.
- Gummikitt 293, 294.
- Härten von Stahlstäben 140, 141.
- Hammer, Neefscher 113, 114, 167.
- Hartgummi für elektrische Zwecke 2, 3.
- Hauptstrommaschine 149, 150.
- Hertzsche Wellen 235, 236.
- Hittorfsche Röhre 218, 219.
- Hitzdrahtinstrument 204–206.
- Holundermark 2, 3.
- Hufeisenanker 122–124, 139.
- Hufeisenmagnet 140–145.
- Impedanz 189, 190, 266.
- Induktion, elektrische 138.
- — magnetische 137, 138.
- Induktionsanker 199.
- Induktionsapparate 163–183.
- Induktionsströme 137, 138, 158.
- Induktoren 168–180.
- — Tabellen 182, 183.
- Influenzelektrisiermaschine 19–35, 48, 49.
- — als Motor 54.
- — mit Trockenapparat 210.
- — und Röntgenröhre 222, 223.
- Interferenz 244–247.
- Interferenzröhre 245–247.
- Isolatoren 37, 38.
- Isolierfähigkeitsprüfung 6.
- Isoliermethoden für Funkeninduktoren 171–173, 176–179.
- Isoliermasse 178–179.
- Kapazität 45, 310–311.
- Kathode — Anode 217.
- Kathodenstrahlen 219–221.
- Kitt, Gummikitt 293, 294.
- — Kolophonium-Leinölkitt 66, 80.
- — Schellackkitt 5, 6.
- — wasserdichter 80.
- Klingel, elektrische 113–115.
- Kohärer 236, 237, 248, 249.
- Kohleelektroden 64, 65, 68.
- Kokonfäden 95.
- Kollektoren 122, 123, 128–130, 143, 144.
- Kolophonium-Leinölkitt 66, 80.
- Kommutator 101, 102, 123, 124, 143, 180, 181.
- Kondensatoren 8, 44, 45, 310, 311.
- Konduktor 6, 7.
- Kontaktknopf 114, 115.
- — Stöpselkontakt 303–305.
- Kraft, elektromotor. 57, 58, 84–89.
- Kraftlinien 102–105, 145, 146.
- Kraftmaschine 311–313.
- Kugeln 7, 8.
- Kupferoxydelement 82.
- Kupronelement 82.
- Kurzschluß 153, 154.
- Kurzschlußanker 199.
- Lager für Achsen 13, 14, 22, 23.
- Lagerträger 14, 25–27.
- Lampenwiderstand 290.
- Leclanché-Element 58–63.
- Leidener Flasche 8, 9, 44–46.
- — für Resonanzversuche 241.
- Leinöl-Kolophoniumkitt 66, 80.
- Leiter und Nichtleiter 37, 38.
- Lokomotive, elektrische 152.
- Longitudinalwellen 270–273.
- Löten von Blei 77.
- Luftpumpe 211–219.
- Luftthermometer 18, 19, 51.
- — für Peltiereffekt 82.
- Magnet und galvanischer Strom 103–105.
- Magnetelektrische Maschine 138–148.
- Magnetinduktion 137, 138, 146.
- Magnetisches Drehfeld 192–194.
- Magnetische Kraftlinien 102, 103.
- Magnetisieren von Stahlstäben 140–143.
- Magnetpolbestimmung 124–125.
- Maßflasche nach Lane 18, 46–48.
- Maxwellsche Regel 145, 146.
- Mehrphasenströme 190–196.
- Meßbrücke 99, 100.
- Messing, seine Verwendung 3, 4.
- Messingkugeln 7.
- Meßinstrumente 96–99, 105–111.
- — Schaltung 108–109.
- — Wirkungsweise 105, 106.
- Metallkugeln 7, 8.
- Mikrophon 202–204, 274, 275.
- Morsetelegraph 115–121.
- Morseschreiber 115–116.
- Morseschrift 120.
- Morsetaster 118.
- Motor, elektrischer 121–137.
- — mit Influenzmaschine 54.
- Multiplikator 92–96.
- Nadelpaar, astatisches 93–94.
- Nebenschlußmaschine 150.
- Neefscher Hammer 113, 114, 167.
- Nichtleiter 37, 38.
- Oberflächenverteilung 43, 44.
- Öffnungsfunken 159.
- Ohm 84–89, 109–111.
- Ohmsches Gesetz 87–89.
- Oszillation, elektrische 232–236.
- Peltiereffekt 82.
- Pendel, elektrisches 3, 39, 40.
- Pendel zum Resonanzversuch 243, 244.
- Phasendifferenz 193, 194.
- Photographieren mit Röntgenstrahlen 223–225.
- Polbestimmung für Elektromagnete 124–125.
- Polschuhe 130, 131.
- Präzisionsinstrument 294–306.
- Quecksilberunterbrecher 183–185.
- Radiator 252.
- Rahmen für Drahtspulen 91, 276, 295.
- Reflexion und Brechung 249–251.
- Reibungselektrisiermaschine 10–17, 48.
- Reibungselektrizität 36.
- Reibzeug 14, 15.
- Relais 121.
- Resonanz 239–244.
- Resonanzpendel 243, 244.
- Rezipient 215.
- Rheostate 286–291.
- Ringanker 126–129.
- Ringmagnet 127.
- Röntgenphotographien 223–225.
- Röntgenröhren 222.
- Röntgenstrahlen 221–229.
- — Verwendung in der Medizin 228, 229.
- Schallbecher 280.
- Scheibenbelag 33, 34.
- Schellackkitt 5, 6.
- Schellacküberzug 20, 21.
- Schleifen von Glas 212.
- Schließungsfunke 159.
- Schmiedeesse 139, 140.
- Schutzhüllen für Instrumente 95, 96.
- Schwimmerregel, Amperesche 105.
- Seide 3, 95.
- Selbstinduktion 158–159.
- Sender 251–253.
- Sicherungen 154, 155.
- Spannungsgefälle 106–108, 110.
- Spitzenkamm 16, 17, 30–32.
- Spitzenkammträger 28, 29, 31, 32.
- Spitzenwirkung 43, 44.
- Spulenrahmen 91, 276, 295.
- Spulmaschine 165, 174.
- Stahlmagnete 140–144.
- Stanzmaschine 73.
- Sternschaltung 195.
- Stöpselkontakt 303–305.
- Strom, elektrischer 49, 50, 51.
- Stromwender 101, 102, 123, 124, 143, 180, 181.
- Tabelle für Induktoren 182, 183.
- — für Drahtmaße 314.
- _T_-Anker 139.
- Taschenakkumulator 291–294.
- Telegraph, Morsetelegraph 115–121.
- — Funkentelegraph 239, 251–257.
- Telephon 200–202, 203–204, 274–285.
- Telephonanlage 202–204.
- Thermoelement 82.
- Teslatransformatoren 257–263.
- Teslaversuche 265–270.
- Transformatoren 196–200.
- — nach Tesla 257–263.
- Transversalwellen 270–273.
- Triebräder für Influenzmaschinen 28, 29.
- Trockenapparat für Influenzmaschinen 210.
- Trockenelement 65, 66.
- Universal-Volt-Amperemeter 294–306.
- Unterbrecher 166, 167, 183–186.
- — elektrolytischer 185, 186, 232.
- — Quecksilberunterbrecher 183–185.
- [S. 319]
Vakuumpumpe 211–217.
- Vergußmasse für Akkumulatoren 77, 293, 294.
- Vertikalgalvanoskop 91, 92.
- Volt 84–89.
- Volt-Amperemeter 294–306.
- Voltasches Element 56.
- Voltmeter 96–99.
- Voltmeterschaltung 108, 109.
- Watt 84–89.
- Wechselströme 186–189.
- — hoher Frequenz 235.
- Wehneltunterbrecher 185, 232.
- Wellen, elektrische 236, 270–272.
- Wellenlänge 249.
- Wellentheorie 235.
- Wheatstonesche Brücke 109, 110, 189.
- Widerstände 286–291.
- Widerstandsbestimmung 109–111.
- — für Gleichstrom 109.
- — für Wechselstrom 111.
- Wimshurstmaschine 19–35, 48, 49.
- Wind, elektrischer 17, 18, 44.
- Wirbelströme 159, 161.
- X-Strahlen 221–229.
- Zelluloidbehälter 291, 292.
- Zigarrenanzünder, elektrischer 155, 156.
- Zinkzylinder 65.
- Zweiphasenstrom 191, 192.
- Zweiwegehahn 213.
Verzeichnis der
Abbildungen.
|
Fig.
|
|
Seite
|
|
|
Gestell zum elektrischen Pendel
|
3
|
|
|
Form zum Elektrophor
|
4
|
|
|
Konduktor
|
7
|
|
|
Messingkugeln
|
7
|
|
|
Elektroskop
|
9
|
|
|
Angelötete Scheibe
|
11
|
|
|
Die Stützen des Rohrs
|
11
|
|
|
Winkelscheit
|
12
|
|
|
Reibungselektrisiermaschine
|
13
|
|
|
Lagerträger
|
14
|
|
|
Gestell des Reibzeugs
|
14
|
|
|
Reibfläche
|
15
|
|
|
Luftthermometer
|
18
|
|
|
Rudi bei der Anfertigung einer
Influenzelektrisiermaschine
|
20
|
|
|
Anfertigung der Achsenrohre
|
22
|
|
|
Achsenrohr
|
23
|
|
|
Aufgelötete Messingscheibe
|
23
|
|
|
Aufkitten auf die Glasscheibe
|
24
|
|
|
Anlegen des Winkelmaßes
|
24
|
|
|
Vorrichtung zur Erzielung der senkrechten
Achsenstellung
|
24
|
|
|
Maschinengestell
|
25
|
|
|
Achsenträger
|
26
|
|
|
Außenseite eines Achsenträgers
|
26
|
|
|
Achse im Träger
|
27
|
|
|
Schematischer Aufriß der Maschine
|
27
|
|
|
Antrieb der Scheiben
|
29
|
|
|
Achsenlager der Scheiben
|
30
|
|
|
[S. 320]
Stellung der Spitzenkämme
|
30
|
|
|
Durchschnitt des Spitzenkammträgers
|
31
|
|
|
Spitzenkammträger
|
31
|
|
|
Stanniolbeläge an den Außenseiten der Scheiben
|
33
|
|
|
Auflegen der Treibschnüre
|
34
|
|
|
Vorgang der Anziehung und Abstoßung
|
40
|
|
|
Darstellung der Verteilung der Elektrizitäten
|
41
|
|
|
Messen der Kapazität
|
47
|
|
|
Darstellung des Ausgleiches der Elektrizitäten
|
49
|
|
|
Darstellung des galvanischen Stromes
|
56
|
|
|
Leclanché-Elemente
|
59
|
|
|
Holzstab für Anfertigung von Gipszylindern
|
60
|
|
|
Gummiring
|
61
|
|
|
Der Holzstab nach Befestigung der Gummiringe
|
61
|
|
|
Aufrollen des Papierstreifens
|
62
|
|
|
Die fertige Form zur Herstellung von Gipszylindern
|
62
|
|
|
Kohlenelektrode
|
64
|
|
|
Trockenelement
|
64
|
|
|
Zinkzylinder
|
65
|
|
|
Das verbesserte Bunsenelement
|
67
|
|
|
Kohlenplatte mit eingebrannter Polschraube
|
68
|
|
|
Kohlenplatte mit Klemmschrauben
|
68
|
|
|
Breitgeschlagener Kupfer- oder Messingdraht
|
69
|
|
|
Holzgestell für Chromsäurebatterie
|
70
|
|
|
Chromsäure-Flaschenelement
|
71
|
|
|
Einteilung des Werkbleistreifens in Platten
|
72
|
|
|
Eine Doppelplatte
|
73
|
|
|
Maschine zum Ausstanzen der Löcher
|
73
|
|
|
Eine zusammengebogene Doppelplatte
|
74
|
|
|
Das Vernieten der Platten
|
76
|
|
|
Fertige Akkumulatorzelle
|
78
|
|
|
Der Boden des Holzgestelles
|
78
|
|
|
Das Holzgestell
|
79
|
|
|
Ausgießen der Kanten des Gefäßes
|
80
|
|
|
Luftthermometer zum Nachweis des Peltiereffektes
|
82
|
|
|
Darstellung fünf verschiedener Schaltungsarten
|
89
|
|
|
Galvanoskop
|
90
|
|
|
Vertikalgalvanoskop
|
91
|
|
|
Netz für das Vertikalgalvanoskop
|
91
|
|
|
Rahmen
|
91
|
|
|
Stabmagnet
|
92
|
|
|
Multiplikator im Vertikalschnitt
|
93
|
|
|
Astatisches Nadelpaar
|
93
|
|
|
Messingröhrchen für den Multiplikator
|
93
|
|
|
Schema eines Voltmeters
|
96
|
|
|
Hebel
|
97
|
|
|
Andere Konstruktion eines Galvanometers
|
98
|
|
|
Rahmen des Galvanometers
|
98
|
|
[S. 321]
|
Das Plättchen mit Zeiger
|
99
|
|
|
Anbringen der Arme zur Aufnahme der Spitzen des
Eisenstäbchens
|
99
|
|
|
Die Wheatstonesche Brücke
|
100
|
|
|
Querschnitt der Wheatstoneschen Brücke
|
100
|
|
|
Der Kommutator
|
101
|
|
|
Seitenansicht des Kommutators
|
101
|
|
|
Verlauf der Kraftlinien in einer vom
elektrischen Strome durchflossenen Drahtspirale
|
103
|
|
|
Schematische Darstellung eines Stromkreislaufes
|
107
|
|
|
Schema des Spannungsgefälles
|
108
|
|
|
Schaltungsschema für Volt- und Amperemeter
|
108
|
|
|
Wheatstonesche Brücke
|
109
|
|
|
Spannungsgefälle in zwei verschiedenen Widerständen
|
110
|
|
|
Wheatstonesche Brücke
|
110
|
|
|
Rudi hält seinen dritten Vortrag
|
112
|
|
|
Die elektrische Klingel
|
113
|
|
|
Elektromagnetkern mit Spulen (Schnitt)
|
114
|
|
|
Schnitt durch den Kontaktknopf
|
114
|
|
|
Feder für den Kontaktknopf
|
115
|
|
|
Schaltungsschema einer Klingelanlage
|
115
|
|
|
Der Morseschreiber (Seitenansicht)
|
115
|
|
|
Der Morseschreiber (Aufsicht)
|
116
|
|
|
Rollen zur Bewegung des Papierstreifens (Schnitt)
|
116
|
|
|
Rollen zur Bewegung des Papierstreifens
(Seitenansicht)
|
117
|
|
|
Morsetaster
|
118
|
|
|
Schaltungsschema der Morseapparate
|
119
|
|
|
Relais im Grundriß
|
121
|
|
|
Elektromotor im Grundriß
|
122
|
|
|
Wirkungsschema des Elektromotors
|
123
|
|
|
Vierpoliger Hufeisenanker
|
124
|
|
|
Verlauf des Stromes beim vierpoligen Anker
|
124
|
|
|
Sechspoliger Elektromotor
|
125
|
|
|
Entstehung der Pole im Grammeschen Ring
|
127
|
|
|
Form für den Grammeschen Ring
|
127
|
|
|
Der mit 12 Spulen bewickelte Grammesche Ring
|
128
|
|
|
Holzkern für den Grammeschen Ring (Schnitt)
|
128
|
|
|
Schnitt durch Holzkern und Ring
|
128
|
|
|
Ringanker mit Kollektor
|
129
|
|
|
Fertiger Motor (links Ansicht, rechts Schnitt)
|
129
|
|
|
Motor von oben gesehen (rechts Schnitt)
|
131
|
|
|
Gestalt eines Polschuhes
|
131
|
|
|
Bewickelungsschema
|
133
|
|
|
Ankerformen für magnetelektrische Maschinen
|
139
|
|
|
Die improvisierte Schmiedeesse (Schnitt)
|
139
|
|
|
Der aus einzelnen Stäben zusammengesetzte
Magnetstock
|
143
|
|
|
Gleich- und Wechselstromabnehmer auf einer Achse
|
143
|
|
|
Verschiedene Formen für Feldmagnete
|
144
|
|
[S. 322]
|
Schnitt durch die magnetelektrische Maschine mit
Hufeisenanker
|
145
|
|
|
Drahtringe, die sich in einem magnetischen Feld
bewegen
|
146
|
|
|
Schema einer Hauptstrommaschine
|
149
|
|
|
Schema einer Nebenschlußmaschine
|
150
|
|
|
Schema einer Maschine mit Fremderregung
|
150
|
|
|
Einschaltung eines Hilfsstromes in den Stromkreis der
Dynamo
|
151
|
|
|
Einfache Bogenlampe
|
153
|
|
|
Drahtschnecke für den Zigarrenanzünder
|
155
|
|
|
Der Zigarrenanzünder
|
156
|
|
|
Rudi mit den Vorversuchen für seinen Vortrag:
„Wechselströme höherer Frequenz“ beschäftigt
|
157
|
|
|
Apparat zur Demonstration der Wirbelströme (von oben
gesehen)
|
160
|
|
|
Derselbe von der Seite gesehen
|
160
|
|
|
Schema einer elektrischen Klingel
|
162
|
|
|
Spulmaschine
|
165
|
|
|
Schnitt durch einen einfachen Induktionsapparat
|
166
|
|
|
Einfacher Induktionsapparat von oben gesehen
|
167
|
|
|
Induktor mit verschiebbarer sekundärer Rolle
|
168
|
|
|
Schaltungsschema des Kondensators
|
169
|
|
|
Lage der Stanniolblätter mit ihren Ansätzen
|
170
|
|
|
Der fertige Kondensator
|
170
|
|
|
Schnitt durch die Rolle eines Funkeninduktors
|
172
|
|
|
Befestigung der Induktorrolle
|
173
|
|
|
Spulmaschine für den Funkeninduktor
|
174
|
|
|
Verbindung der einzelnen Spulen
|
176
|
|
|
Verbindung zweier Spulen
|
177
|
|
|
Kartonkamm zum Einrichten der Spulen
|
177
|
|
|
Schematischer Schnitt durch einen großen
Funkeninduktor
|
179
|
|
|
Kommutator (Horizontalschnitt)
|
180
|
|
|
Kommutator (Vertikalschnitt)
|
180
|
|
|
Befestigung der Achse des Kommutators
|
181
|
|
|
Einfacher Unterbrecher
|
183
|
|
|
Quecksilberunterbrecher
|
184
|
|
|
Träger des Hebels zum Quecksilberunterbrecher
|
184
|
|
|
Kurve eines einfachen Wechselstromes
|
187
|
|
|
Kurve eines Induktorstromes
|
187
|
|
|
Wheatstonesche Brücke
|
189
|
|
|
Schema zum Versuch mit dem zweiphasigen
Wechselstrome
|
191
|
|
|
Eisenring mit Magnetnadel
|
191
|
|
|
Magnetisches Drehfeld
|
192
|
|
|
Kurve der aus zwei Wechselströmen mit verschiedener
Phase entstehenden Resultante
|
194
|
|
|
Dreiphasiger Wechselstrom
|
194
|
|
|
Die drei Spulenpaare in Sternform geschaltet
|
195
|
|
|
Die drei Spulenpaare im Dreieck geschaltet
|
195
|
|
[S. 323]
|
Apparat zur Veranschaulichung eines Drehstromes
|
196
|
|
|
Kurzschlußanker
|
199
|
|
|
Schaltungsschema eines Transformators
|
199
|
|
|
Schema des ersten Telephons
|
200
|
|
|
Schema des Mikrophones
|
202
|
|
|
Schema einer Telephonanlage
|
203
|
|
|
Das Hitzdrahtinstrument
|
205
|
|
|
Lager für den Zeiger des Hitzdrahtinstrumentes
(Vertikalschnitt)
|
205
|
|
|
Dasselbe (Horizontalschnitt)
|
205
|
|
|
Zeiger für das Hitzdrahtinstrument
|
206
|
|
|
Das Elektrodynamometer
|
207
|
|
|
Trockenapparat für die Influenzmaschine
|
210
|
|
|
Schnitt durch die Vakuumpumpe
|
211
|
|
|
Der in einen Zweiwegehahn veränderte Gashahn
|
213
|
|
|
Der Rezipient als Entladungsröhre
|
215
|
|
|
Verbindung der Geißler-Röhre mit dem Rezipienten zum
Auspumpen
|
216
|
|
|
Einfache Röhre auf dem Rezipienten
|
217
|
|
|
Geißlersche Röhren, ungefüllt
|
217
|
|
|
Geißlersche Röhren. Zu füllen mit fluoreszierenden
Flüssigkeiten
|
218
|
|
|
Hittorfsche (Crookessche) Röhre
|
218
|
|
|
Crookessche Röhre
|
219
|
|
|
Röntgenröhren
|
222
|
|
|
Influenzmaschine und Röntgenröhre
|
223
|
|
|
Hand, von Röntgenstrahlen durchleuchtet
|
224
|
|
|
Schnitt durch den Lichtschutzschirm
|
228
|
|
|
U-Röhre zur
Versinnlichung elektrischer Oszillation
|
232
|
|
|
Der Drehspiegel
|
233
|
|
|
Schema des Hertzschen Wellenversuches
|
236
|
|
|
Der Fritter (Schema)
|
236
|
|
|
Der Fritter
|
237
|
|
|
Der Fritter
|
237
|
|
|
Leidener Flaschen für Resonanzversuche
|
241
|
|
|
Resonanzpendel
|
243
|
|
|
Interferenz zweier Wellenzüge
|
245
|
|
|
Interferenzrohr
|
245
|
|
|
Blechkasten für den Funkeninduktor
|
246
|
|
|
Interferenzrohr
|
247
|
|
|
Fritter mit Glocke und Schüttelvorrichtung
|
248
|
|
|
Schema zum Reflexionsversuch
|
250
|
|
|
Der Sender
|
252
|
|
|
Bifilare Wickelung
|
253
|
|
|
Anordnung der Apparate zur drahtlosen Telegraphie
|
254
|
|
|
Schaltungsschema des Teslatransformators
|
258
|
|
|
Teslatransformator (Schnitt)
|
259
|
|
|
Teslatransformator (Seitenansicht)
|
259
|
|
[S. 324]
|
Funkenmikrometer, Querschnitt und von der Seite
gesehen
|
263
|
|
|
Teslascher Transformator
|
264
|
|
|
Zu Versuchen über Induktionserscheinungen
|
266
|
|
|
Versuche am Teslaschen Transformator
|
267
|
|
|
Lichterscheinungen zwischen zwei mit dem
Teslatransformator verbundenen Drahtkreisen
|
268
|
|
|
Zum ersten Teslaschen Glühlampenversuch
|
268
|
|
|
Zum zweiten Teslaschen Lampenversuch
|
269
|
|
|
Rudi an seinem Experimentiertisch
|
273
|
|
|
Kohlen zum Mikrophon
|
275
|
|
|
Mikrophon
|
275
|
|
|
Hufeisenmagnet für das Telephon
|
276
|
|
|
Zylinderende des Magneten
|
276
|
|
|
Spule
|
276
|
|
|
Die einzelnen Teile zum Telephon
|
279
|
|
|
Schnitt durch den Schallbecher
|
280
|
|
|
Schaltungsschema der Telephonanlage
|
282
|
|
|
Wirkungsschema der Telephonanlage
|
285
|
|
|
Graphitstäbe des Rheostaten mit ihren
Drahtansätzen
|
286
|
|
|
Der fertige Graphitrheostat
|
287
|
|
|
Befestigung des Kontakthebels
|
288
|
|
|
Widerstand für feine Regulierung
|
289
|
|
|
Nickelinrheostat
|
290
|
|
|
Glühlampenrheostat
|
290
|
|
|
Brett zum Wickeln der Spule
|
295
|
|
|
Befestigung der Spulen auf dem Grundbrett
|
297
|
|
|
Fassungsstück (Schnitt)
|
298
|
|
|
Fassungsstück (Außenansicht)
|
298
|
|
|
Fertiger Anker (Ansicht)
|
300
|
|
|
Einfachere Lagerung
|
301
|
|
|
Lagerung mit einem Blechstreifen
|
302
|
|
|
Die Platte des Stöpselkontaktes
|
303
|
|
|
Schema zum Stöpselkontakt
|
303
|
|
|
Elektroskop
|
306
|
|
|
Schaltungsschema der Apparate für drahtlose
Telegraphie
|
308
|
|
|
Schaltung mit zwei Kondensatoren
|
309
|
|
|
Verstellbarer Kondensator
|
311
|
|
|
Kraftmaschine mit Gewicht
|
312
|
|
|
Rudis selbstgefertigte Apparate
|
313
|

Union Deutsche Verlagsgesellschaft in
Stuttgart, Berlin, Leipzig.
Von dem Verfasser vorliegenden Buches erschien ferner
in unserem Verlage:
Werkbuch fürs Haus.
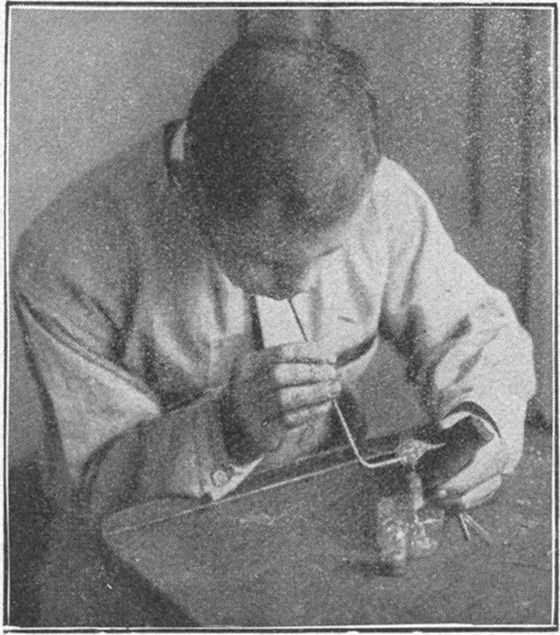
Löten mit dem Lötrohr.
EineAnleitung zur Handfertigkeit für Bastler.
6.-9. Auflage.
Mit 409 Abbildungen.
Praktisch geb. 5 Mark.
Das Buch erweist sich als ein Ratgeber für alle Fälle des häuslichen
Lebens, wo es auf praktische Handfertigkeit ankommt, und wer darauf
das Sachverzeichnis durchsieht, wird kaum in Verlegenheit geraten. Für
Knaben ist es ein sehr empfehlenswertes Geschenk, das obendrein auch
den Eltern von Nutzen sein wird.
Hamburger Nachrichten.
Aus unseren
Illustrierten Taschenbüchern für
die Jugend
seien nachstehende, dem Gebiete der Elektrotechnik
angehörende Bände besonders empfohlen:
Der junge Elektrotechniker.
Galvanische Elemente und Akkumulatoren.
Mit 144 Abbildungen 43.-47. Tausend.
Mit 57 Abbildungen. 10. Tausend.
Das Buch erklärt die Wunder der Elektrizität und des Magnetismus
und leitet zu elektrotechnischen Beschäftigungen, zur Selbstanfertigung
elektrischer Apparate usw. an.
Inhalt: Einleitung. Kleines elektrisches
Kabinett. Berührungselektrizität. Induktionsapparate und Elektromotoren.
Die Dynamomaschine. Die Elektrizität im Hause.
Eine Anleitung zur Selbstanfertigung und Verwendung von Elementen
und Akkumulatoren und sonst wirklich brauchbaren Stromerzeugern.
Inhalt: Elektromotorische Kraft und
Polarisation. Vom Ohmschen Gesetz. Elemente mit einer Flüssigkeit.
Grove- und Bunsen-Element. Das Daniell-Element u. seine Verbesserungen.
Elemente mit festem Depolarisator. Die Akkumulatoren. Die
Selbstanfertigung der Akkumulatoren. Die Selbstherstellung von
Primärelementen. Das Laden von Akkumulatoren.
Illustriertes Verzeichnis der ganzen Sammlung der
„Illustrierten Taschenbücher“ von der Verlagshandlung kostenlos.
Zu haben in allen Buchhandlungen.
Union Deutsche Verlagsgesellschaft in
Stuttgart, Berlin, Leipzig.
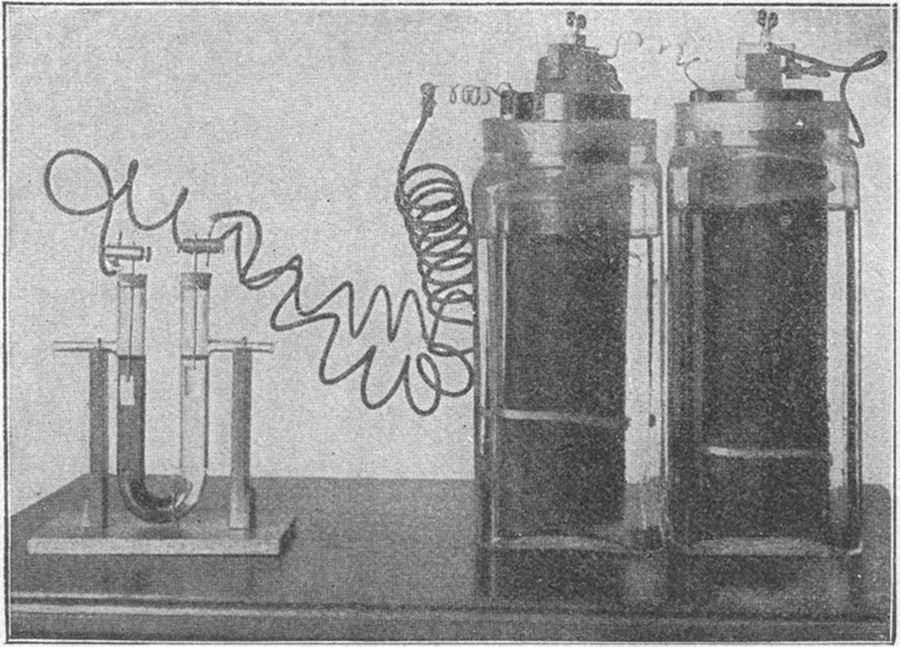
Experiment über farbige Zersetzung.
Physikalisches Experimentierbuch für Knaben.
Eine Anleitung zur Ausführung physikalischer Experimente und zur
Selbstanfertigung der hierzu nötigen Apparate. Von Richard
Beißwanger. 2.–6. Auflage. Mit 216 Abbildungen. Elegant gebunden 4
Mark.
Wie könnte es wohl etwas Schöneres für Kinder geben, als eine
Beschäftigung, die belehrend wirkt, und die gleichsam den Unterricht
in der Schule ergänzt und vertieft! Der Inhalt dieses schönen Buches
gibt dem Knaben Gelegenheit, selbst Versuche anzustellen, und zwar
mit einfachen oder mit selbstangefertigten Apparaten. Die Anweisung
dazu ist immer sehr instruktiv, so daß es nicht schwer ist, danach
den gewünschten Apparat herzustellen. Auf diese Weise wird der
Arbeitsunterricht, der heute von den Pädagogen sehr betont wird, für
den physikalischen Unterricht mit Leichtigkeit eingeführt. Wir können
allen Eltern, die noch nicht wissen, was sie ihren heranwachsenden
Knaben schenken sollen, dies herrliche Buch empfehlen.
Neue Pädagog. Zeitung, Magdeburg.
Amüsante Wissenschaft.
Belehrende und unterhaltende Experimente für jung und alt. Von
Hans Dominik. 6.–8. Auflage. Mit 213 Abbildungen. Elegant gebunden 4
Mark 50 Pf.
... Es läßt sich kaum ein passenderes Geschenk für einen Schüler
denken, als diese „Amüsante Wissenschaft“, die, wie der Titel besagt,
Wissenschaft und Geschicklichkeit dem Spiel dienstbar macht.
Straßburger Post.
Zu haben in allen Buchhandlungen.
Union Deutsche Verlagsgesellschaft in
Stuttgart, Berlin, Leipzig.
Selbst ist der Mann.
Ein neues Beschäftigungsbuch bei Sonnenschein und Regenwetter. Von
Maximilian Kern. 9.–11. Auflage. Mit 441 Abbildungen und 4
mehrfarbigen Beilagen. Elegant gebunden 5 Mark.
Das Buch gibt Anweisung zur Fertigung von allerlei hübschen Geschenken
für Eltern und Geschwister, lehrt Burgen, Puppenmöbel, Schießscheiben,
Drachen, Schiffe, Wasserräder, Taubenschläge, Nistkästen machen und
leitet auch zu einfachen Gartenarbeiten usw. an.
Staatsanzeiger, Stuttgart.
Das Neue Universum.
Die interessantesten Erfindungen und Entdeckungen auf allen Gebieten,
sowie Reiseschilderungen, Erzählungen, Jagden und Abenteuer. Ein
Jahrbuch für Haus und Familie, besonders für die reifere Jugend. Mit
einem Anhang zur Selbstbeschäftigung: „Häusliche Werkstatt“. 474 Seiten
Text mit etwa 500 Abbildungen und Beilagen. Elegant gebunden 6 Mark 75
Pf.
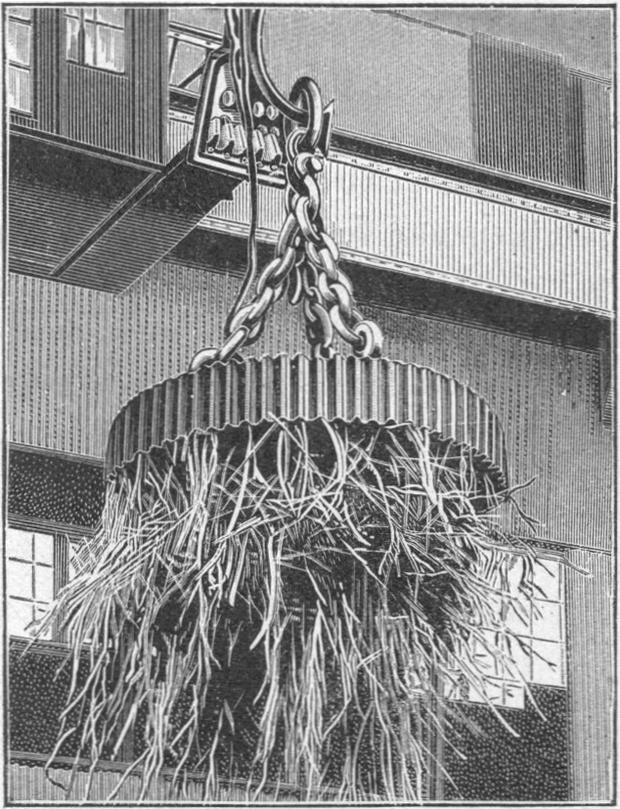
Der Elektromagnet als Sammler auch der kleinsten
Eisenteile.
Erfindungen und Entdeckungen stehen im Vordergrunde bei diesem
prächtigen Jugendbuche, das seinem Namen in seltener Weise Ehre macht.
Eine kurze Andeutung des Reichtums an Wort und Bild ist nicht möglich.
Bauwerke, Maschinenwesen, Marine, Astronomie und Völkerkunde — überall
weiß das Universum rasch und klar das Neueste zu berichten und läßt uns
nicht eher los, als bis wir den stattlichen Schmuckband bis zum Ende
kennen. Die Jugend aber vermag es dauernd zu bannen und zu beschäftigen
durch die „Häusliche Werkstatt“, der Selbstbeschäftigung, eine edle
Anregung, eigner Denkkraft eine schätzenswerte Förderung ...
Tägliche Rundschau, Berlin.
Zu haben in allen Buchhandlungen.
Illustrierter Katalog vortrefflicher Jugendschriften und
Geschenkbücher von der Verlagshandlung kostenfrei.
FERDINAND GROSS
50 Olgastraße 50
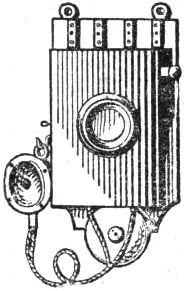
|
STUTTGART.
|
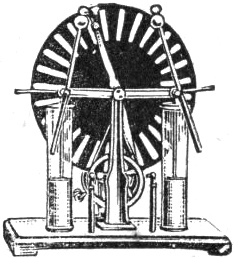
|
|
══════▽══════
|
|
Grösstes Spezialgeschäft
|
|
Physikalisch-
|
|
Elektrischer Apparate
|
|
zu Schüler-Versuchen.
|
Influenzmaschinen mit Experimentierkasten
Elektrisier- und Ruhmkorffapparate
Geißlerröhren — Glühlämpchen
Röntgen- und Tesla-Versuche — Telegraphie ohne Draht
Kleinbeleuchtungen
Elemente — Akkumulatoren
Taschenlampen und Batterien
Dynamomaschinen, Elektromotoren
Volt- und Ampèremeter
—— Schalttafeln ——
Sämtliche Bedarfsartikel zur Selbstanfertigung von
Versuchs-Apparaten.
Chemische Experimentierkasten
Läutewerke und Telephon-Apparate
Prachtkatalog C: Elektrische Apparate mit Anleitungen.
50 Pfennig.
Katalog D: Rohguß zu Dynamo- und Dampfmaschinen, Gas- und
Benzinmotoren, Dampfkessel und Armaturen. 20 Pfennig.
= Bei Aufträgen von M. 5.— resp. M. 3.— Rückvergütung
der Kataloge. =
*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ELEKTROTECHNISCHES EXPERIMENTIERBUCH ***
Updated editions will replace the previous one—the old editions will
be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for an eBook, except by following
the terms of the trademark license, including paying royalties for use
of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for
copies of this eBook, complying with the trademark license is very
easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation
of derivative works, reports, performances and research. Project
Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may
do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected
by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark
license, especially commercial redistribution.
START: FULL LICENSE
THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK
To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase “Project
Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg™ License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.
Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg™ electronic works
1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg™
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg™ electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg™ electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person
or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.
1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg™ electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg™ electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg™
electronic works. See paragraph 1.E below.
1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the
Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg™ electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg™ mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg™
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg™ name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg™ License when
you share it without charge with others.
1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg™ work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country other than the United States.
1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:
1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg™ License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg™ work (any work
on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the
phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:
This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms
of the Project Gutenberg License included with this eBook or online
at
www.gutenberg.org. If you
are not located in the United States, you will have to check the laws
of the country where you are located before using this eBook.
1.E.2. If an individual Project Gutenberg™ electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase “Project
Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg™
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.3. If an individual Project Gutenberg™ electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg™ License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.
1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg™
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg™.
1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg™ License.
1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg™ work in a format
other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg™ website
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain
Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg™ License as specified in paragraph 1.E.1.
1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg™ works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.
1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg™ electronic works
provided that:
• You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
the use of Project Gutenberg™ works calculated using the method
you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
to the owner of the Project Gutenberg™ trademark, but he has
agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
within 60 days following each date on which you prepare (or are
legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
payments should be clearly marked as such and sent to the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation.”
• You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™
License. You must require such a user to return or destroy all
copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™
works.
• You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
receipt of the work.
• You comply with all other terms of this agreement for free
distribution of Project Gutenberg™ works.
1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of
the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set
forth in Section 3 below.
1.F.
1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.
1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right
of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.
1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.
1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.
1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg™
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg™ work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg™ work, and (c) any
Defect you cause.
Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg™
Project Gutenberg™ is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.
Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg™’s
goals and ensuring that the Project Gutenberg™ collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg™ and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation’s EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state’s laws.
The Foundation’s business office is located at 809 North 1500 West,
Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up
to date contact information can be found at the Foundation’s website
and official page at www.gutenberg.org/contact
Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread
public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine-readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.
The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state
visit
www.gutenberg.org/donate.
While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.
International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.
Please check the Project Gutenberg web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate
Section 5. General Information About Project Gutenberg™ electronic works
Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg™ concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg™ eBooks with only a loose network of
volunteer support.
Project Gutenberg™ eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.
Most people start at our website which has the main PG search
facility:
www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg™,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.
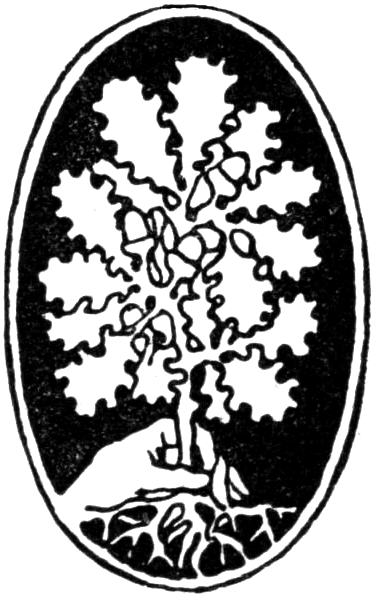
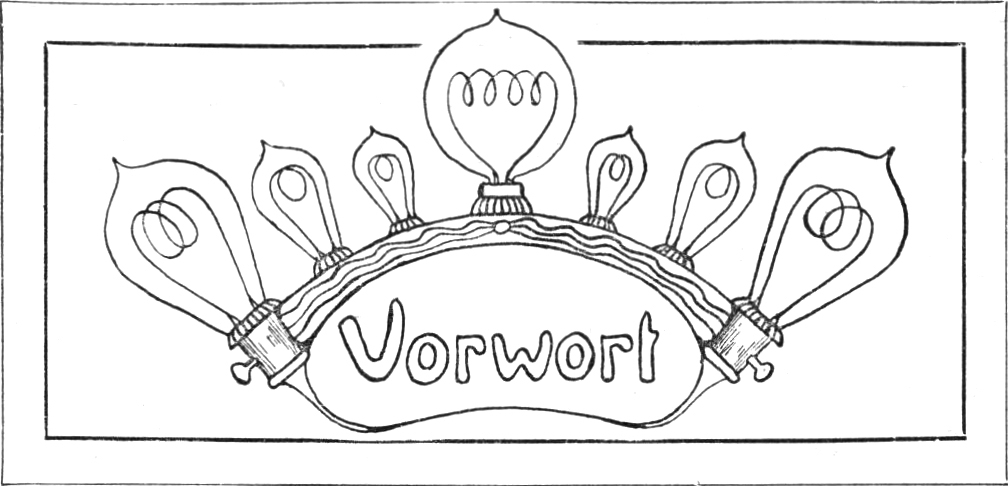



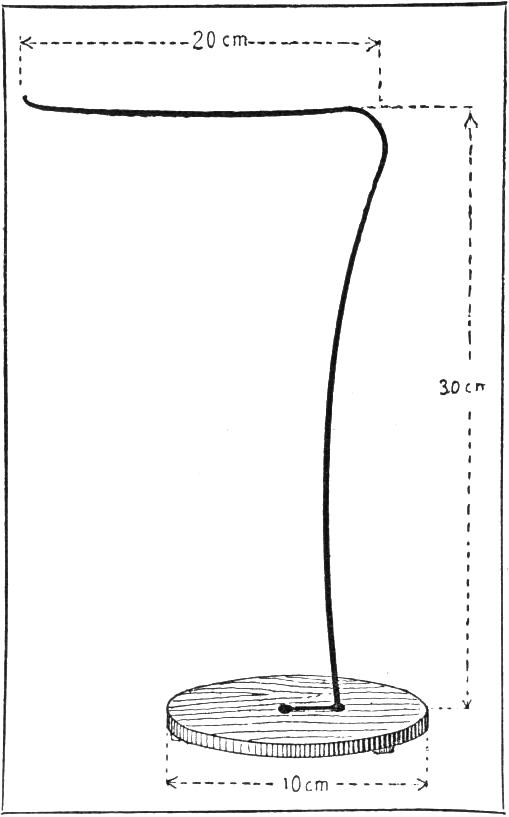
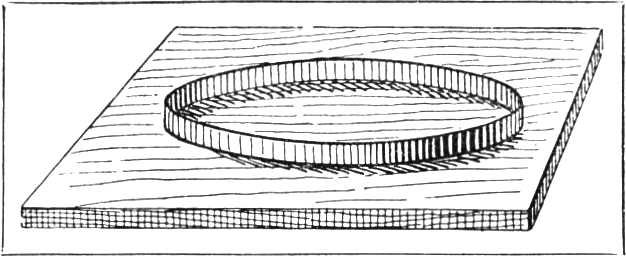
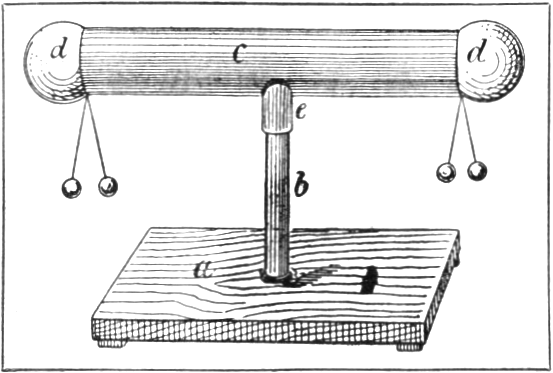
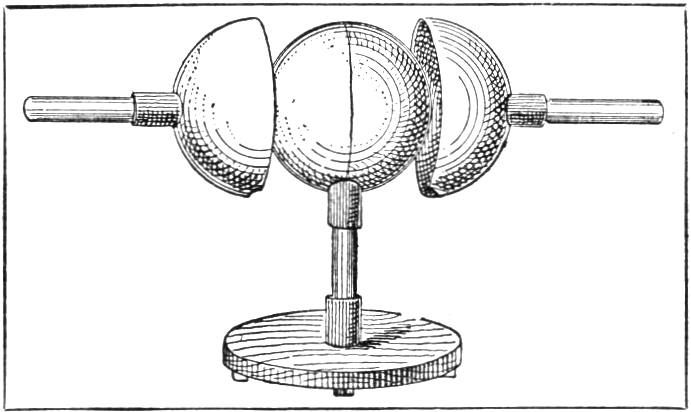
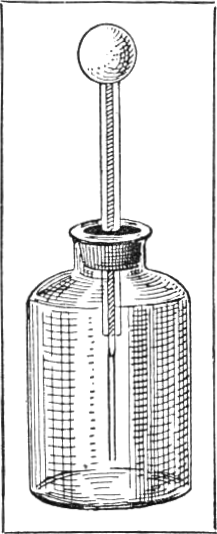
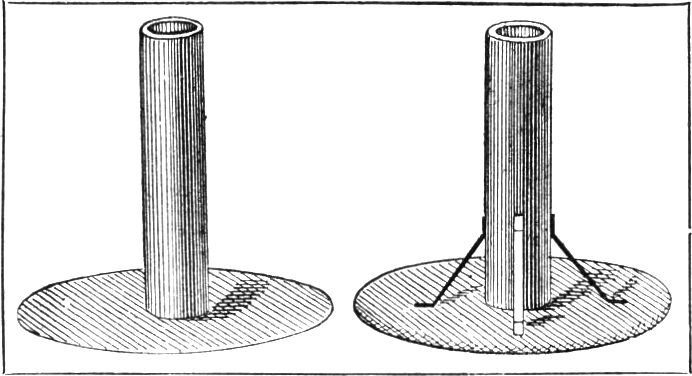
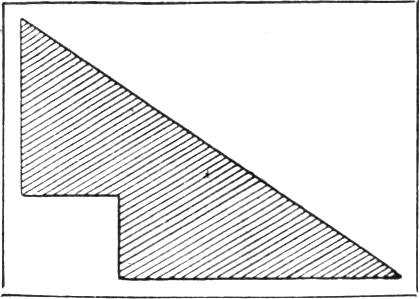
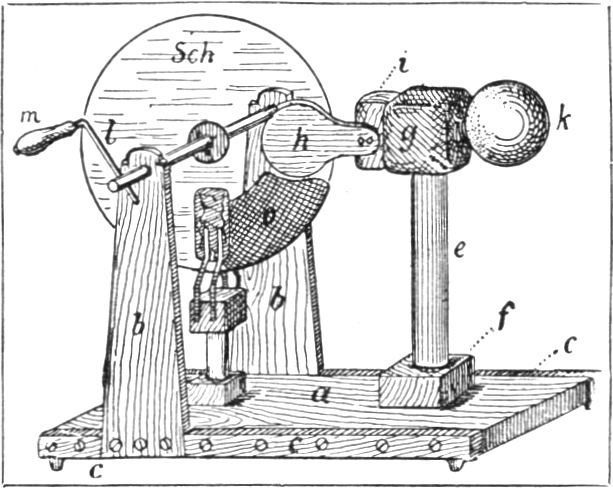
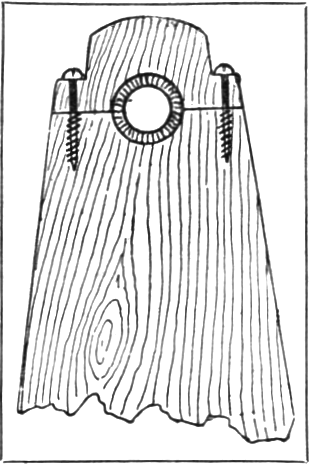
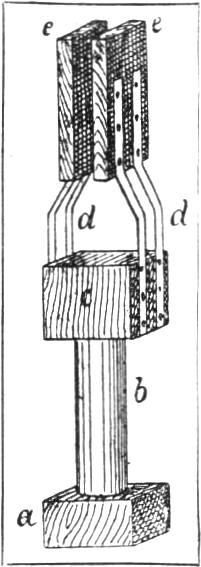
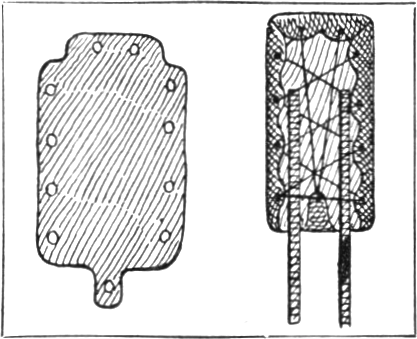
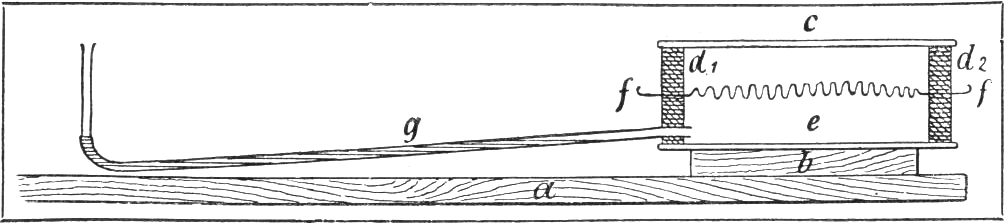
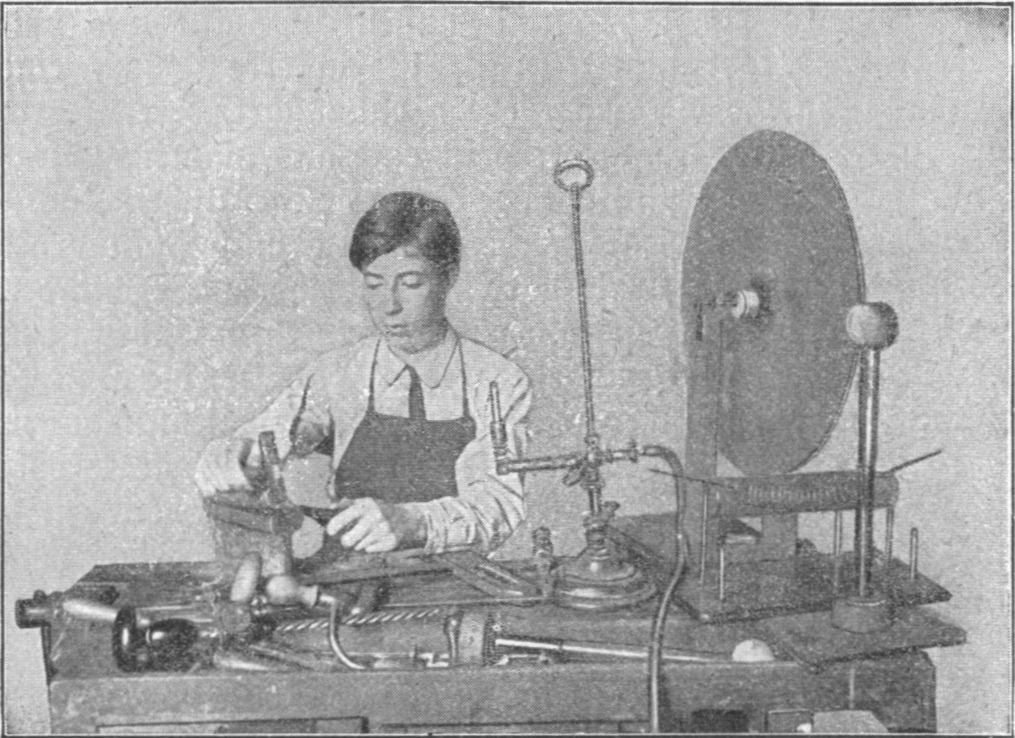
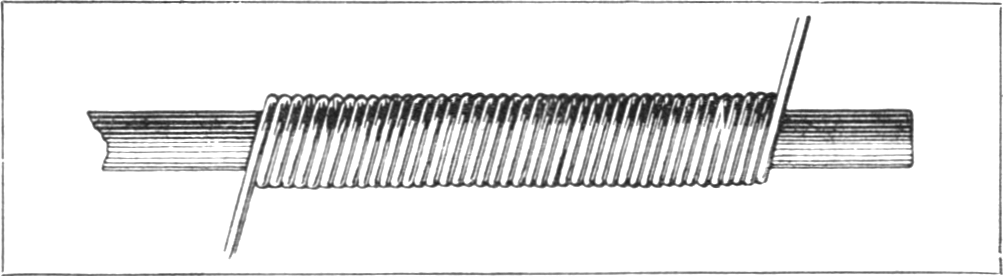
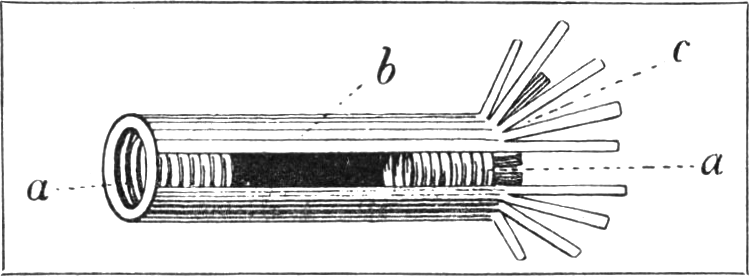
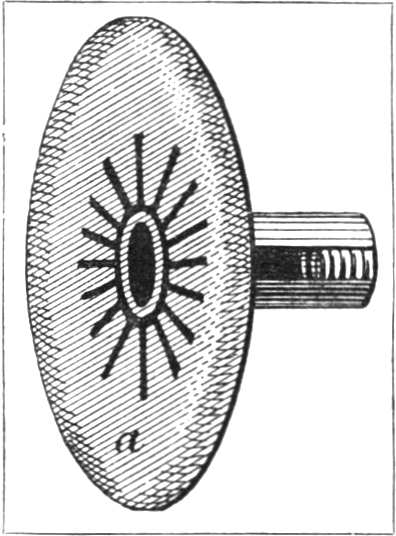
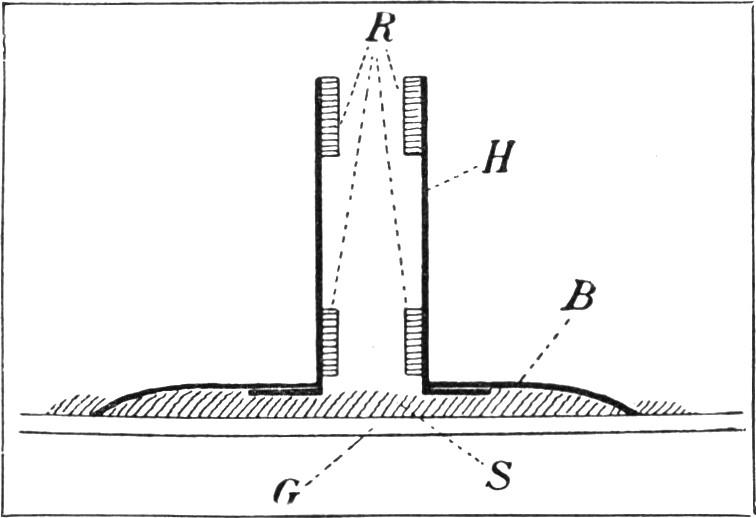
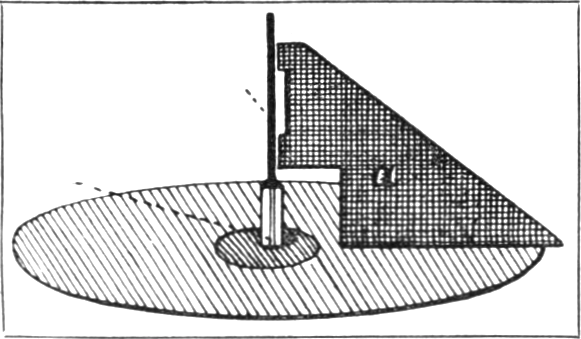
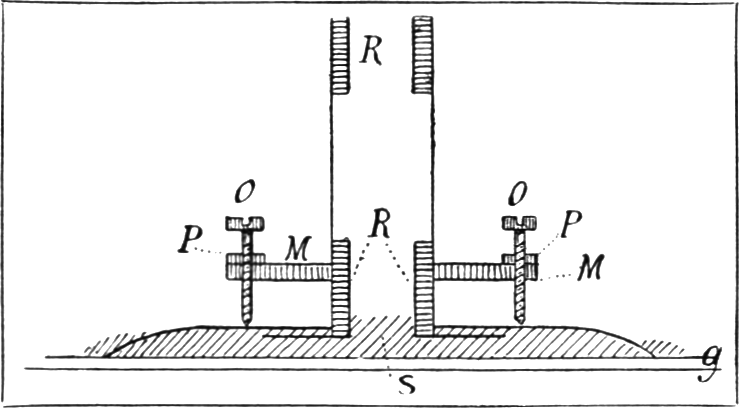
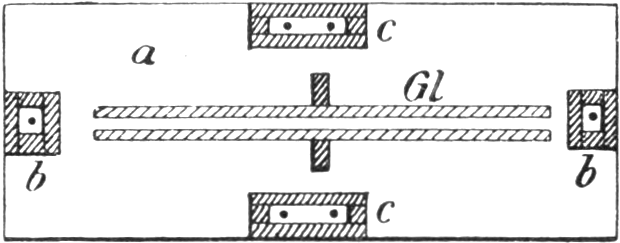
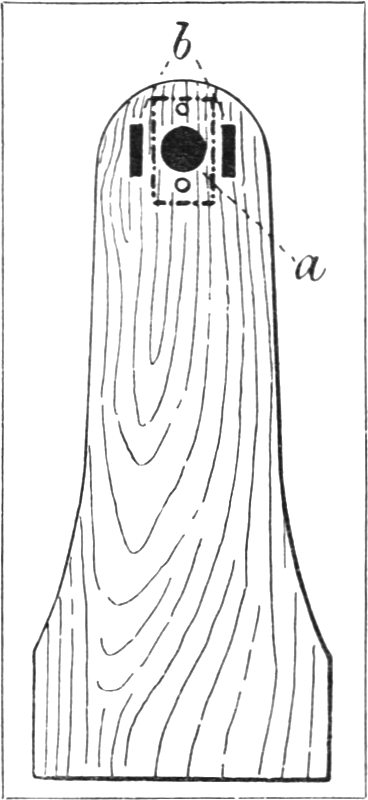
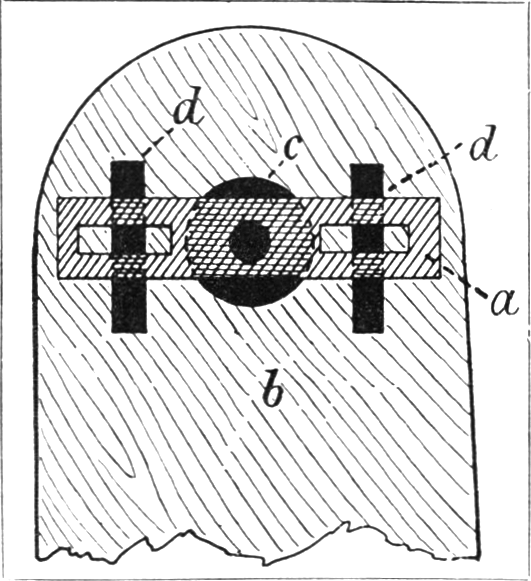
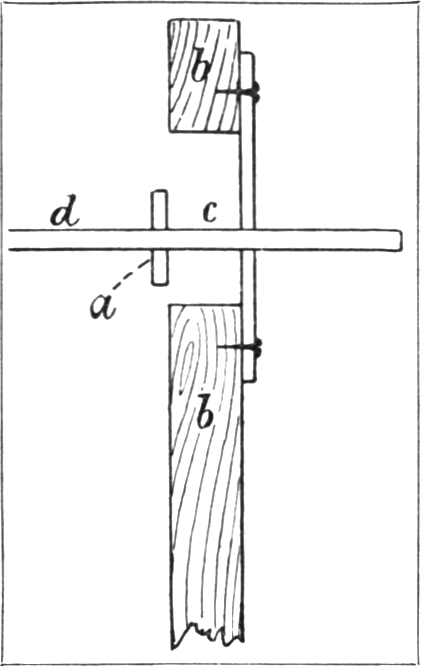
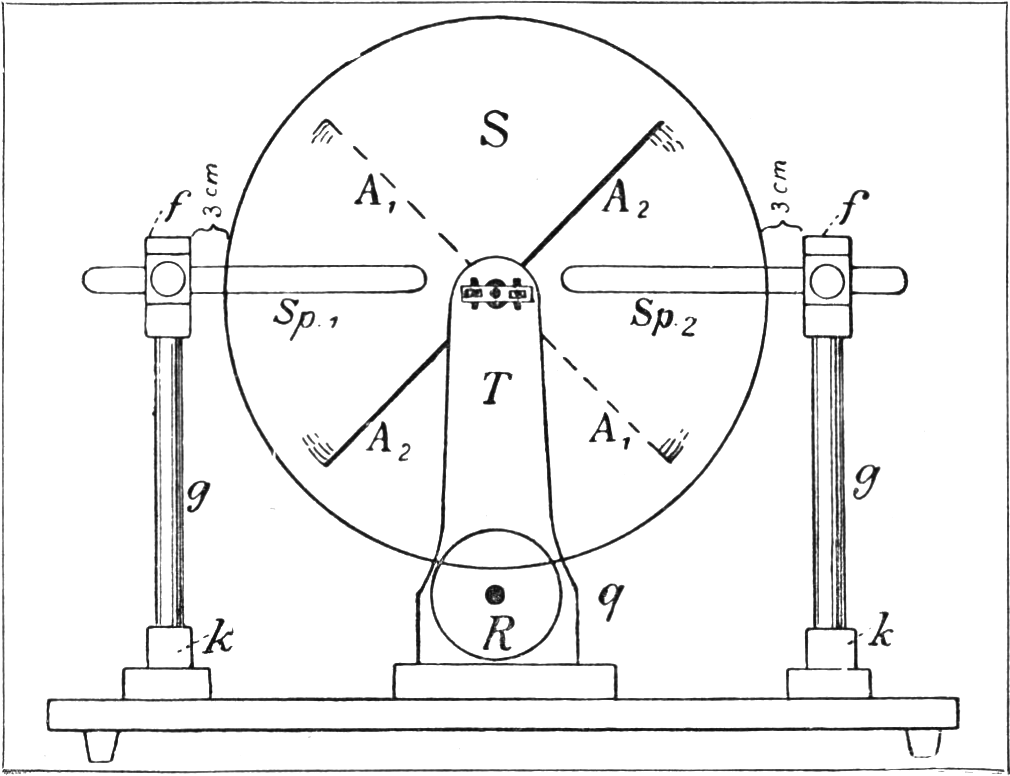
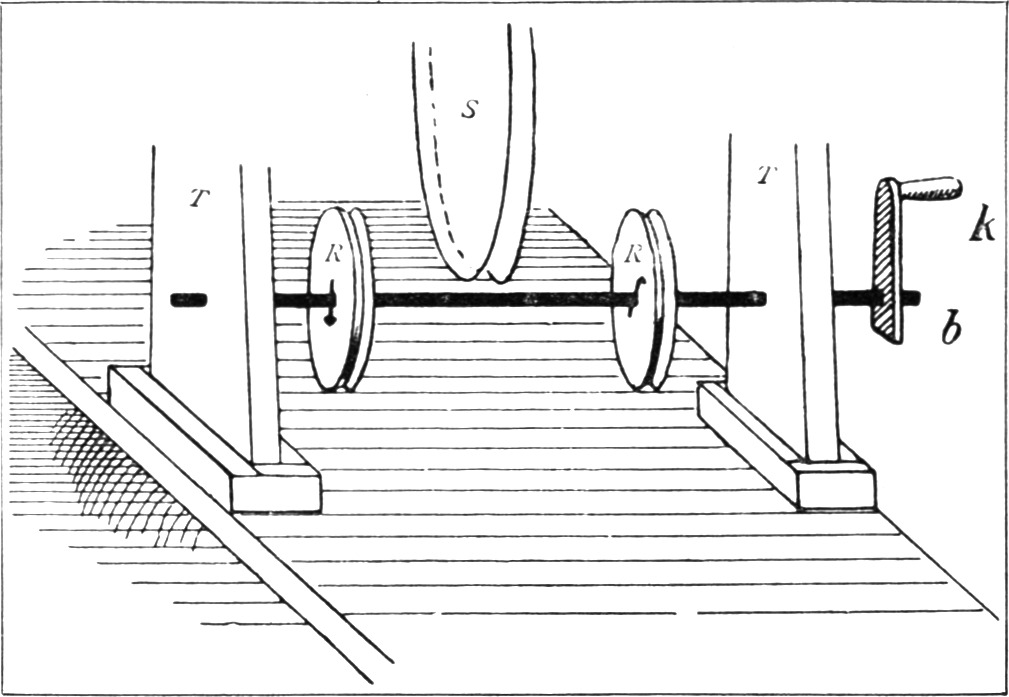
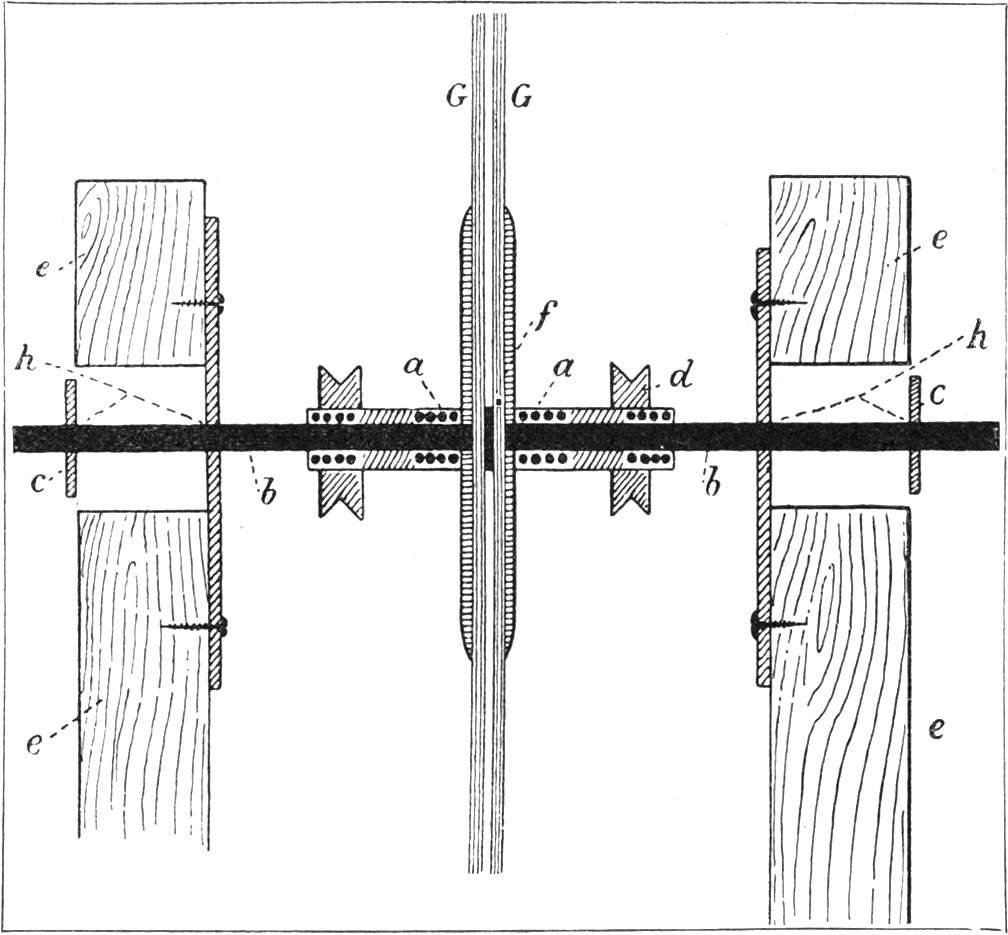
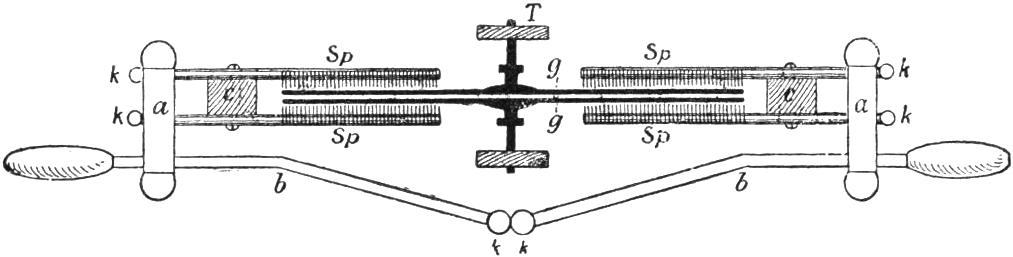
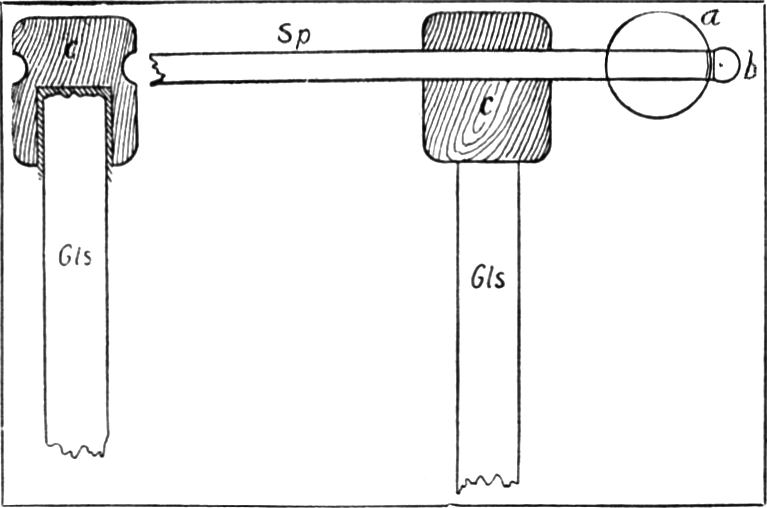
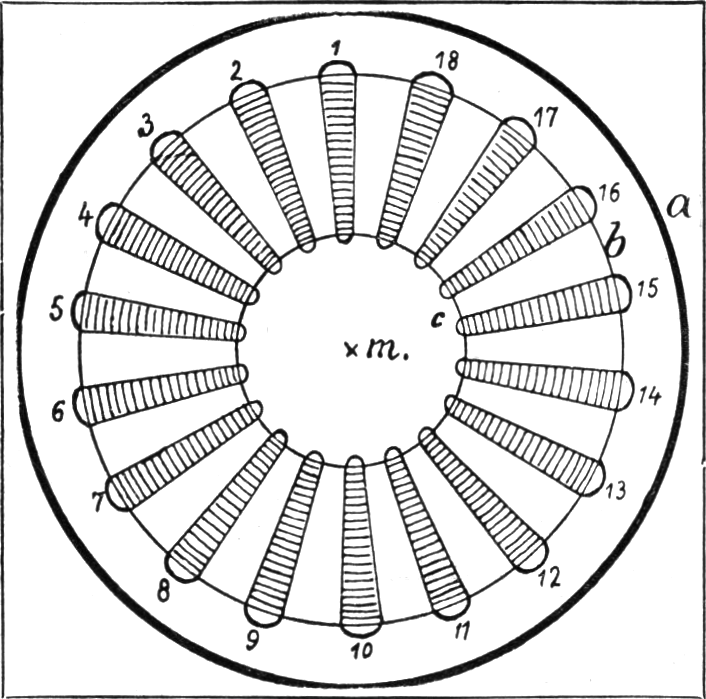
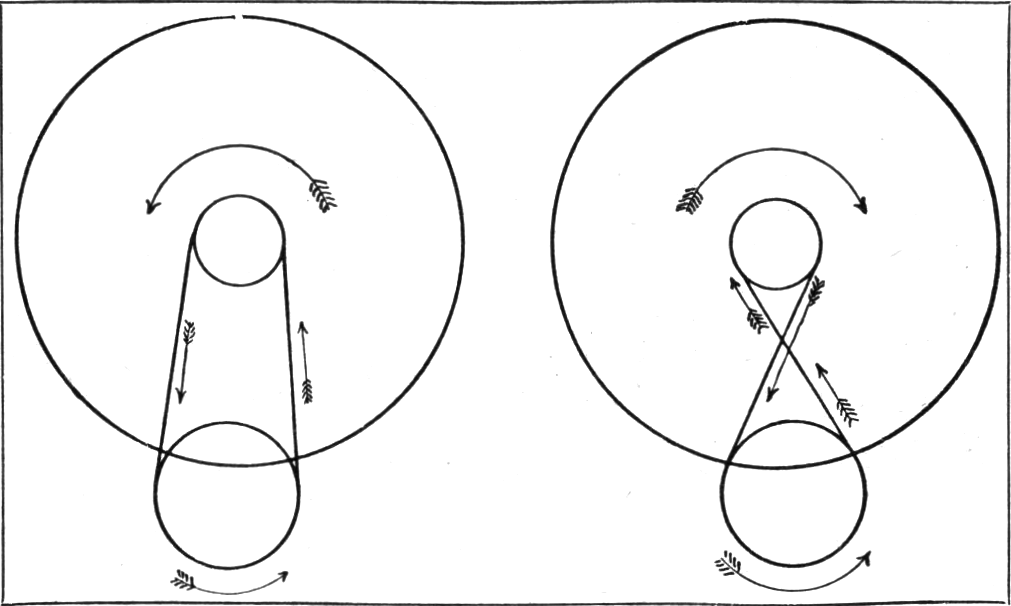
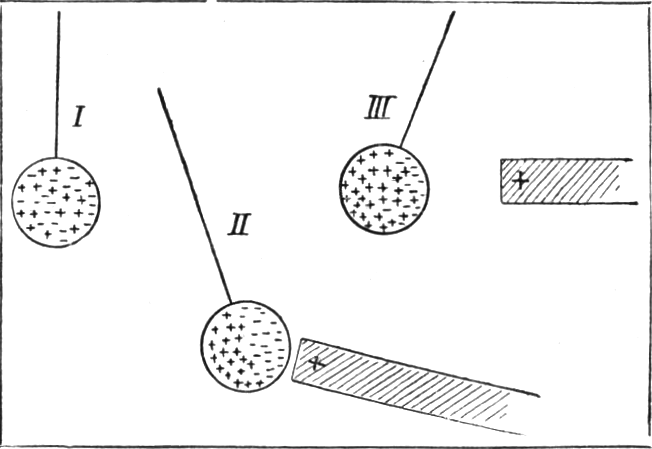
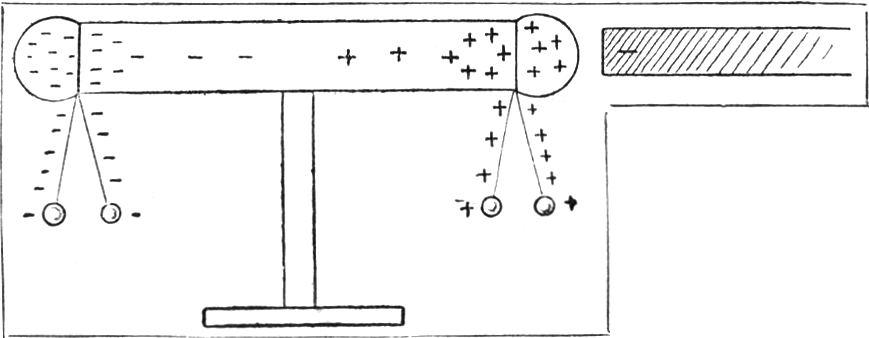
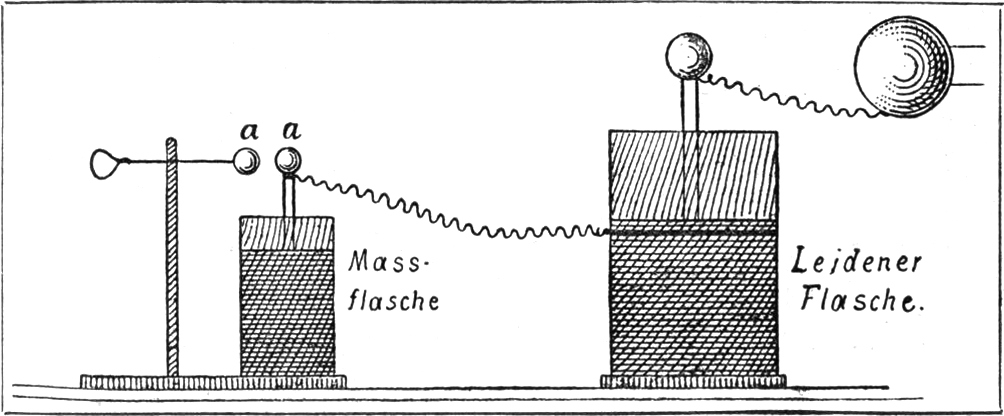
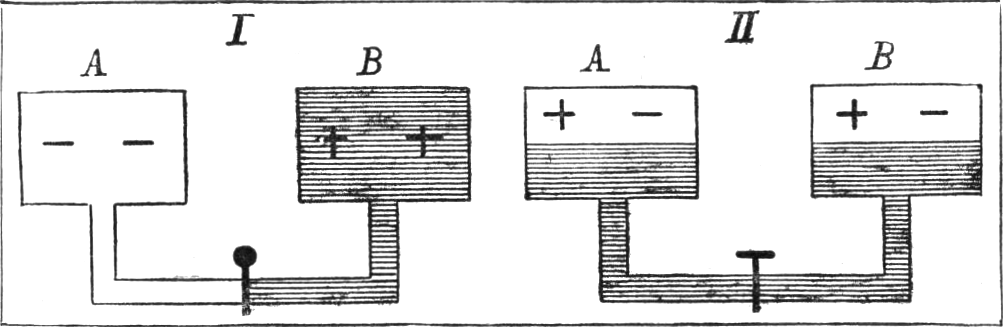


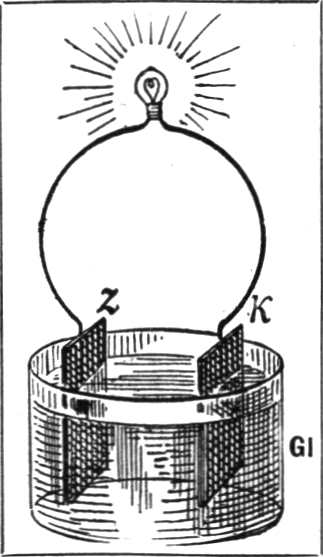
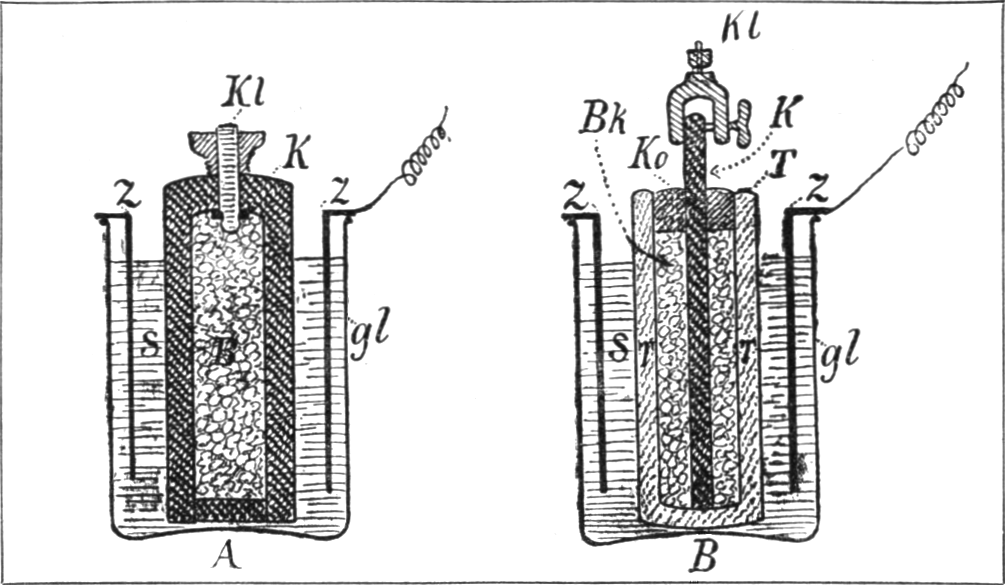
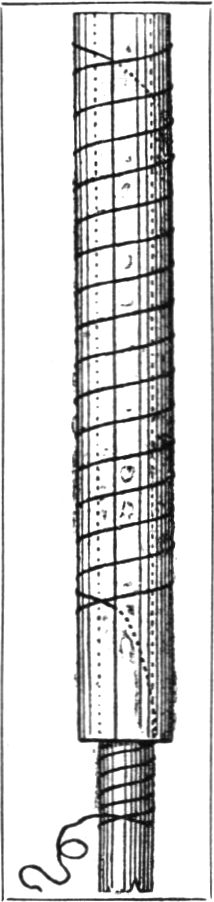
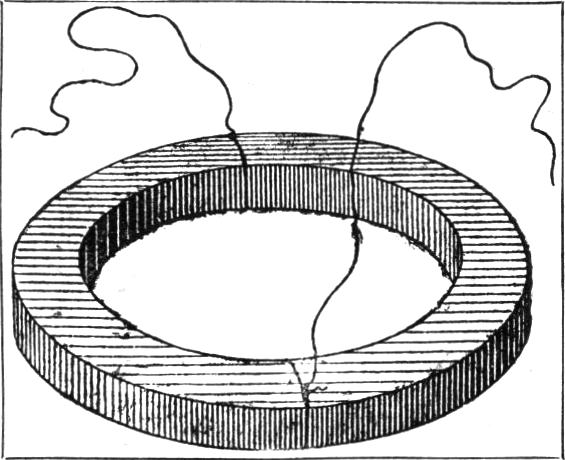
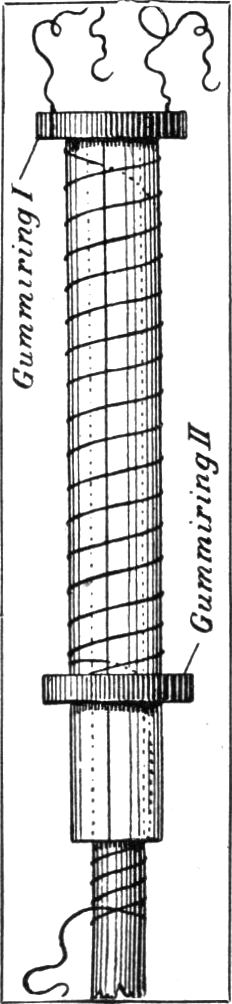
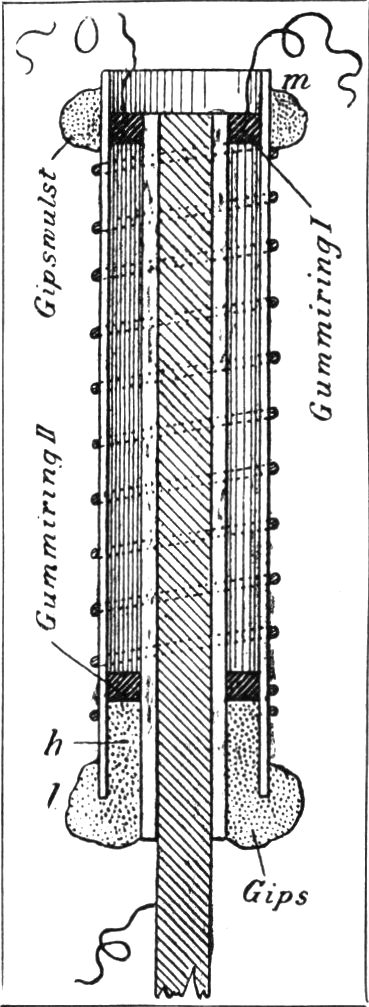
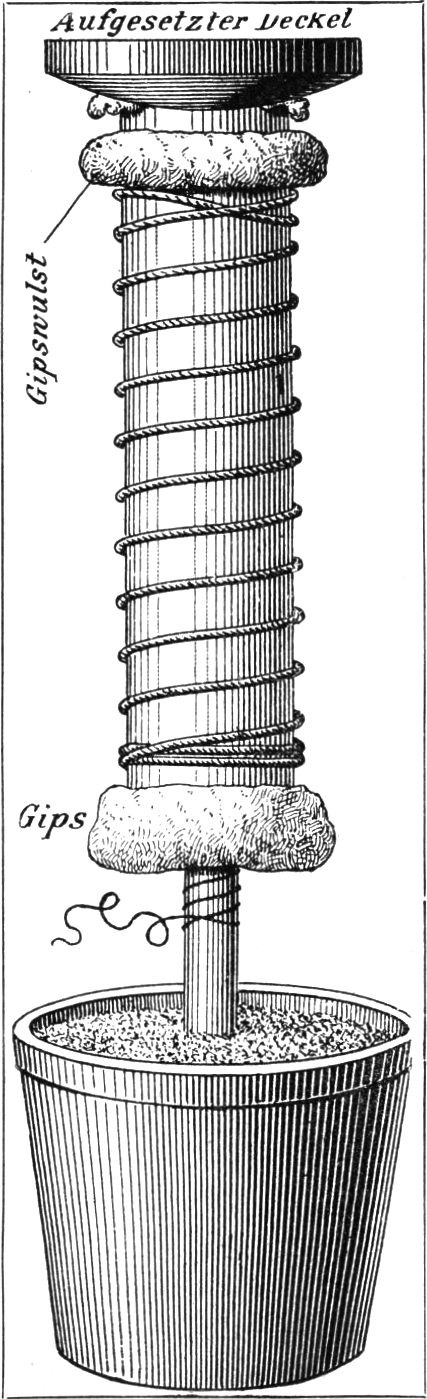
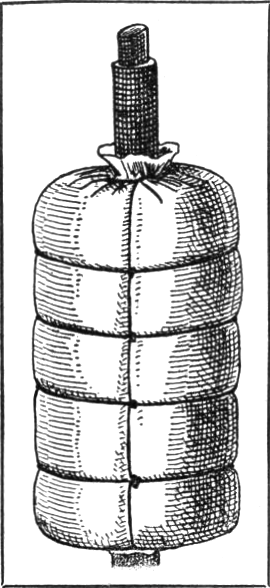
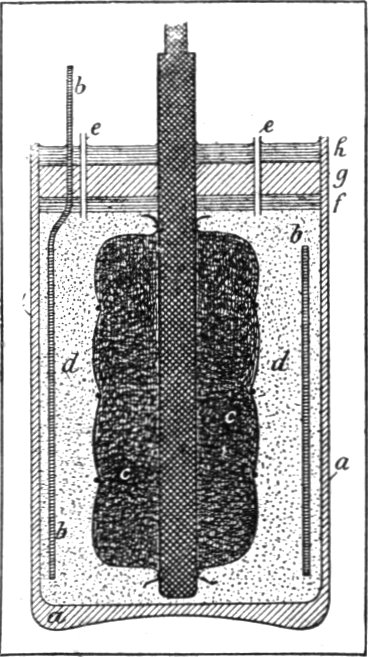
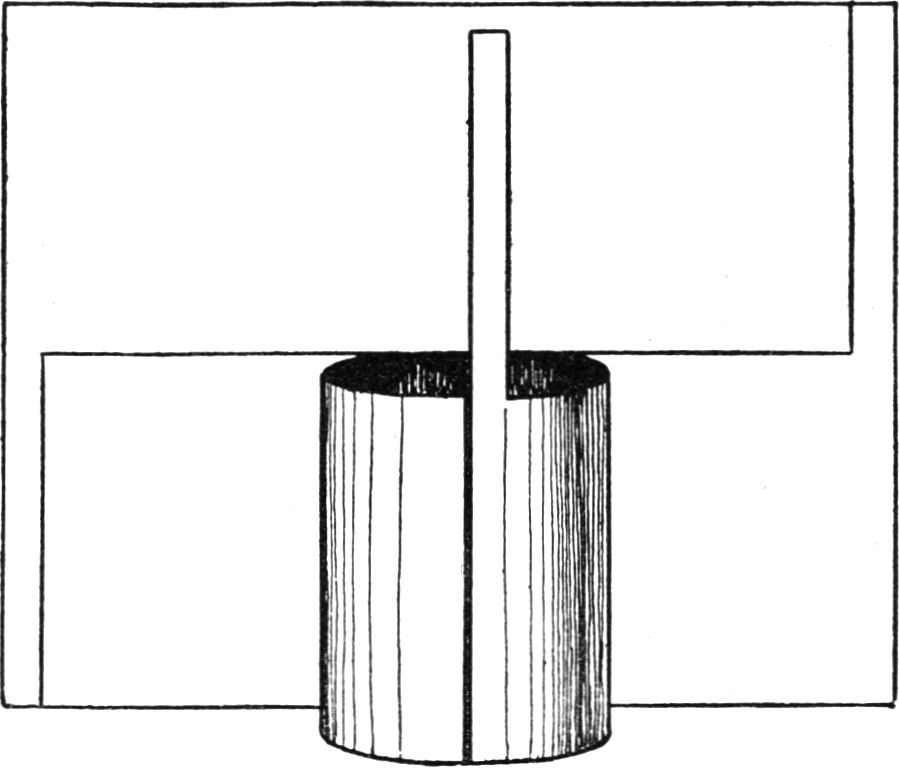
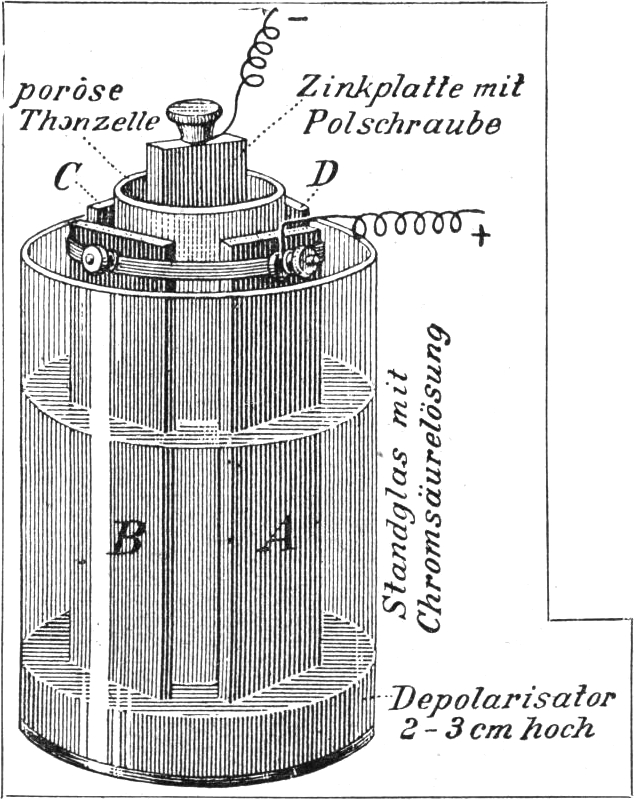
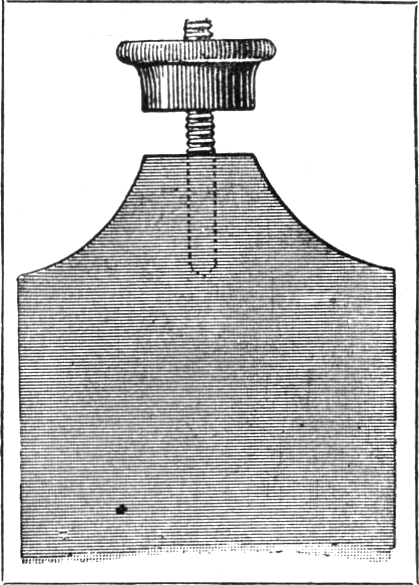
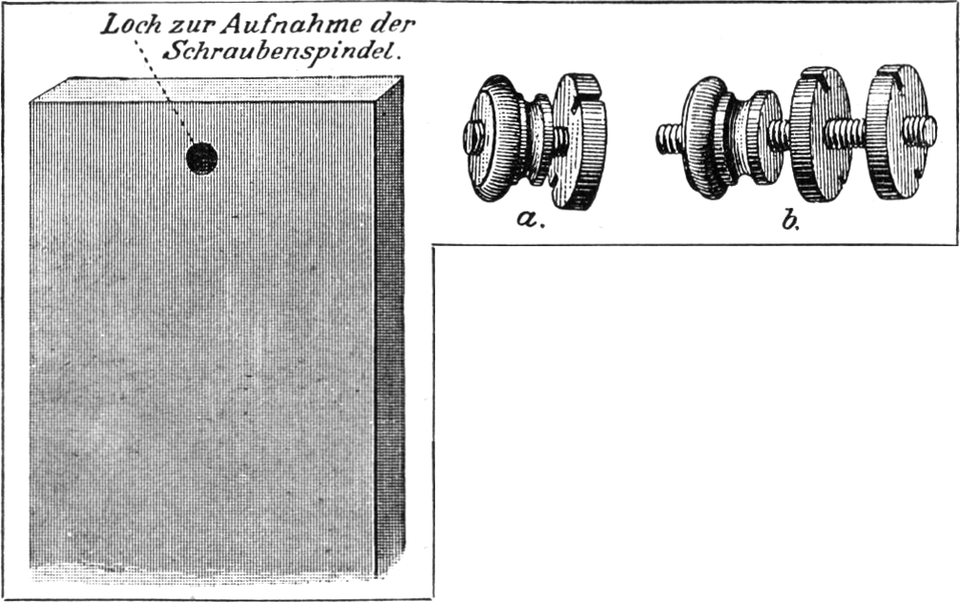
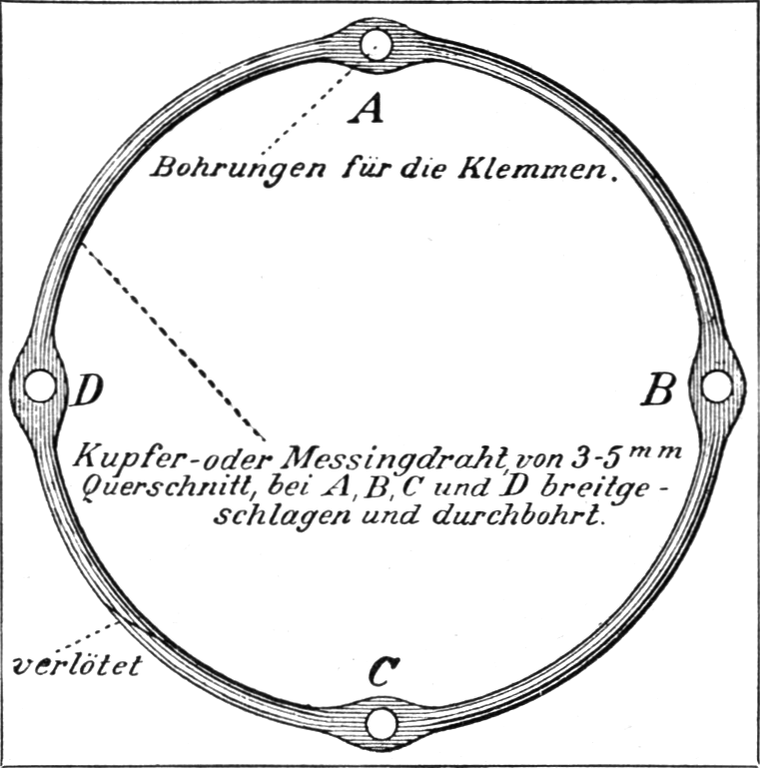
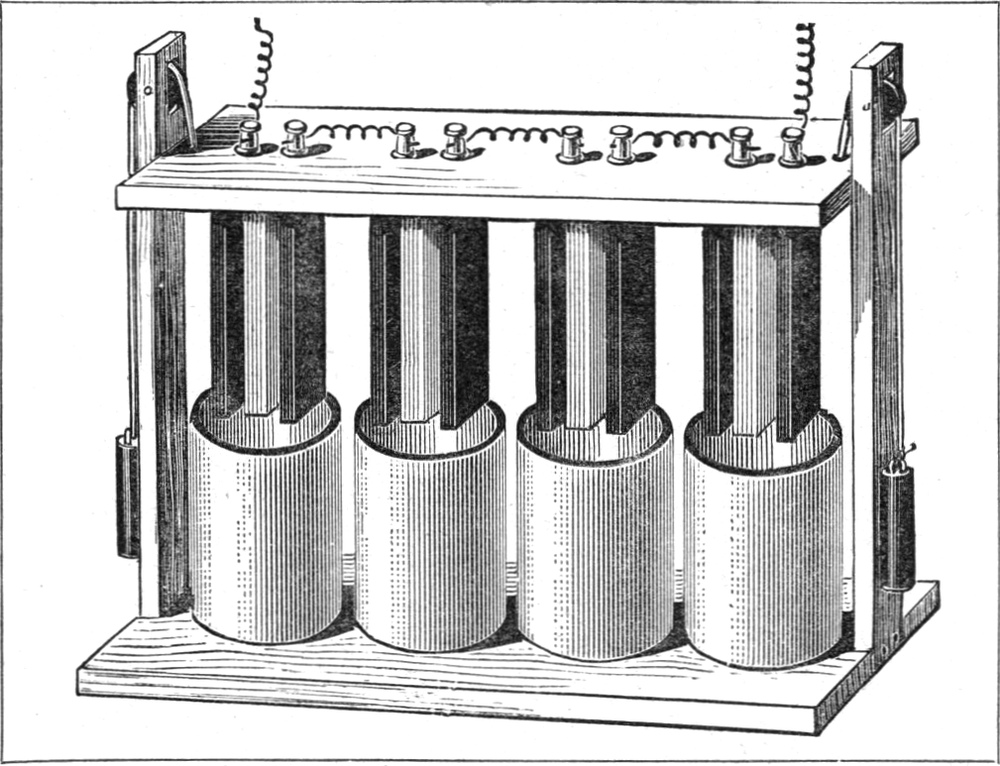
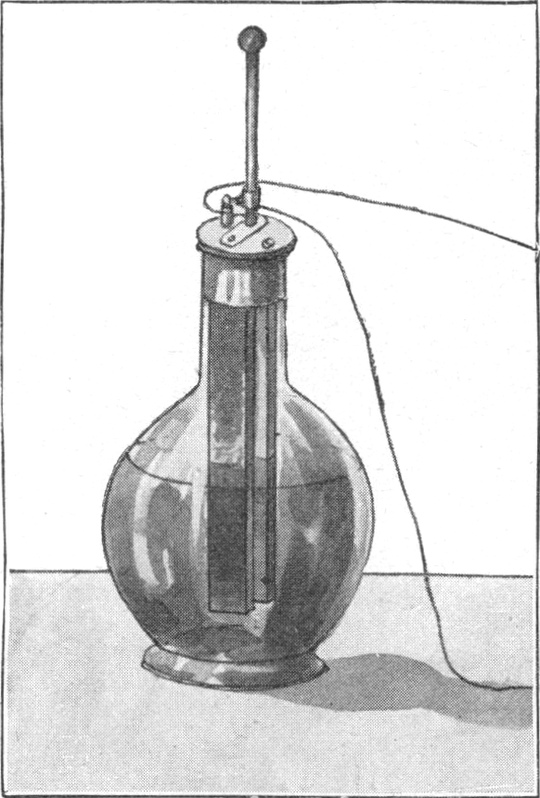
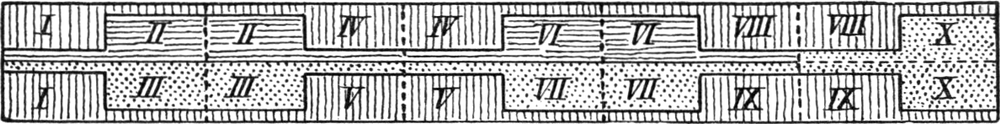
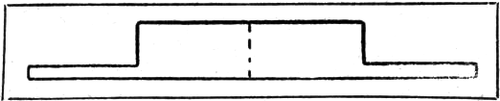
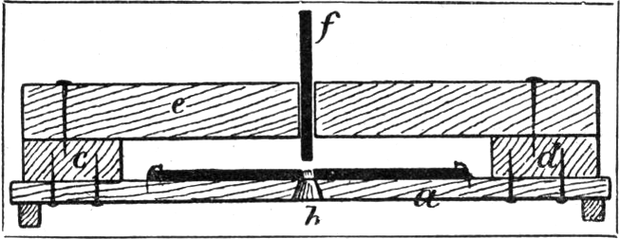
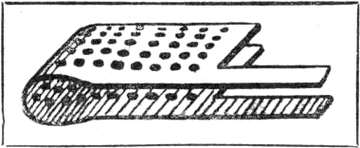
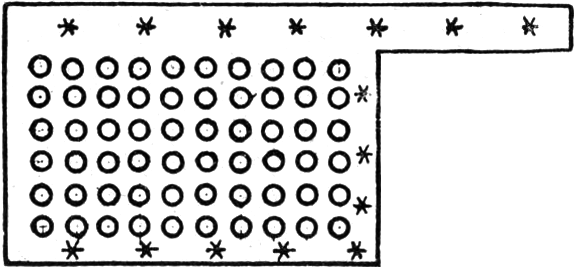
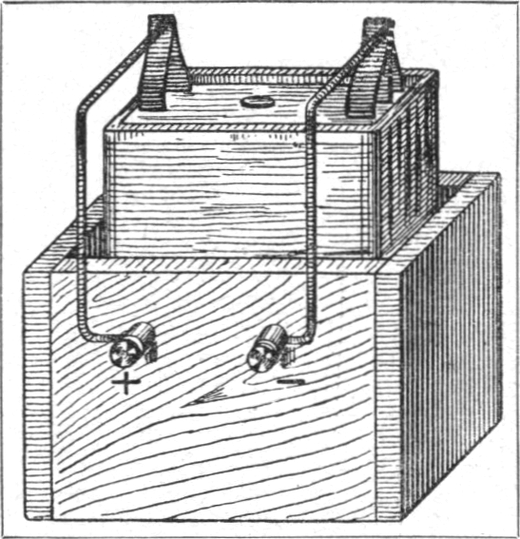
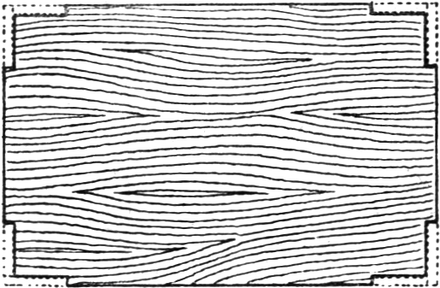
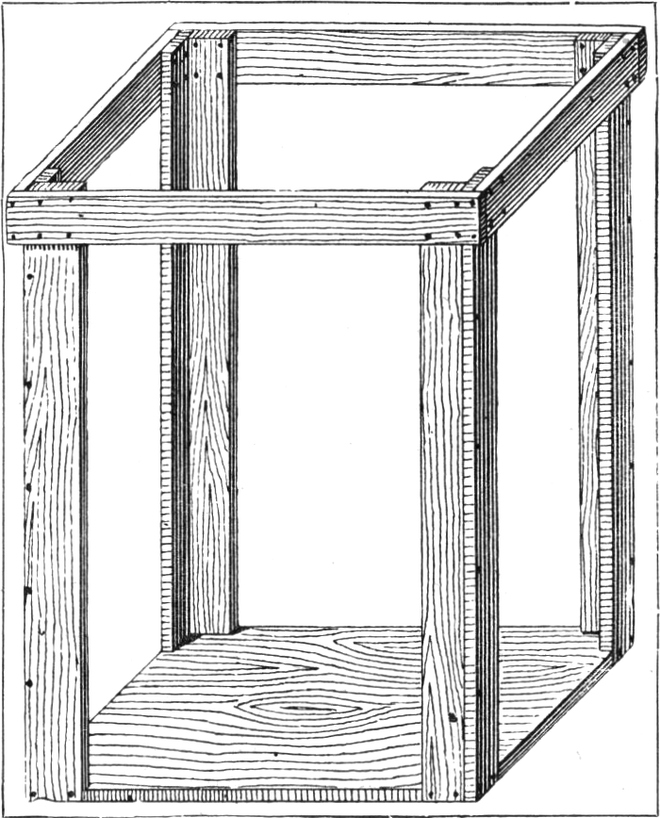
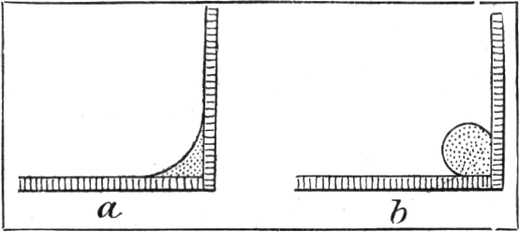
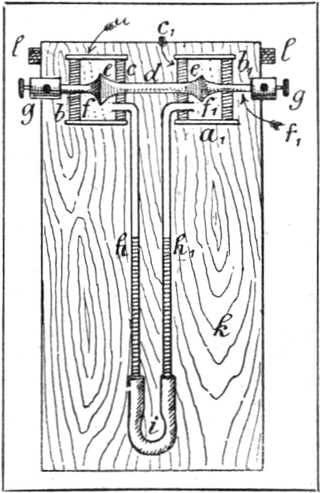
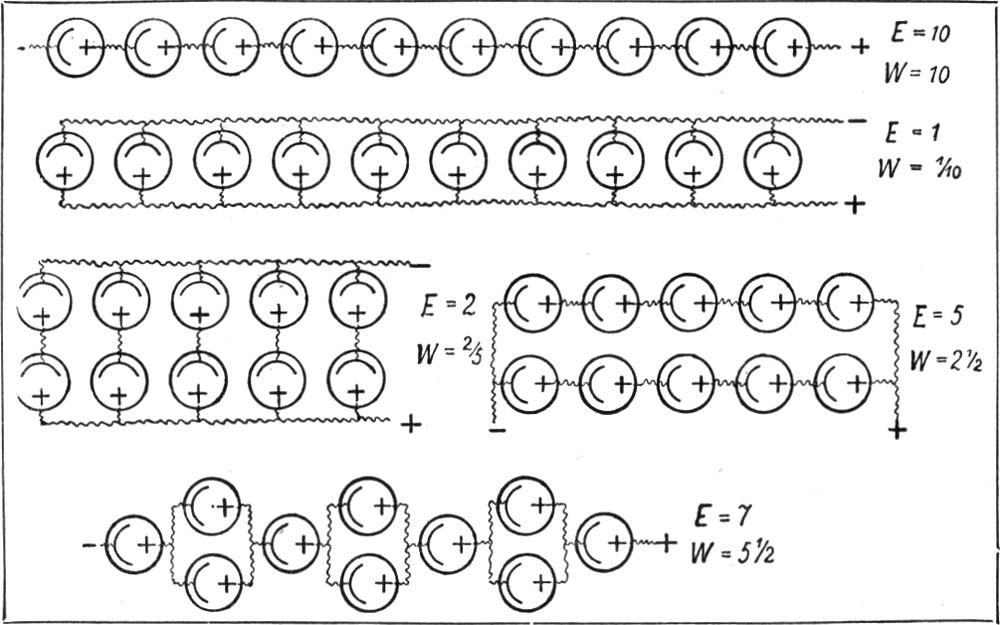
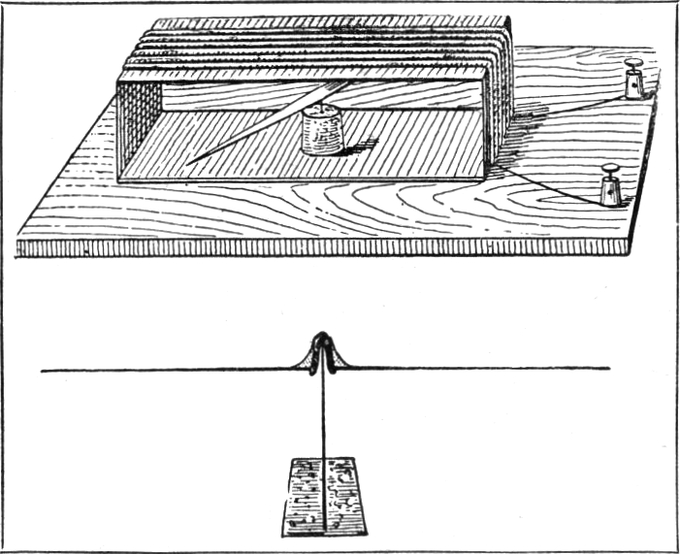
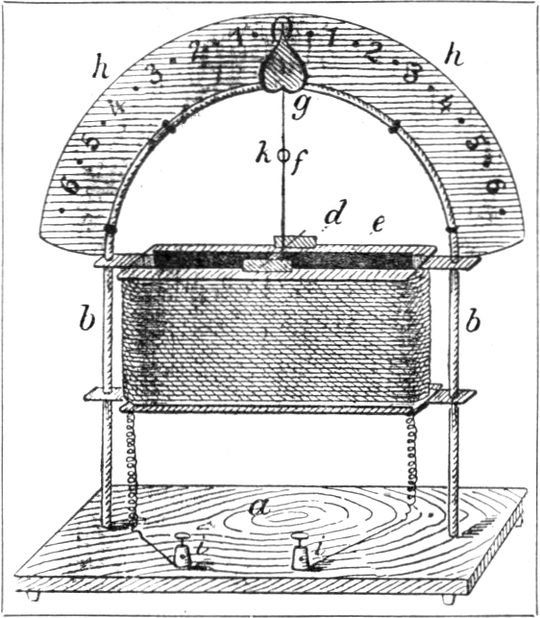
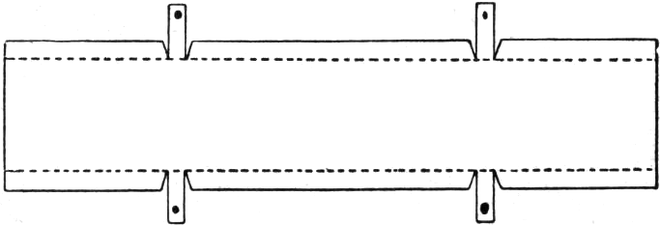
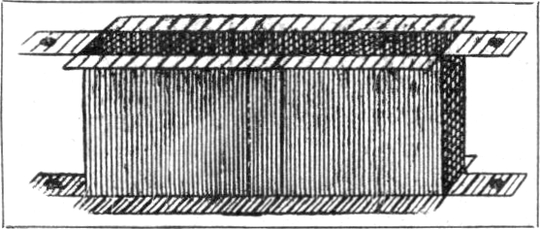
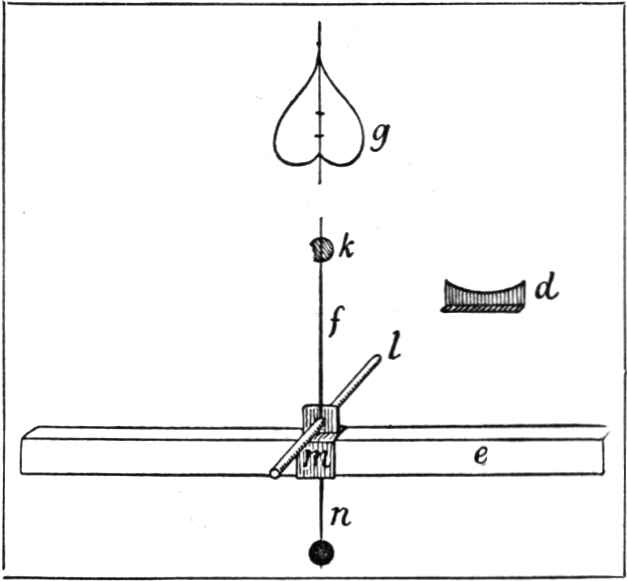
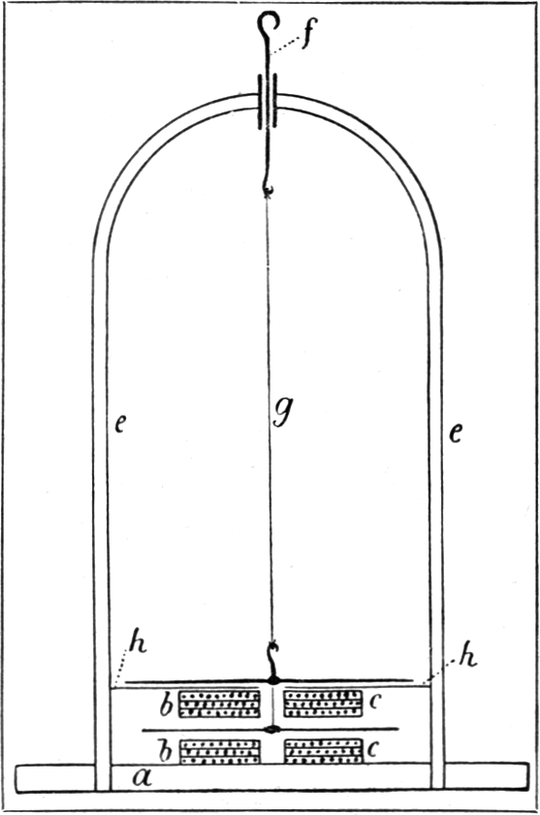
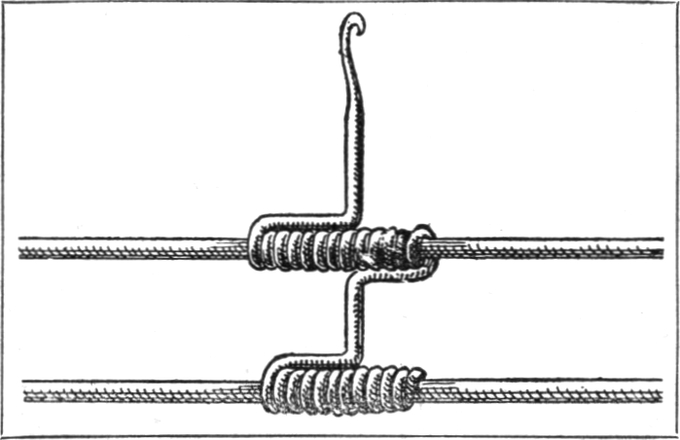
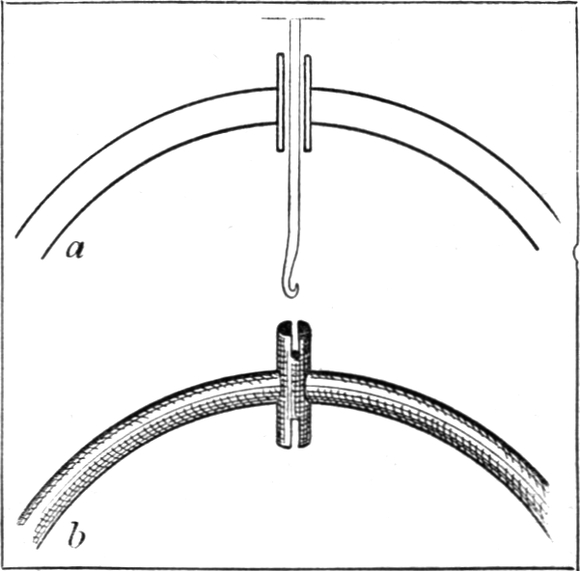
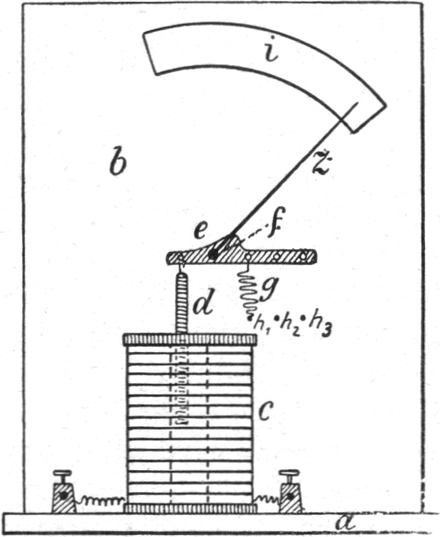
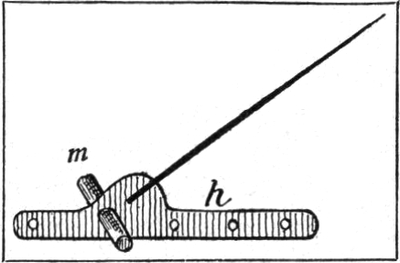
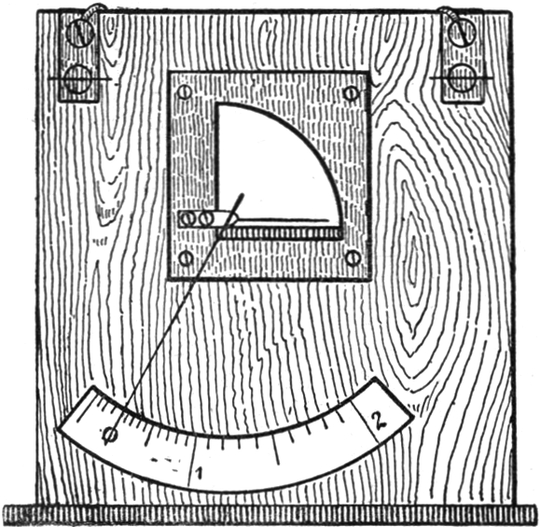
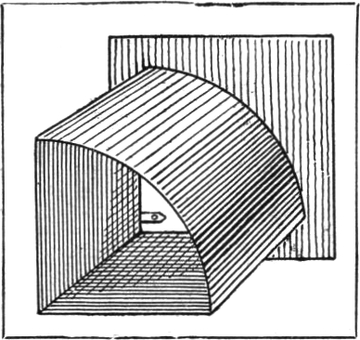
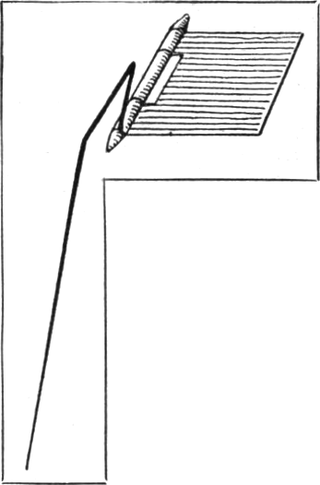
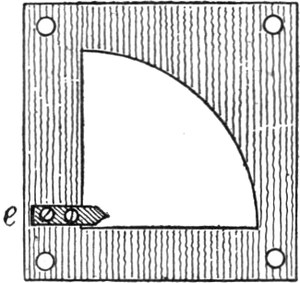
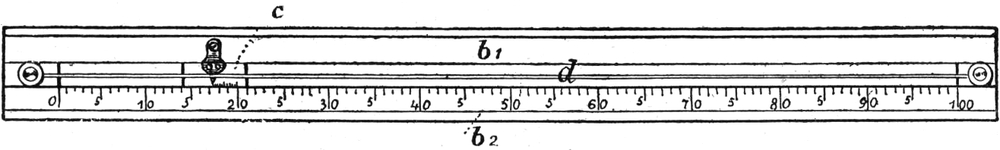
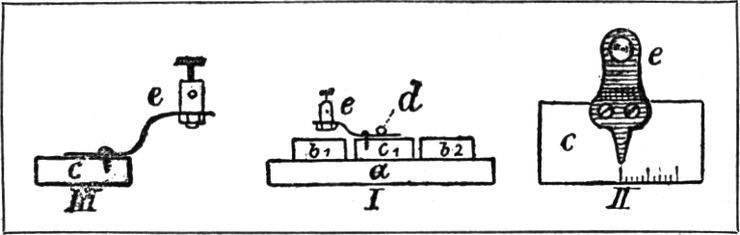
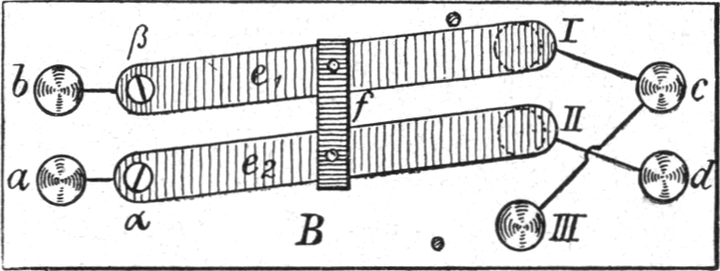
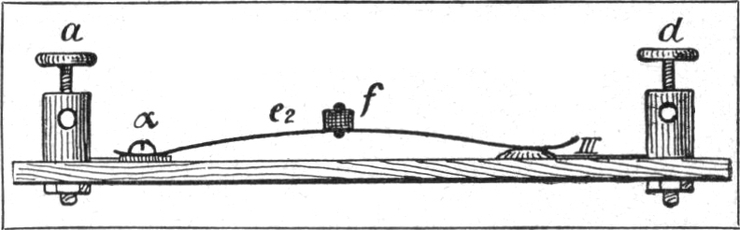
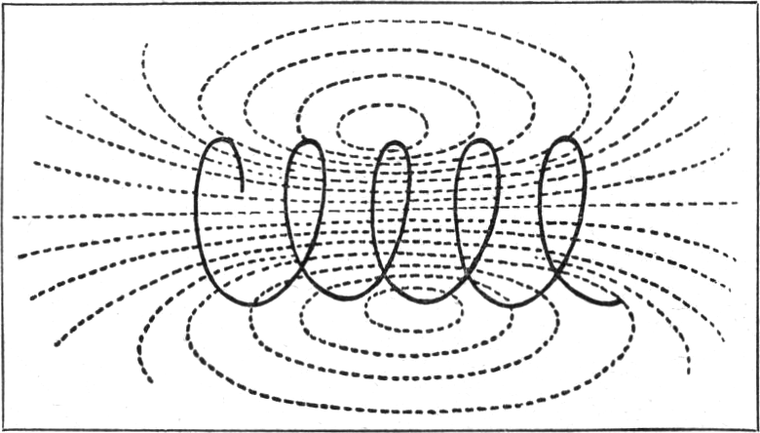
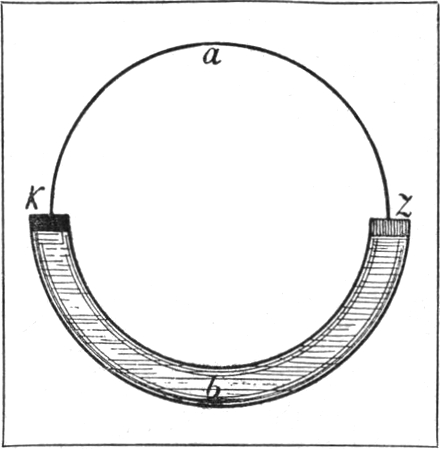
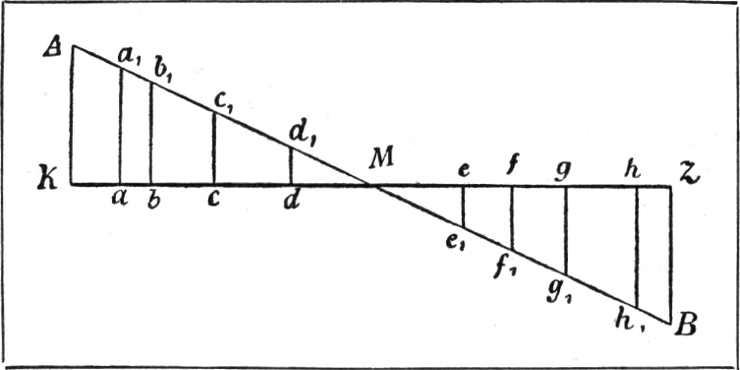
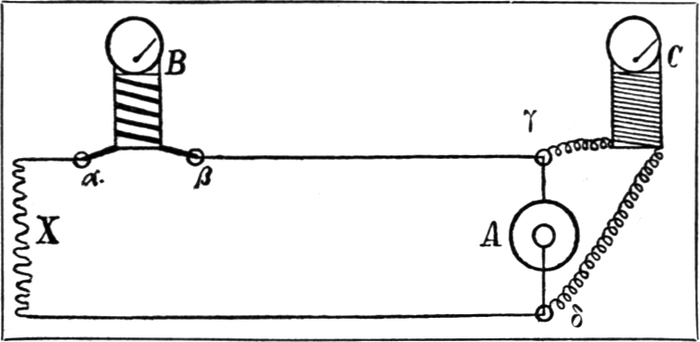
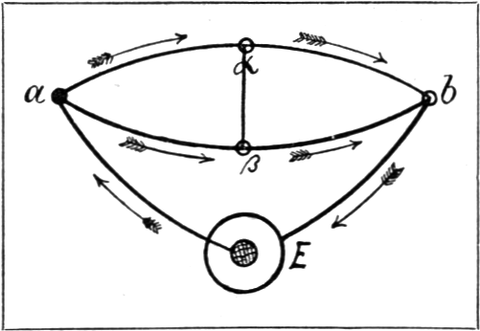
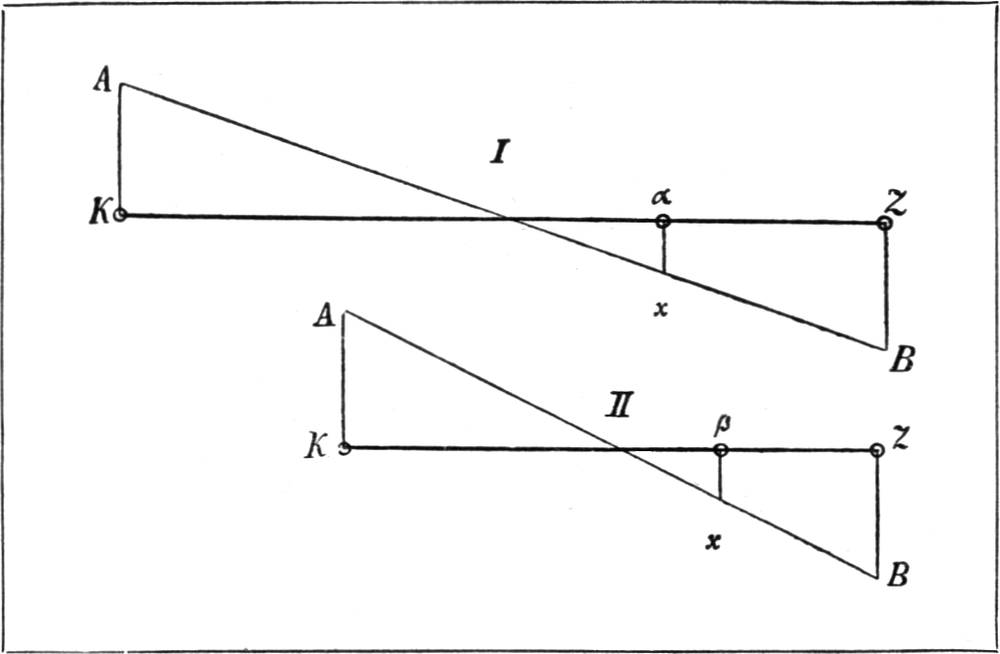
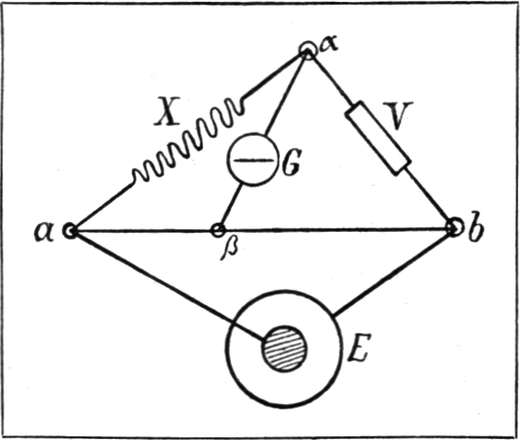


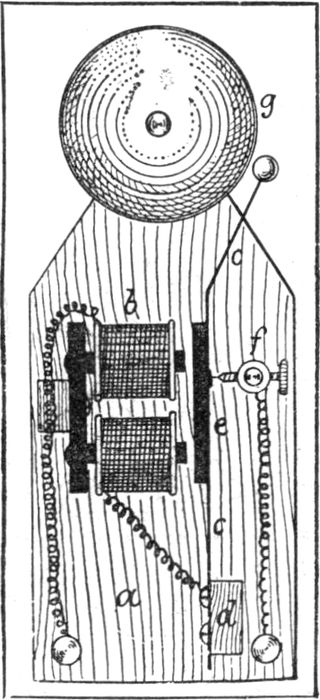
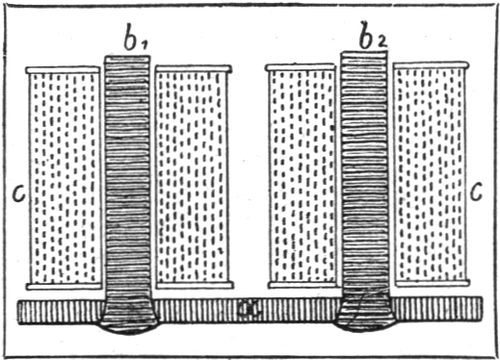
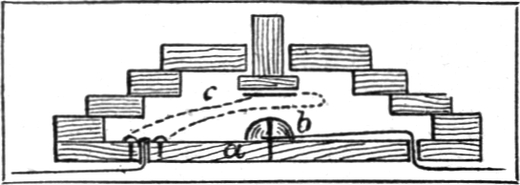
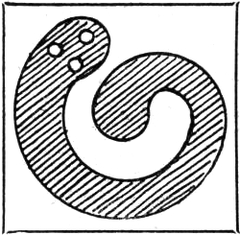
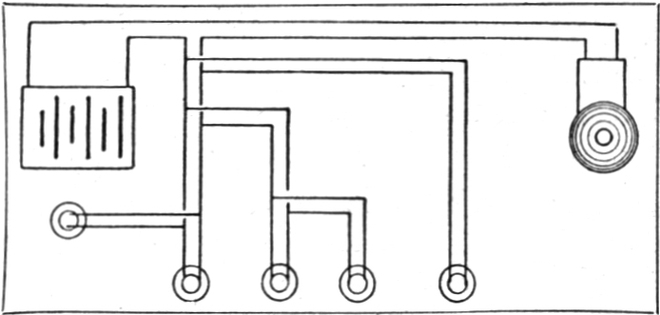
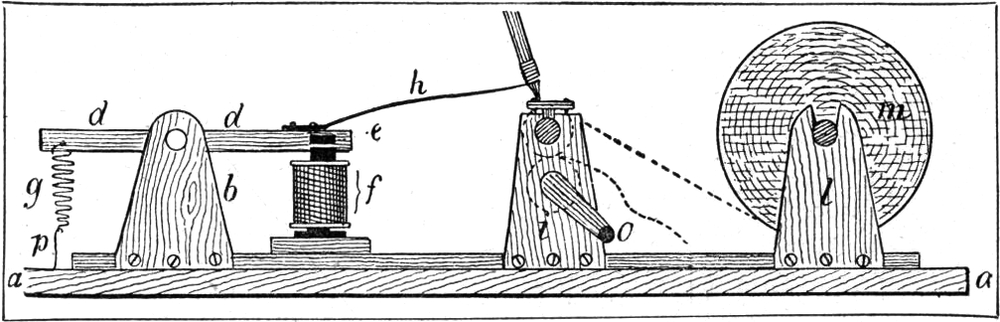
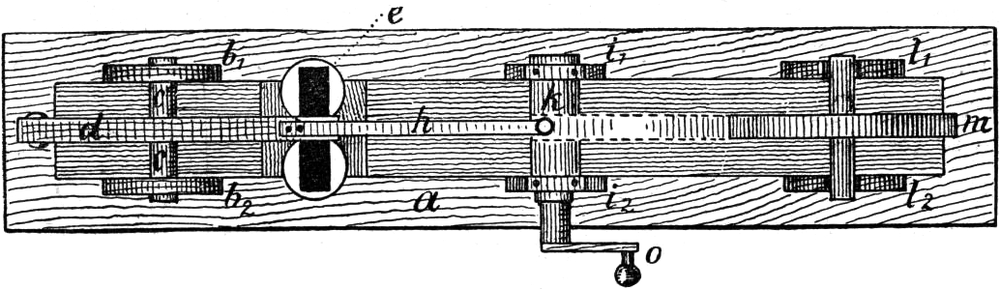
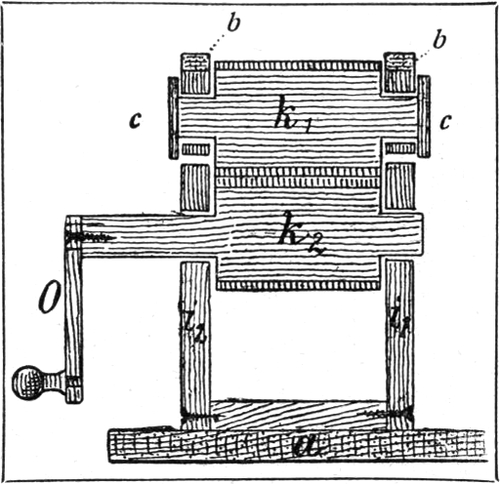
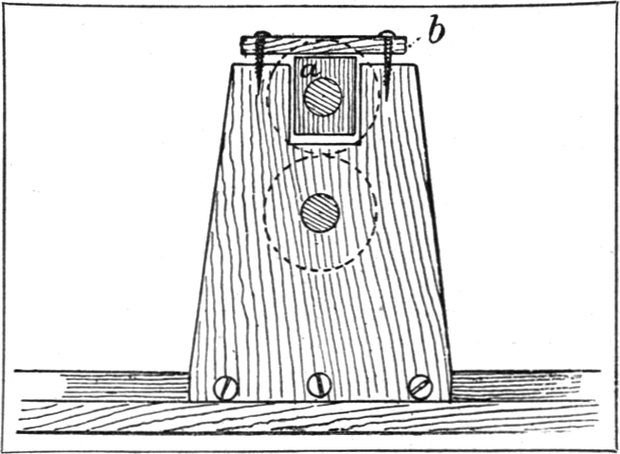
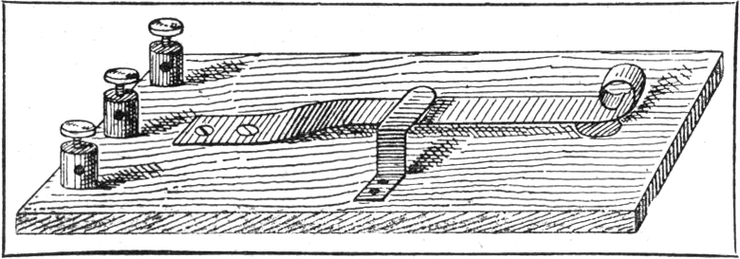
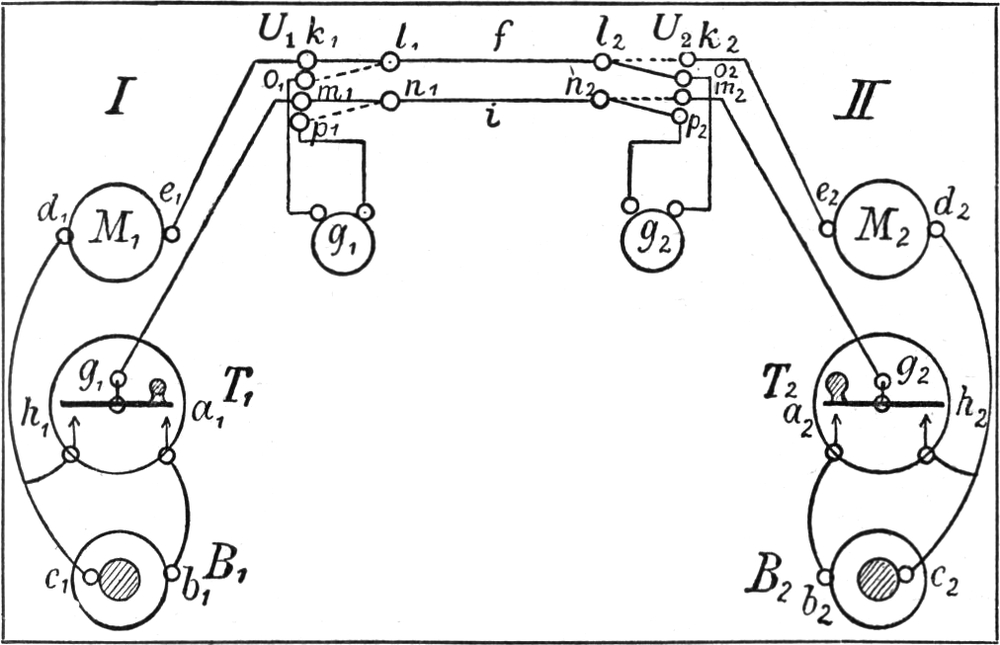
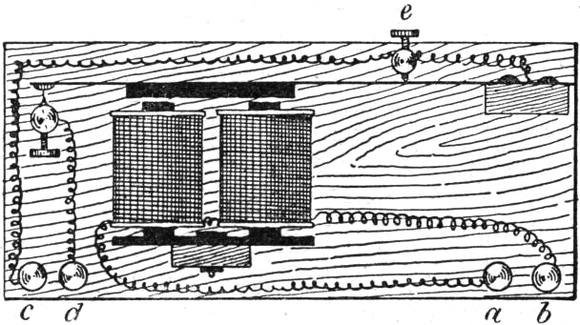
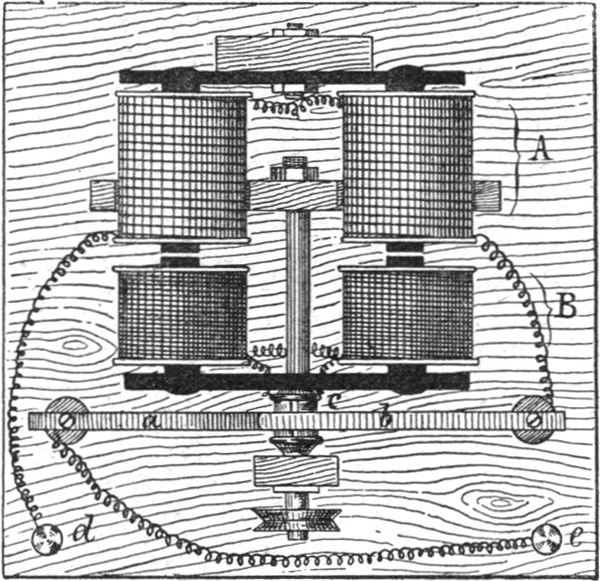
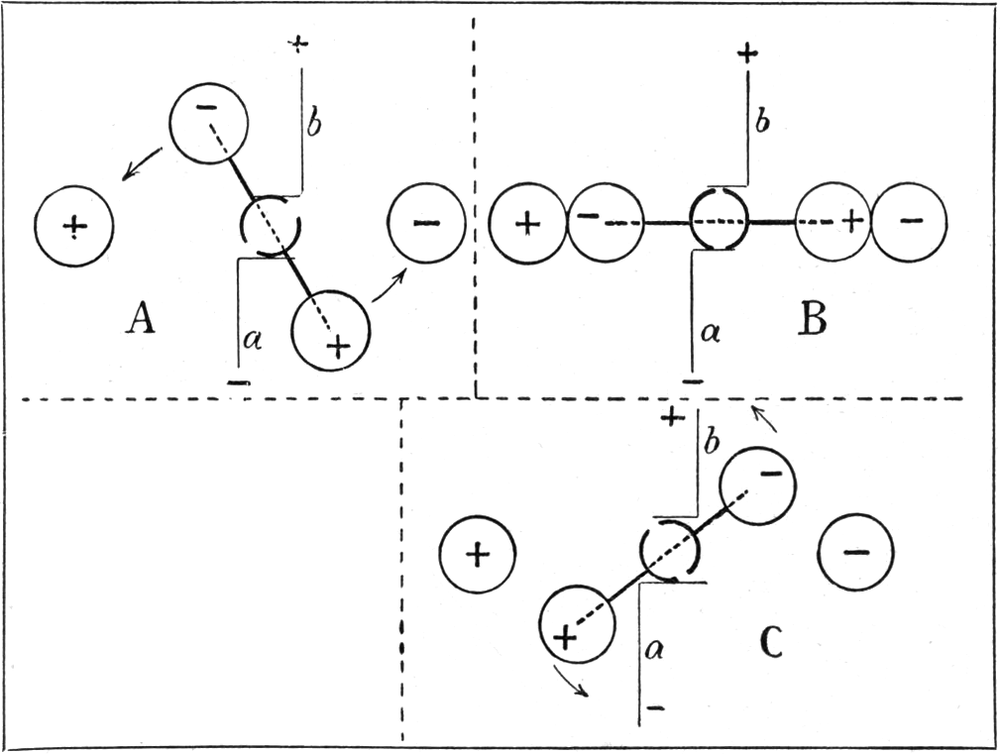
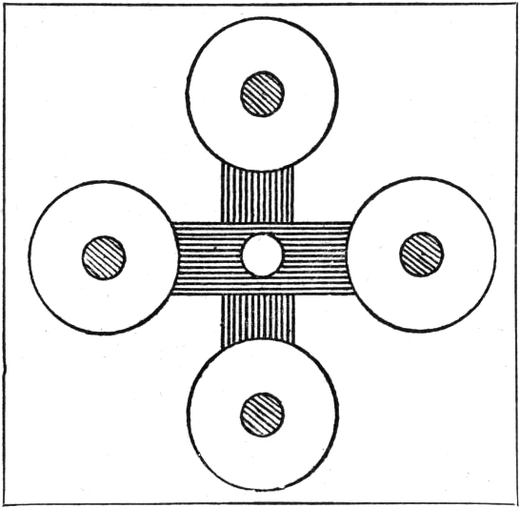
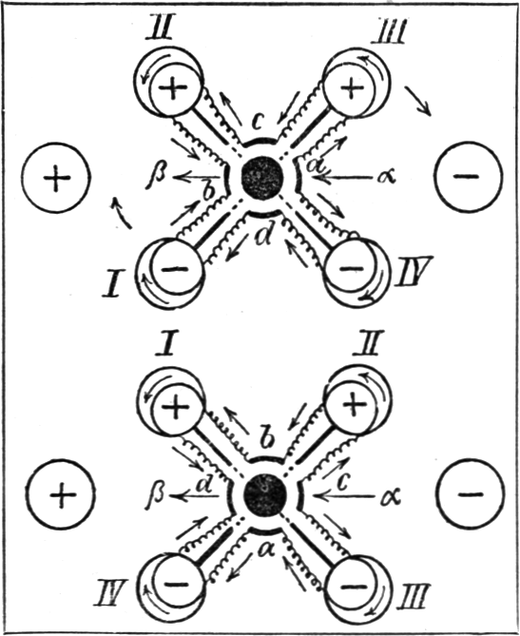
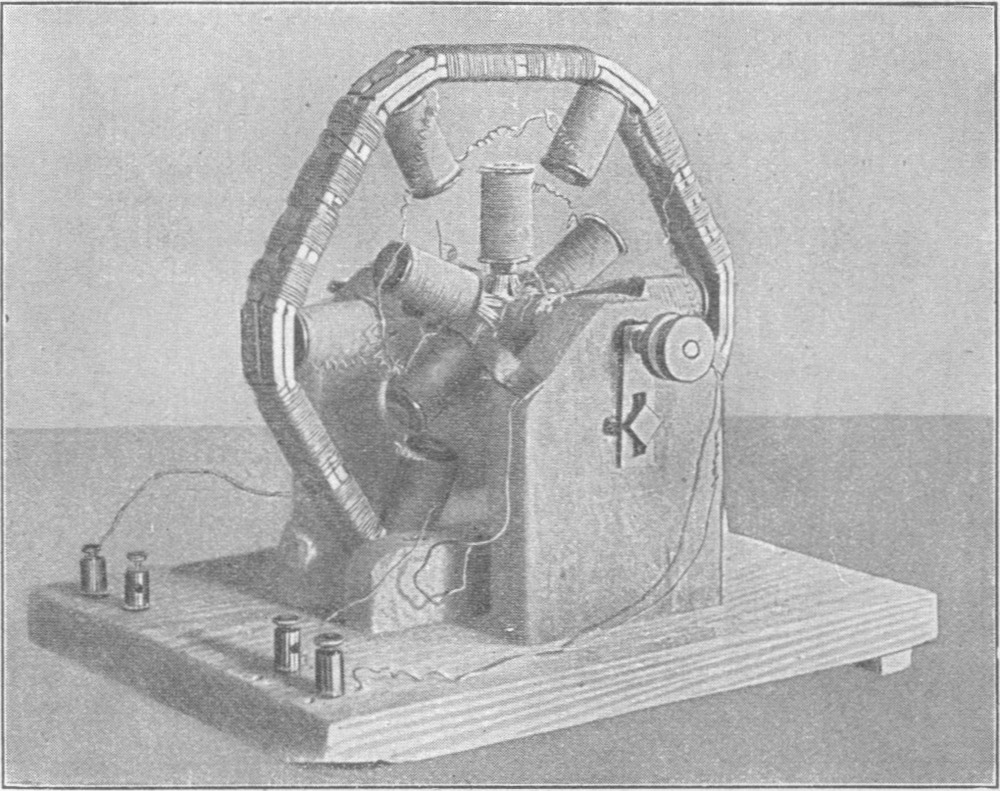
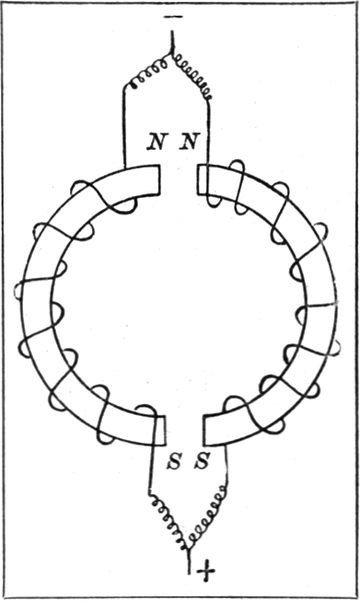
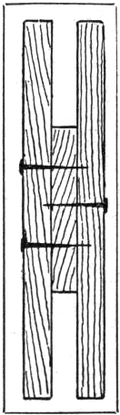
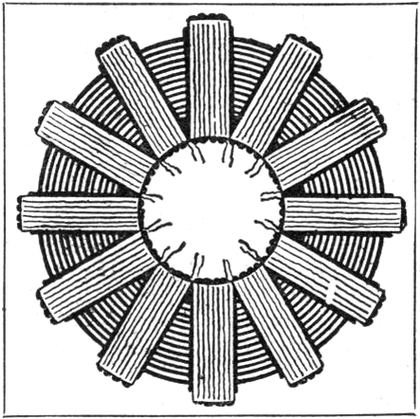
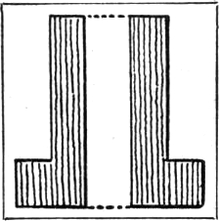
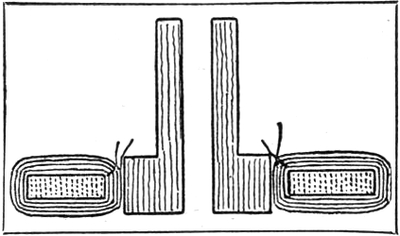
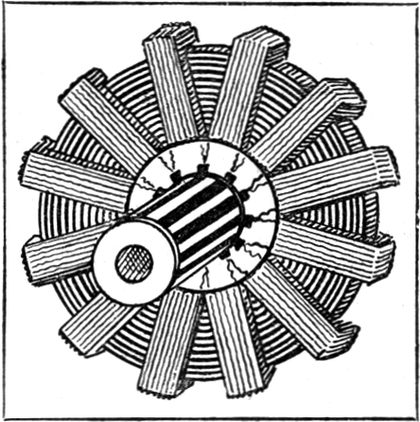
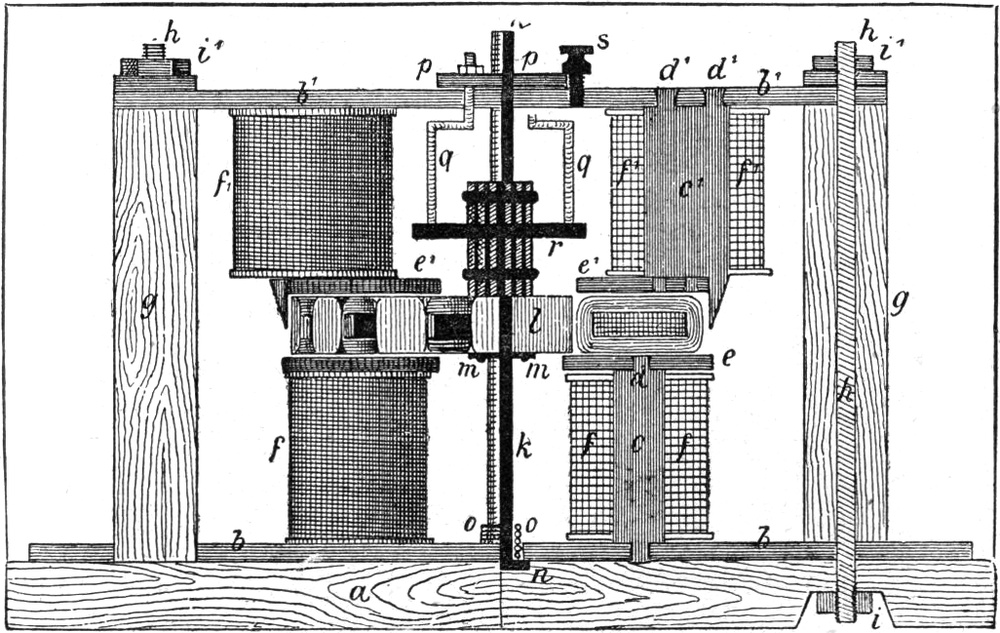
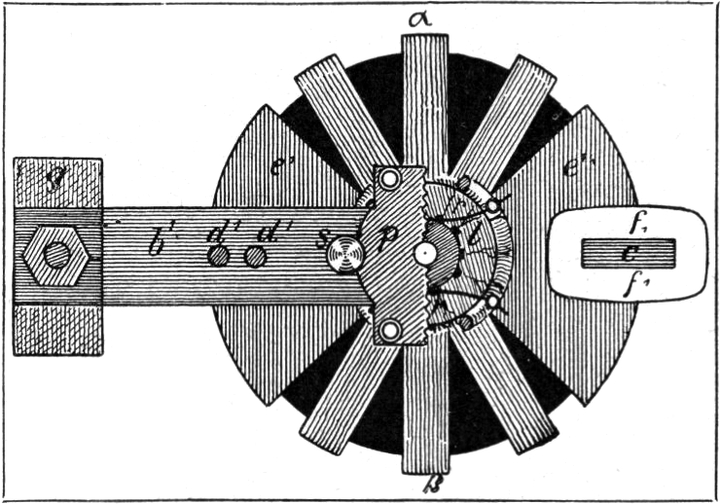
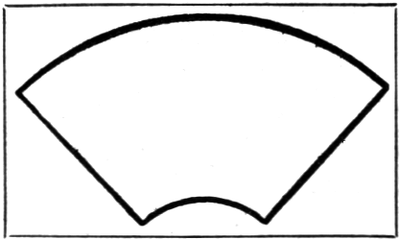
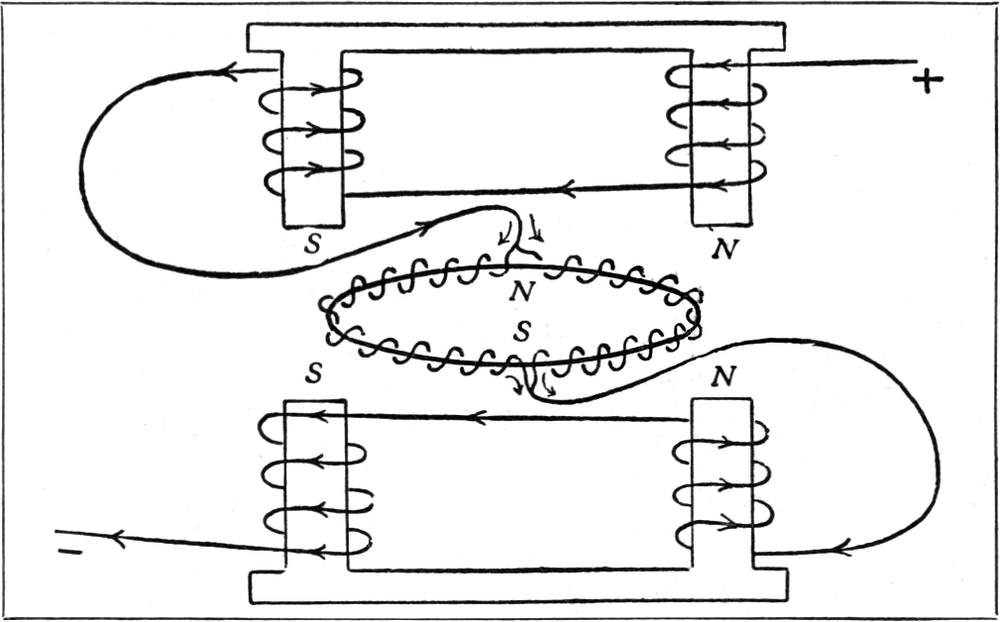
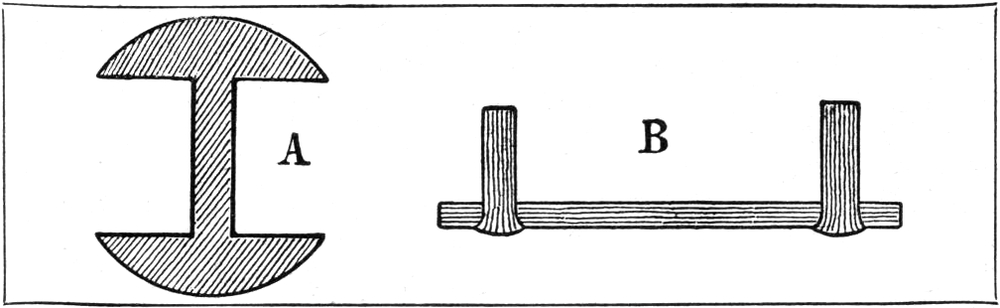
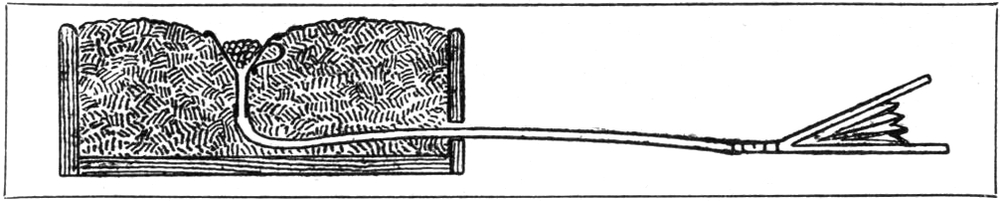
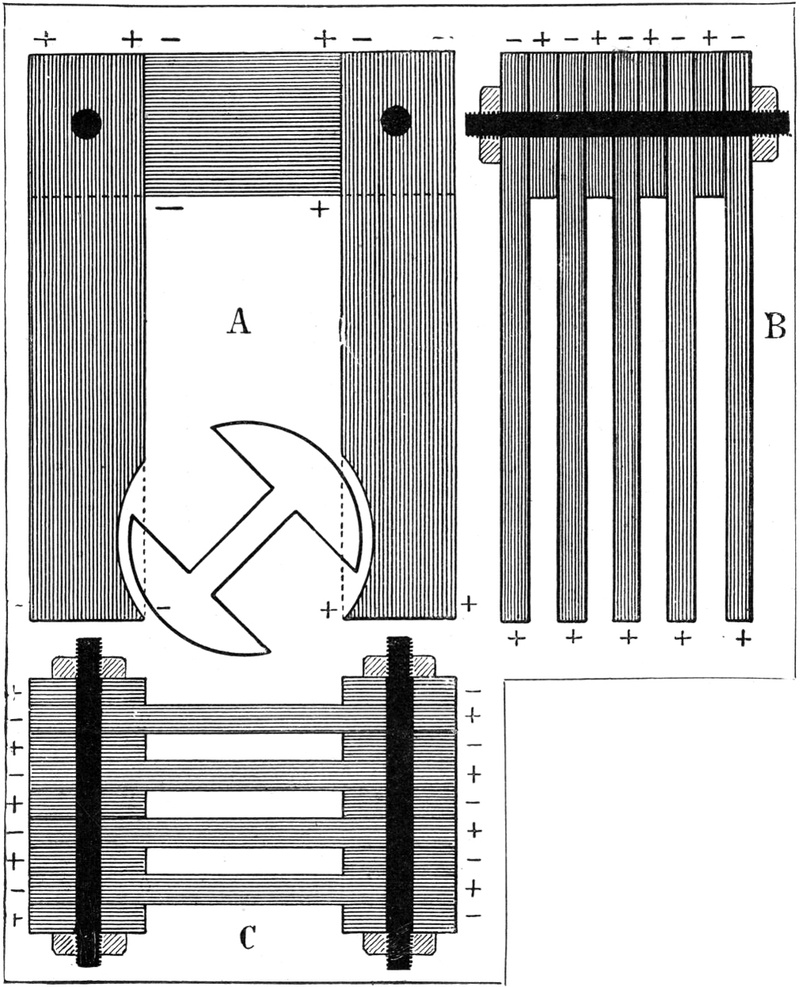
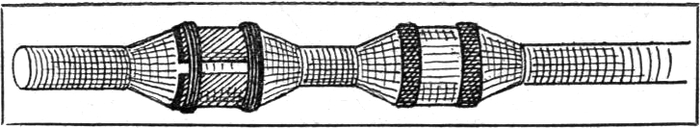
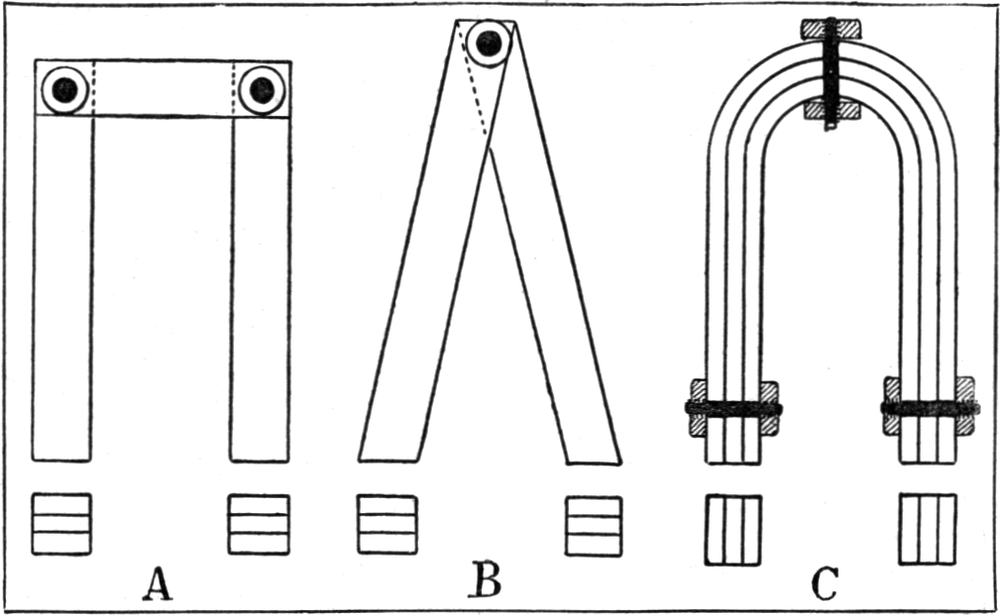
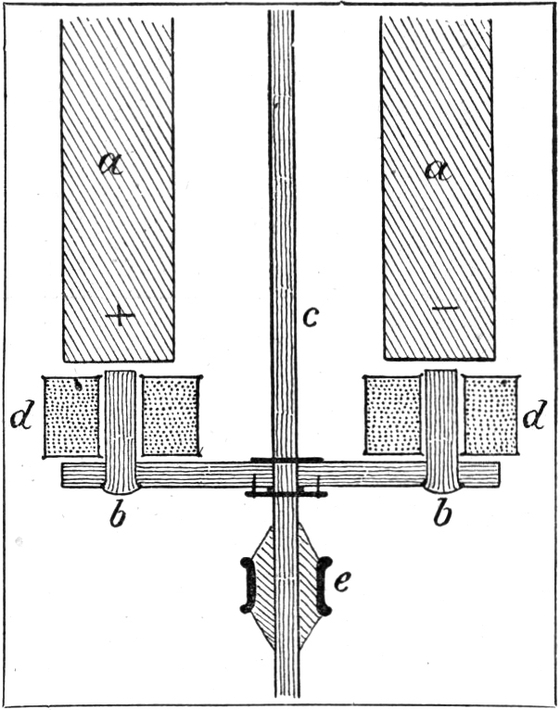
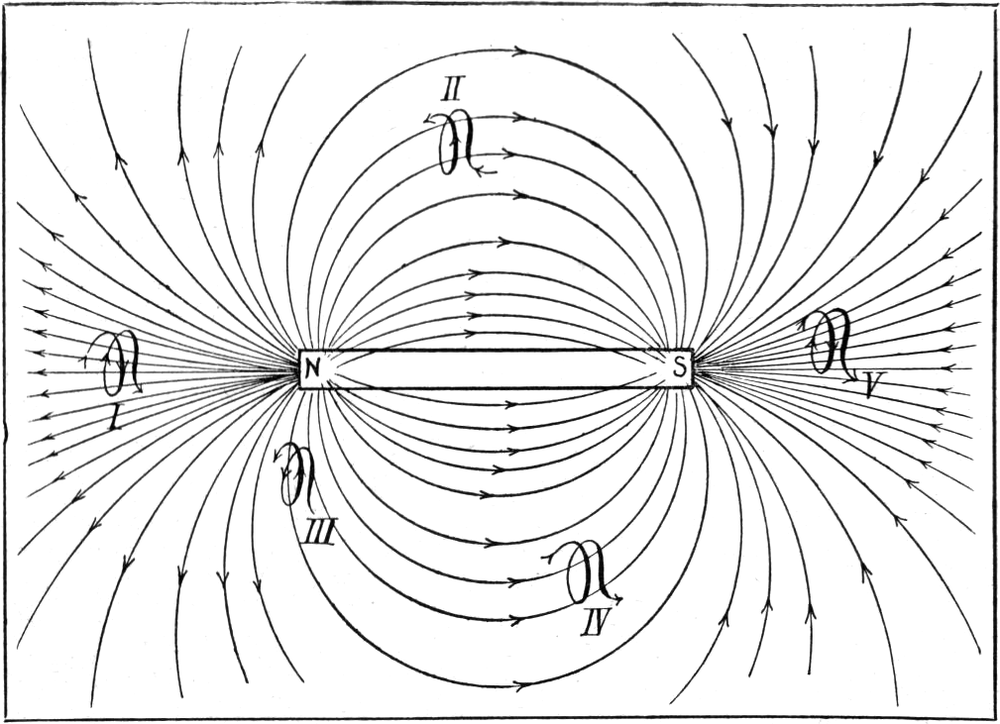
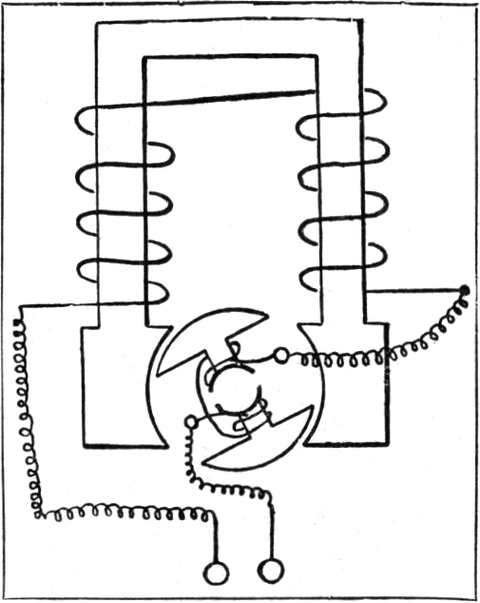
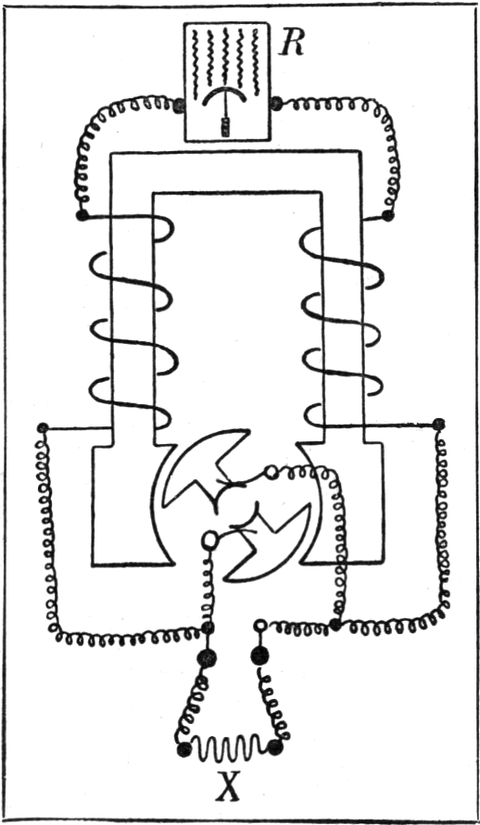
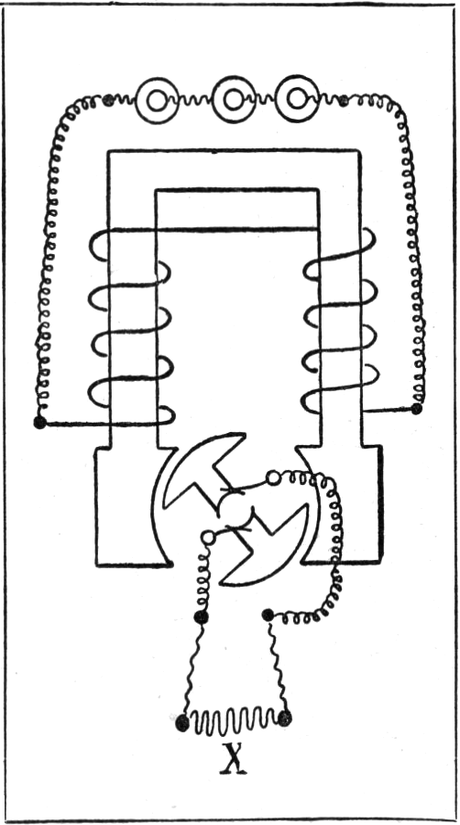
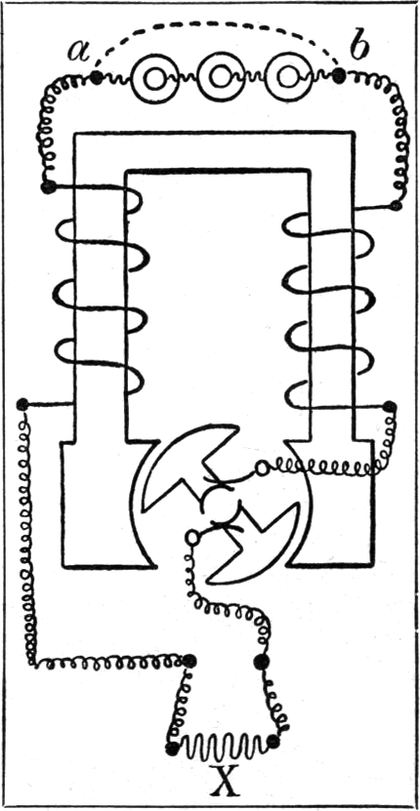
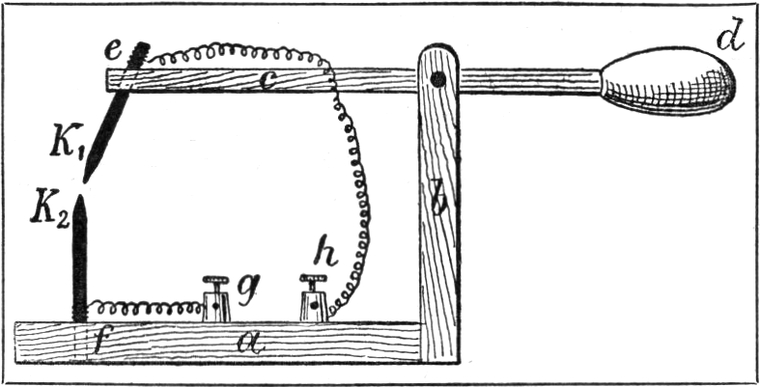
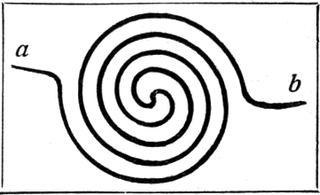
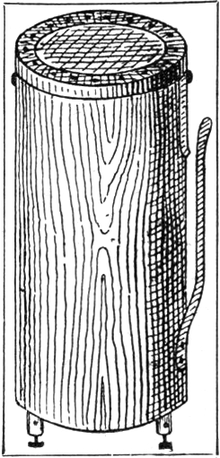



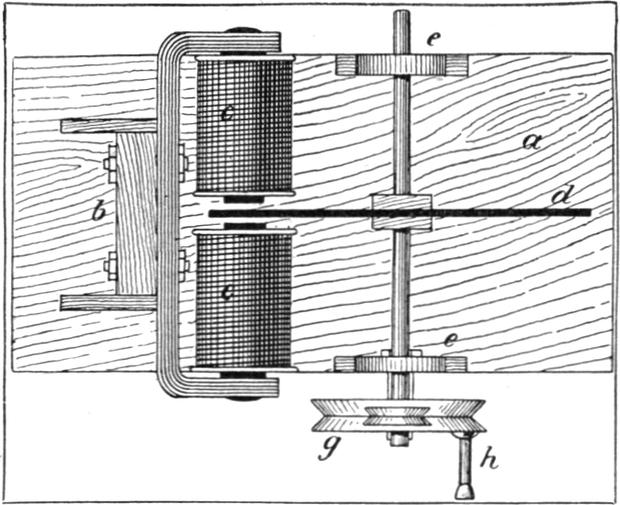
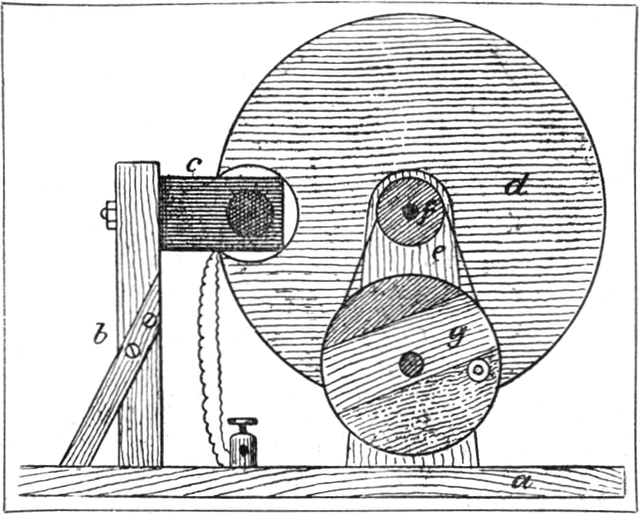
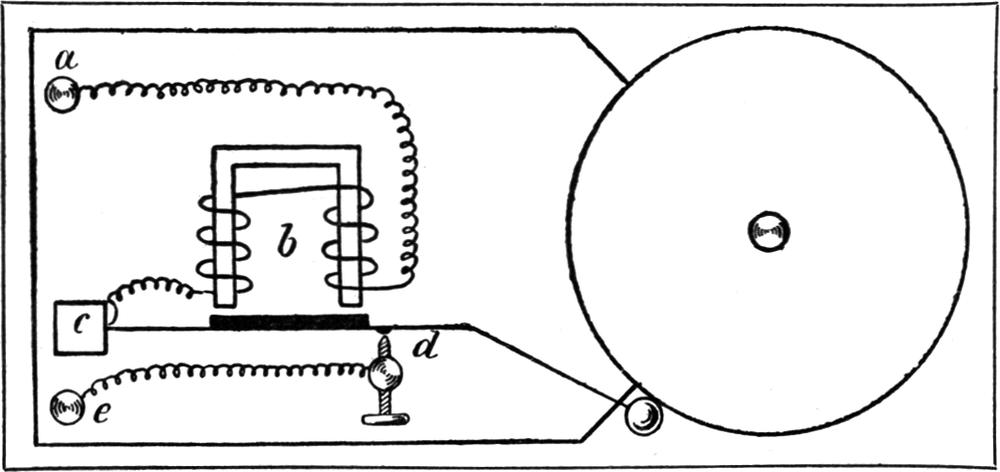
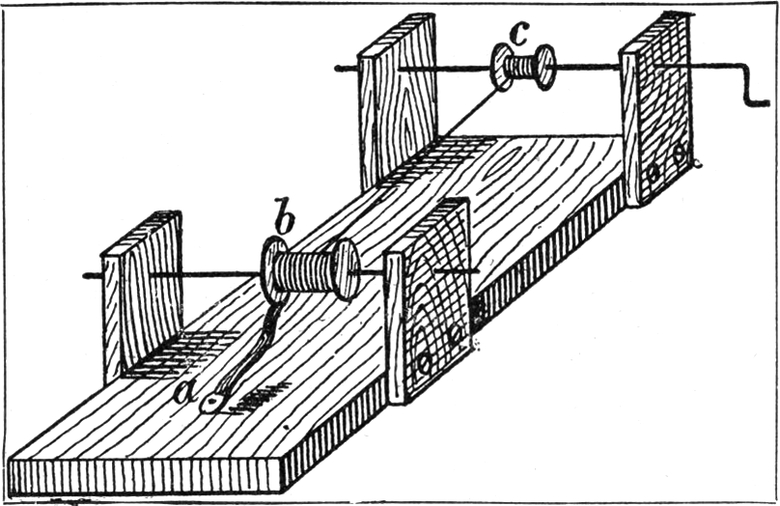
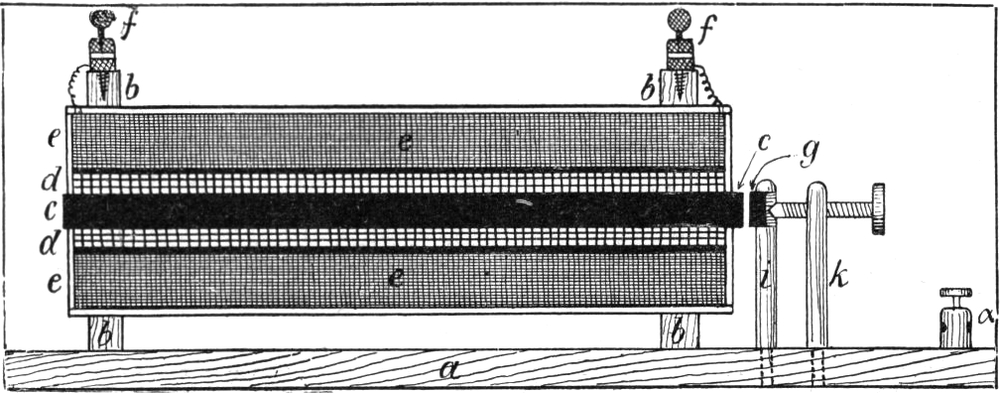
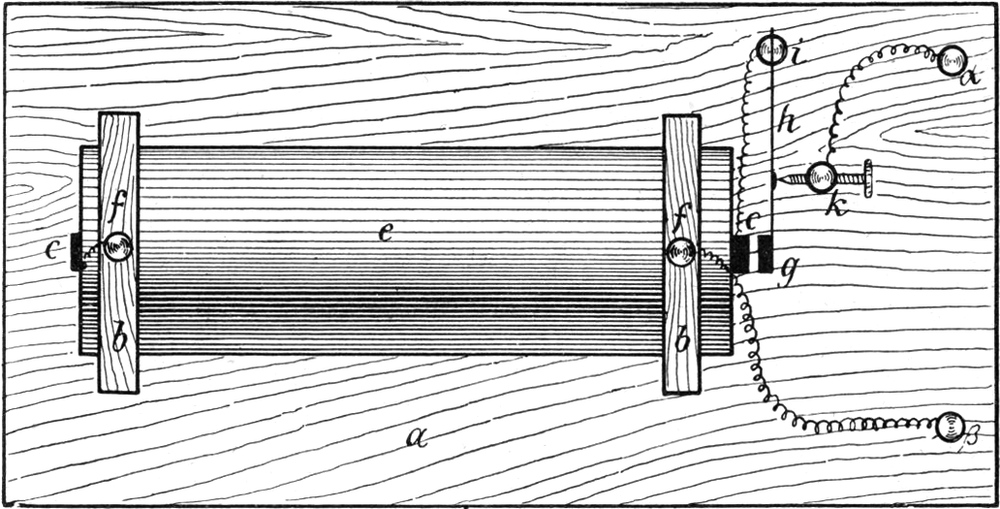
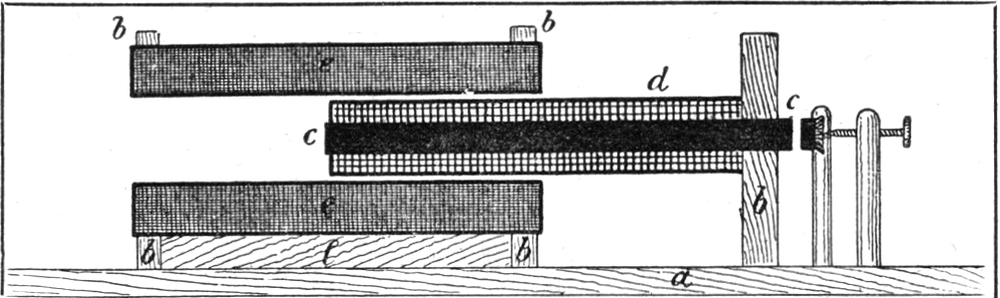
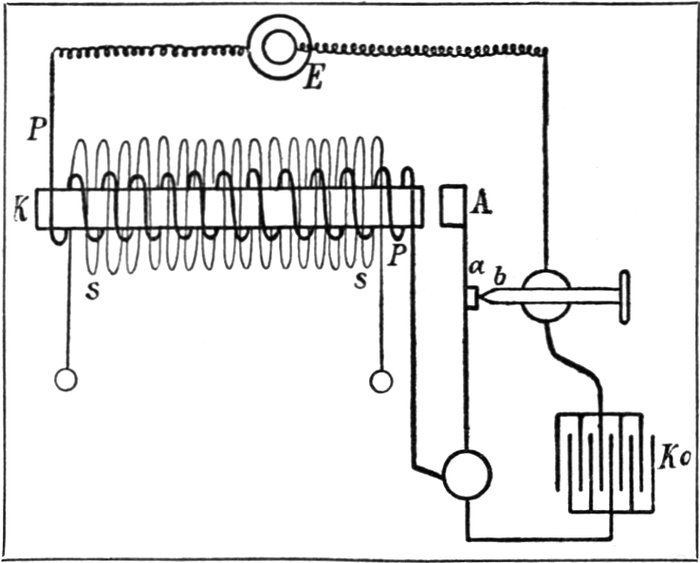
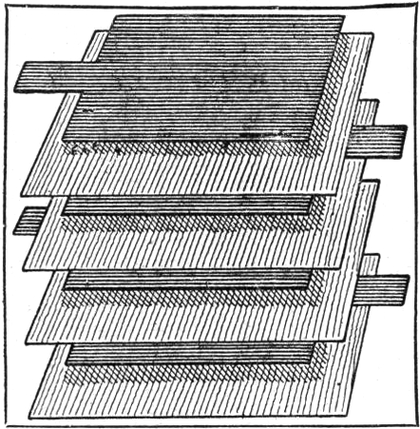
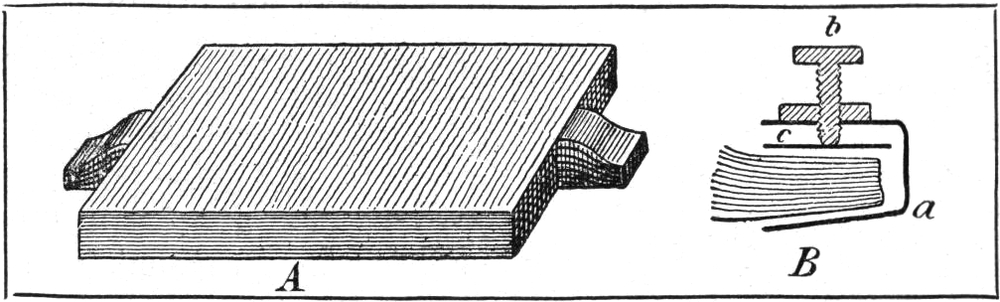
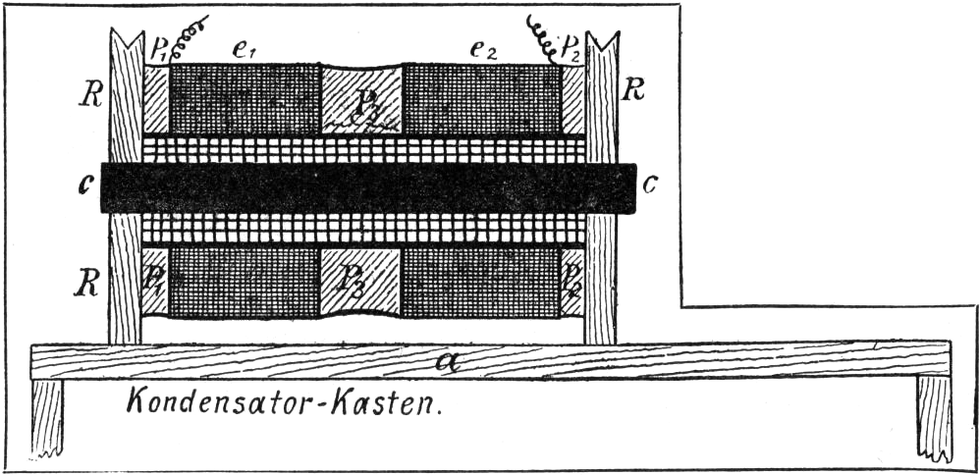
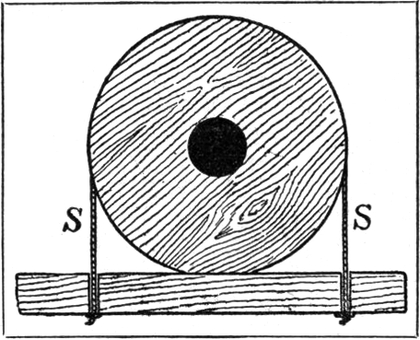
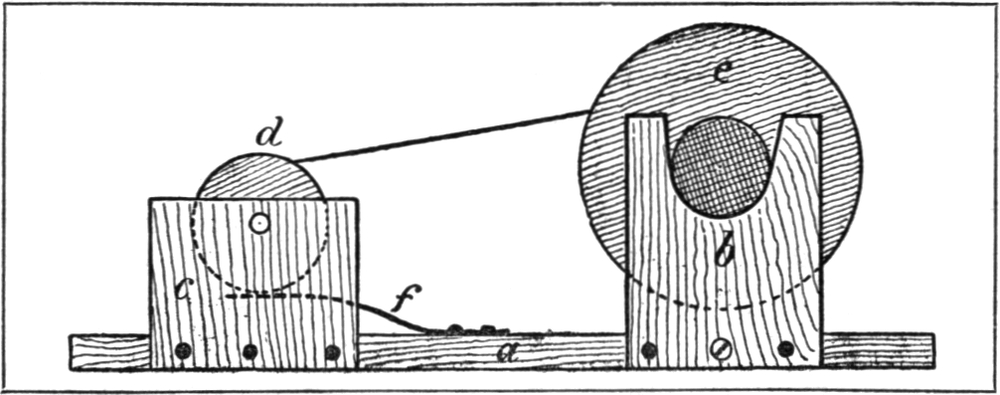
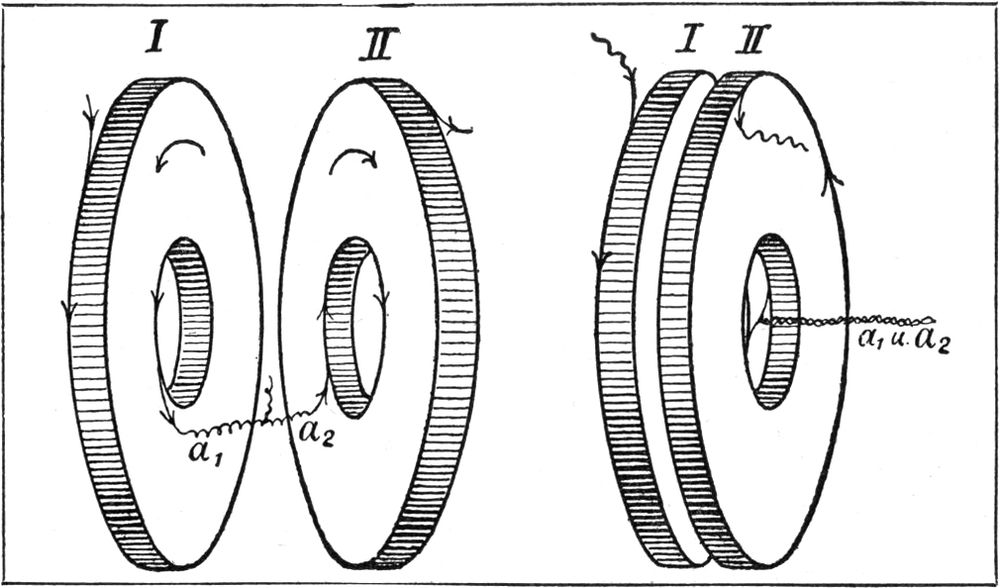
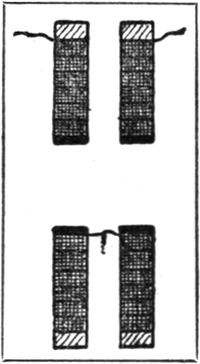
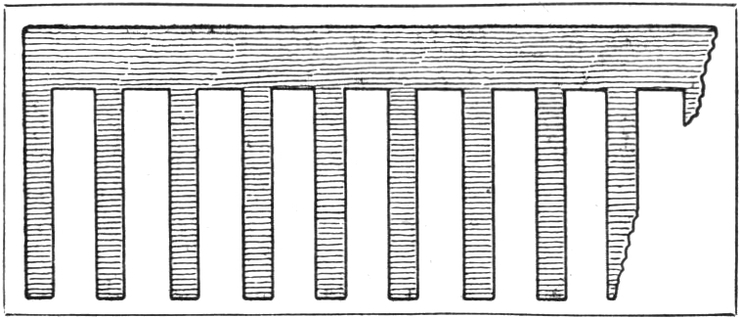
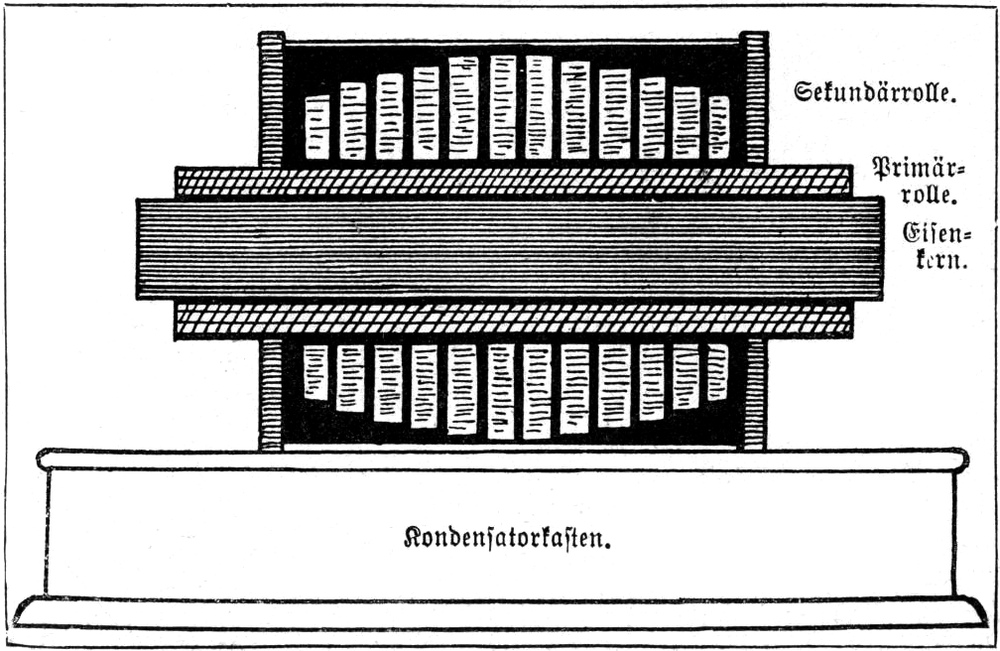
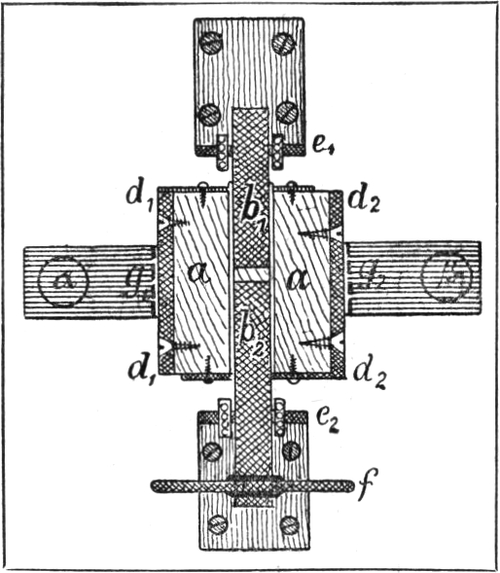
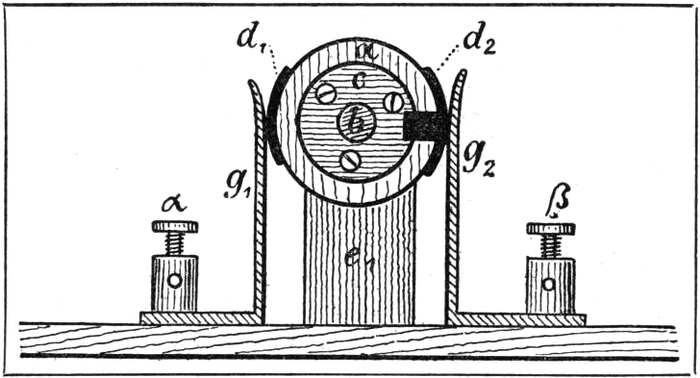
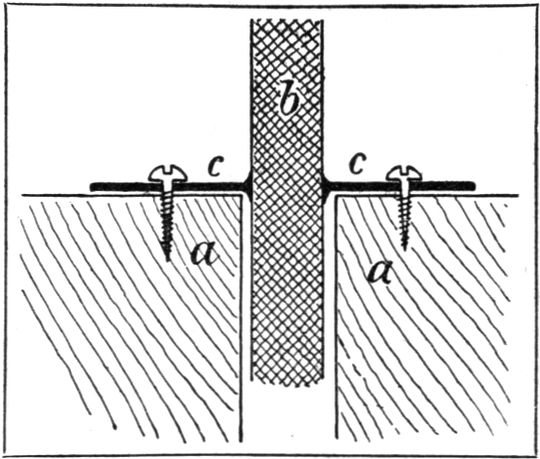
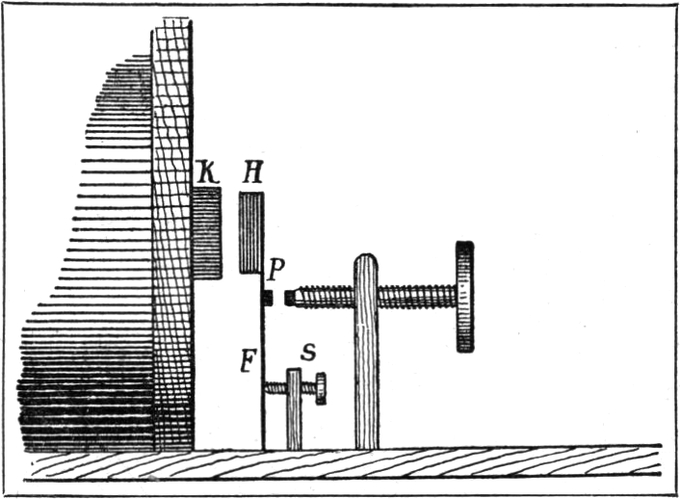
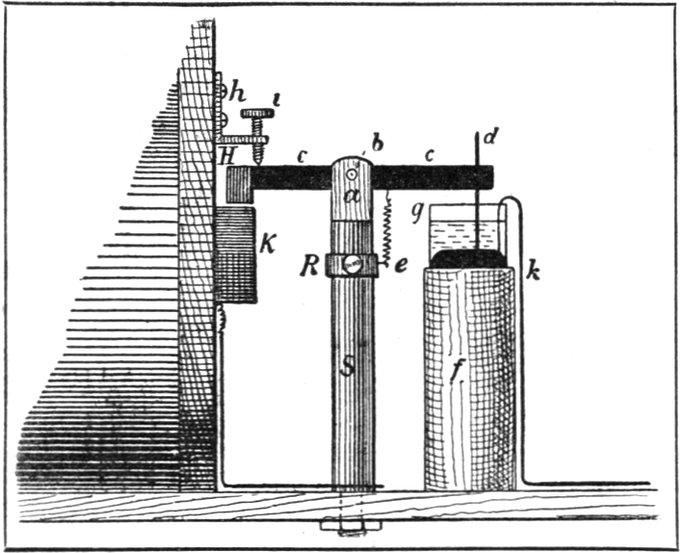
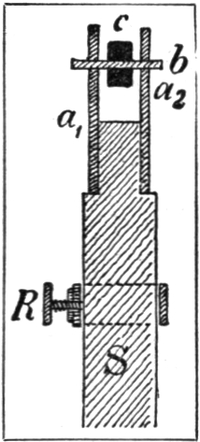
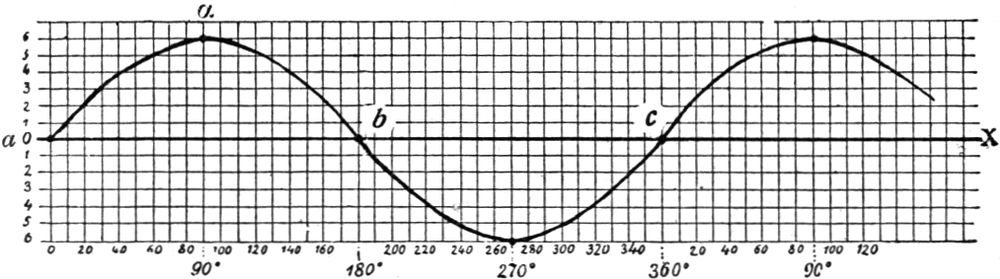
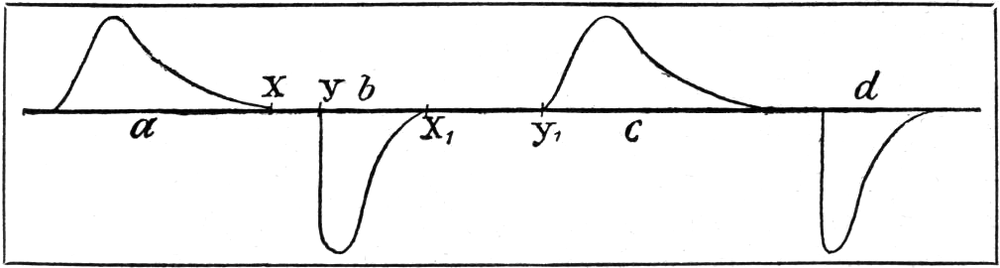
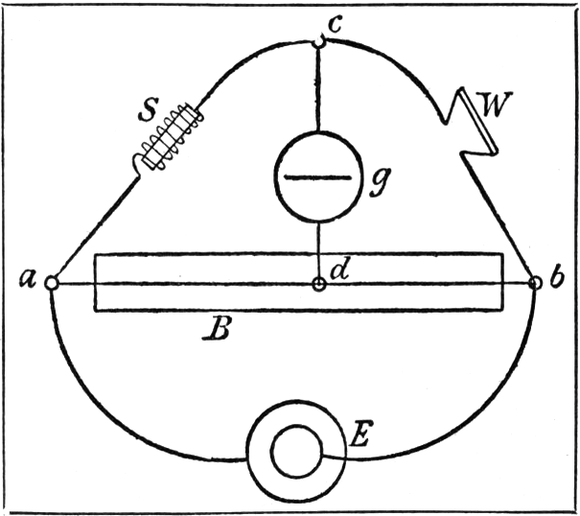
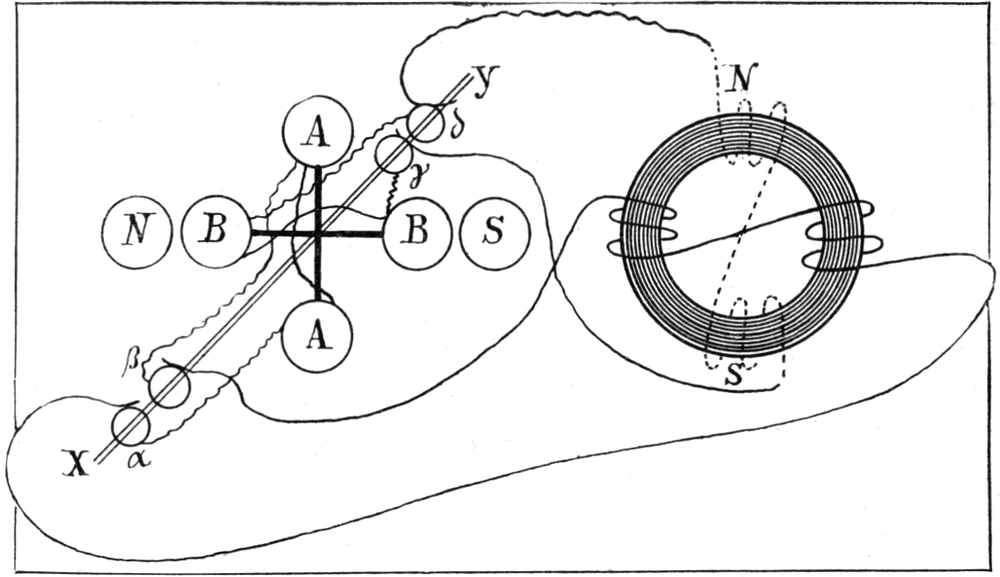
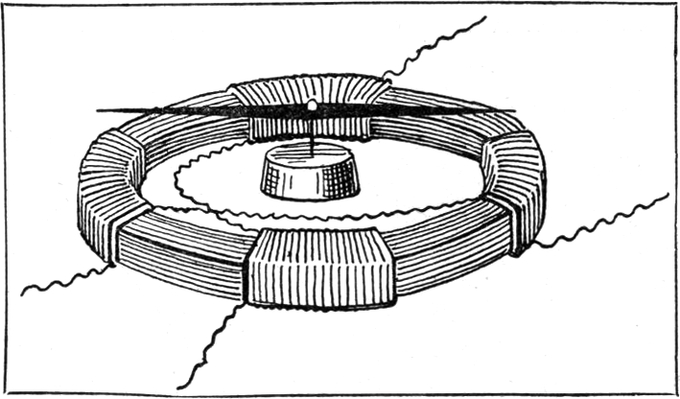
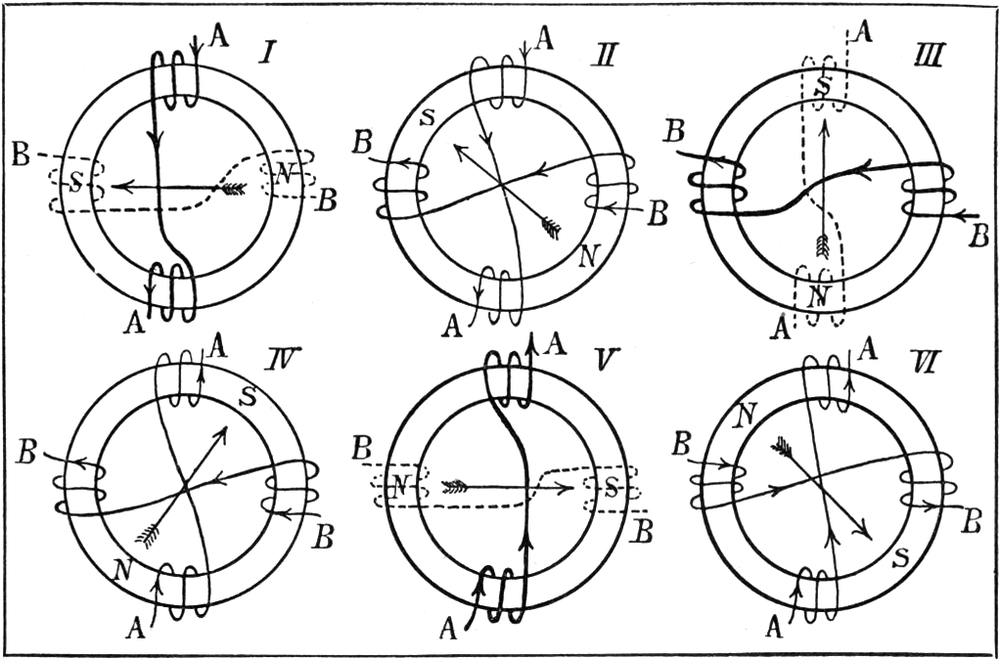
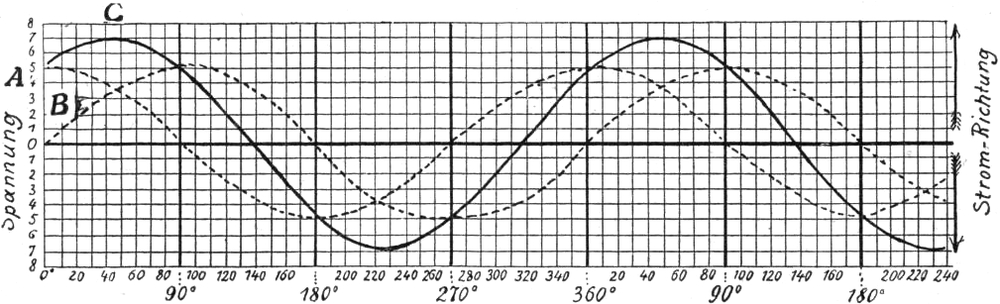
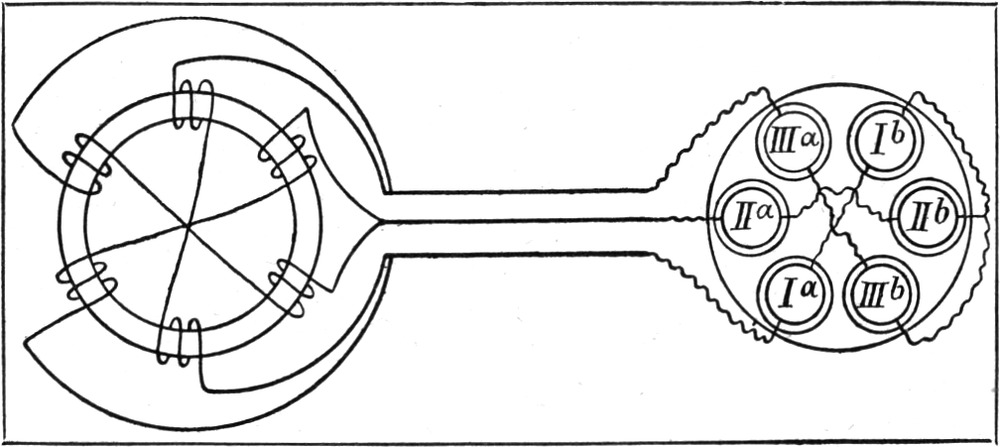
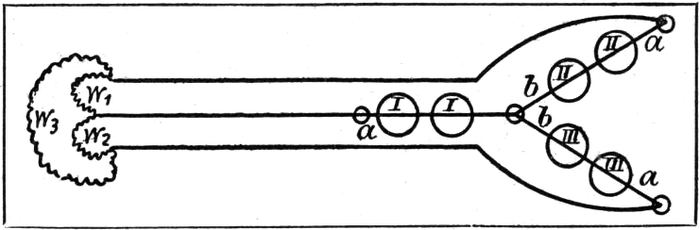
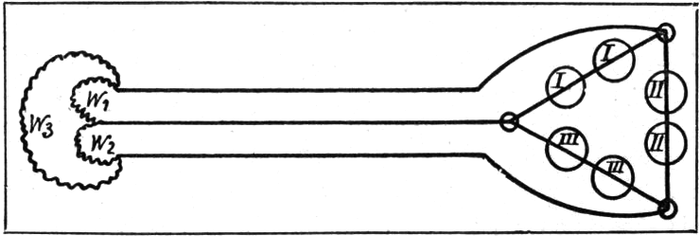
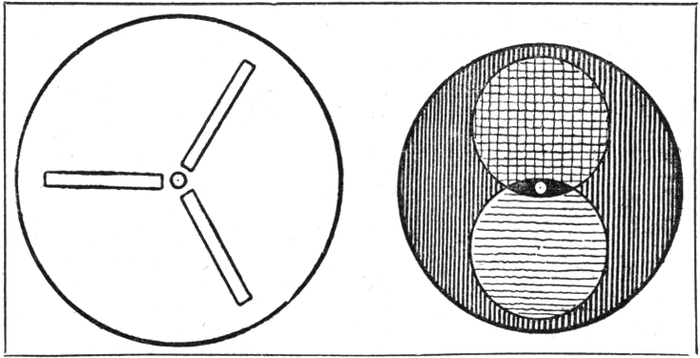
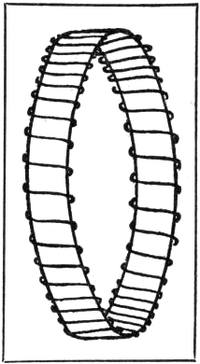
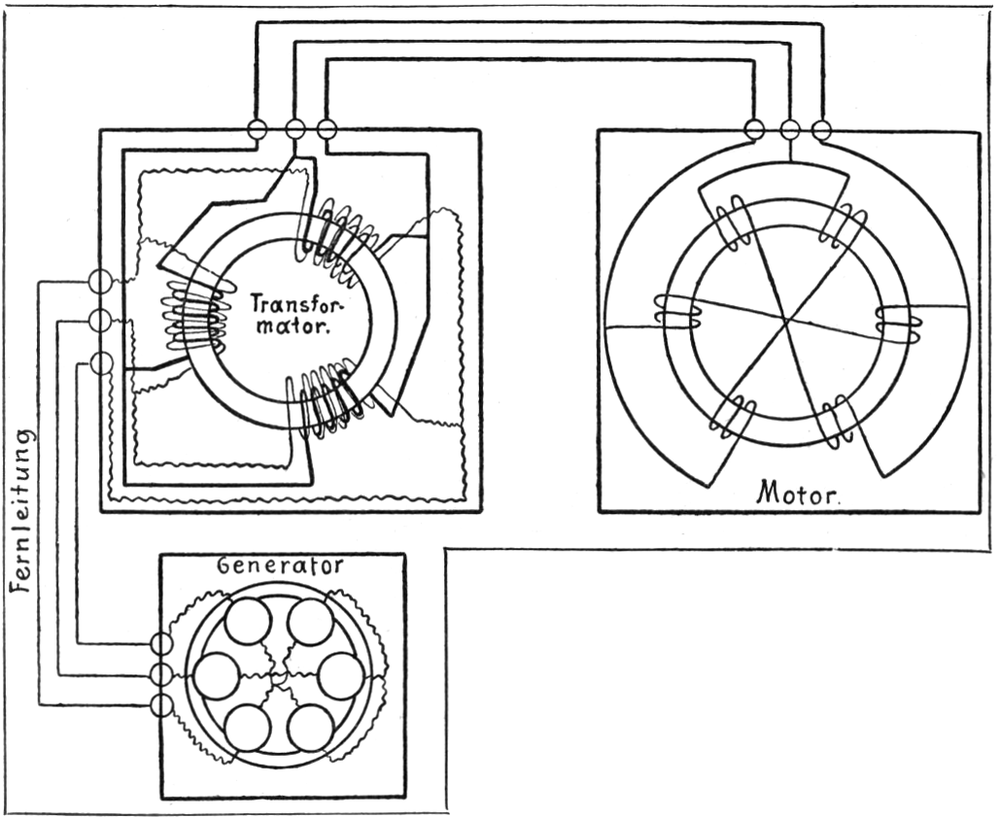
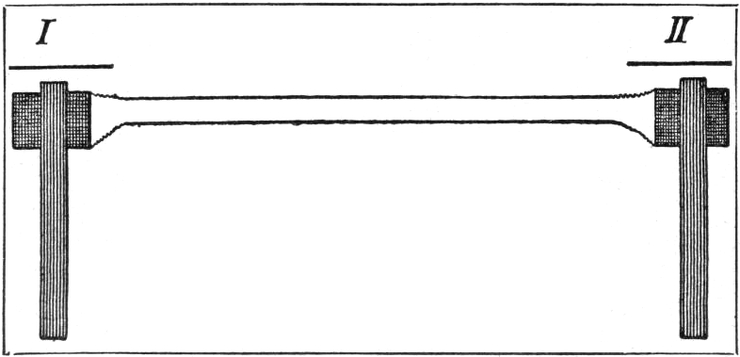
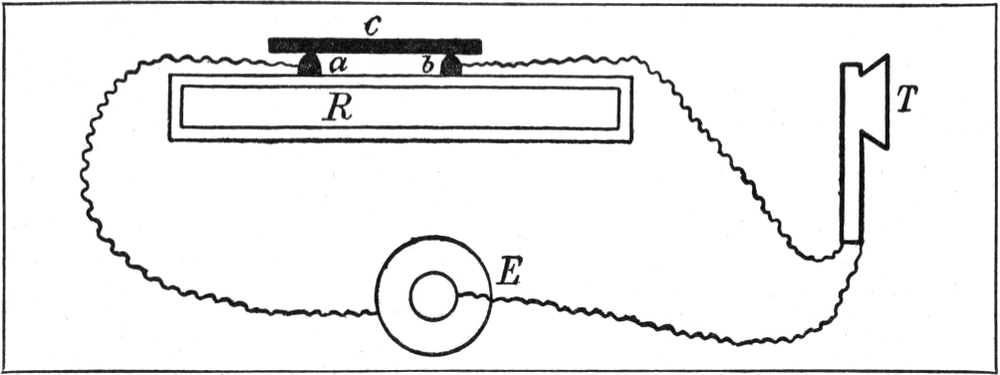
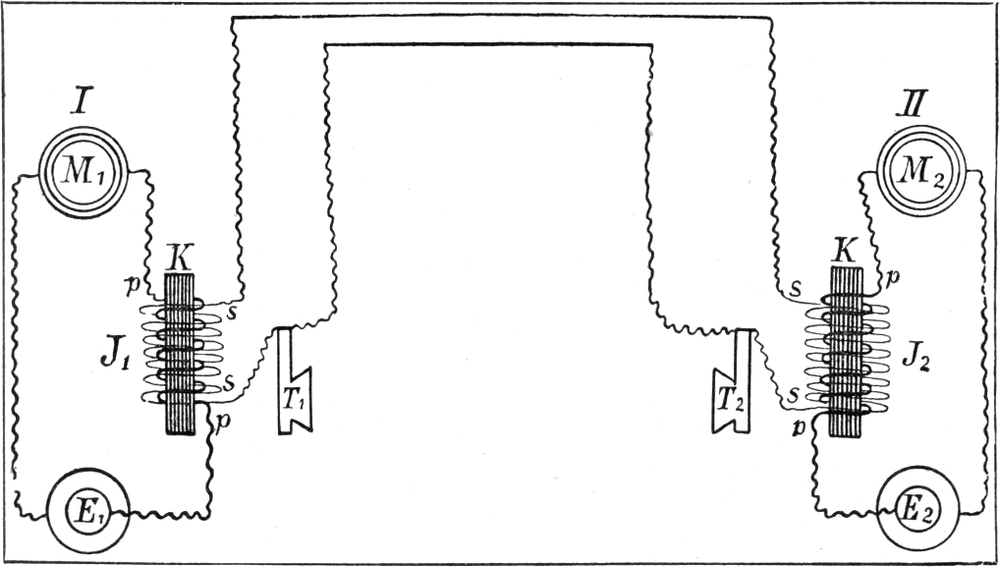
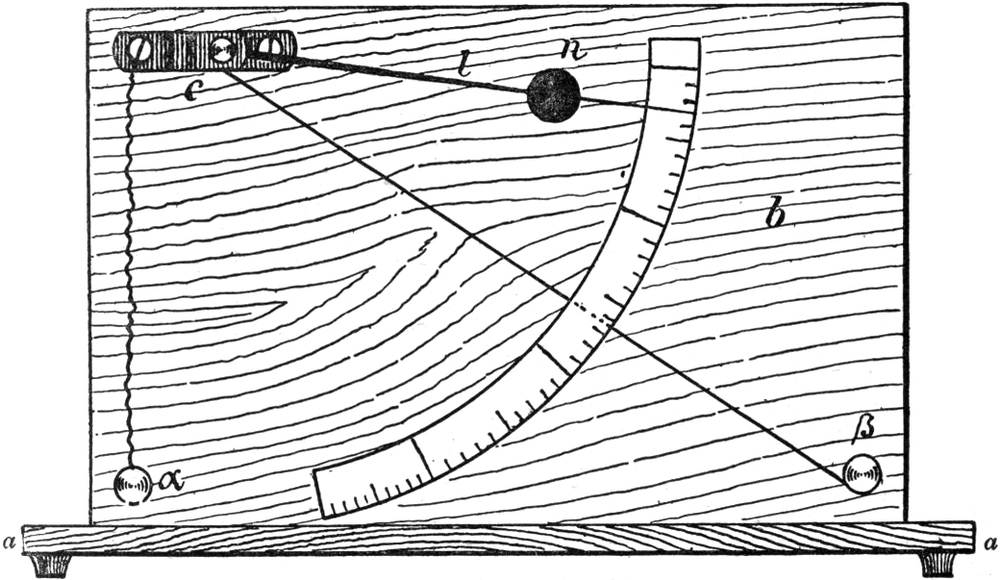
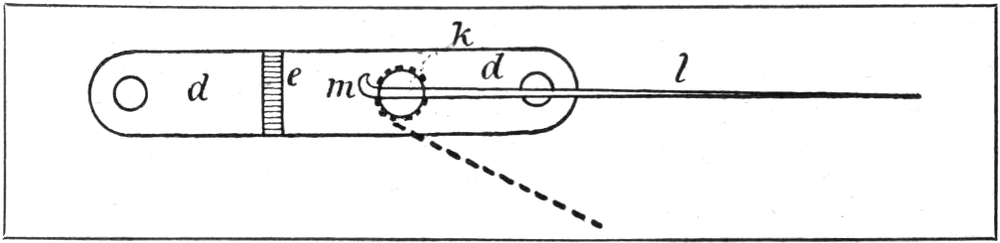
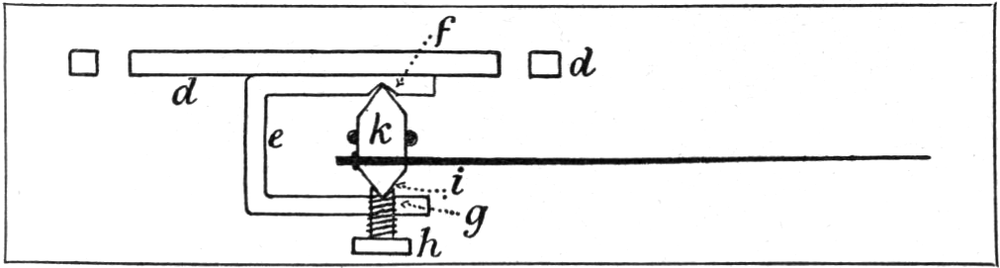
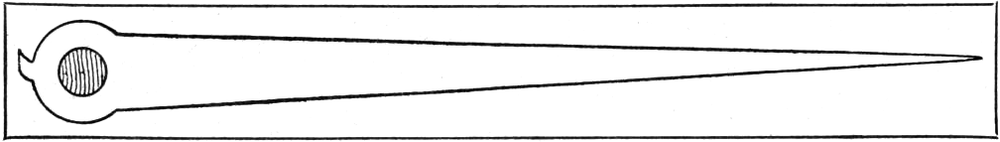
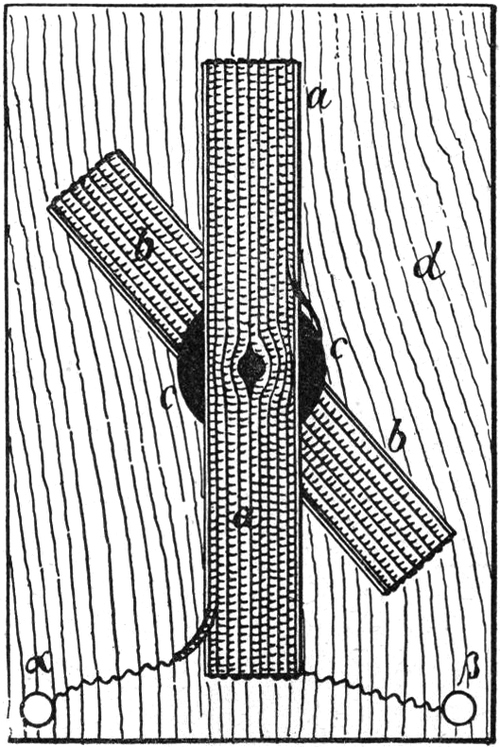


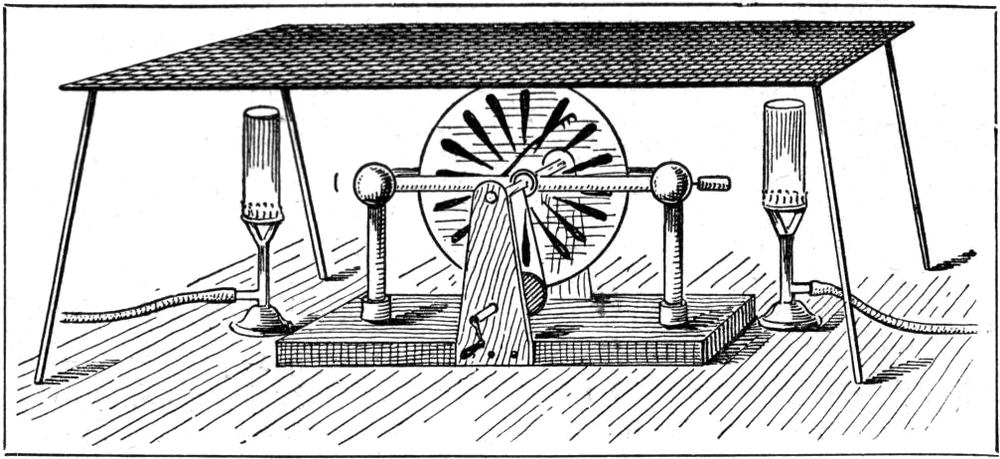
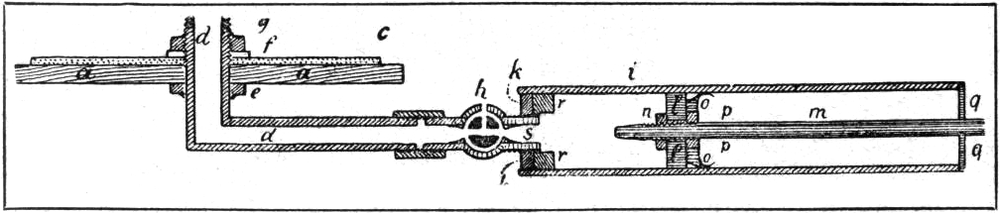
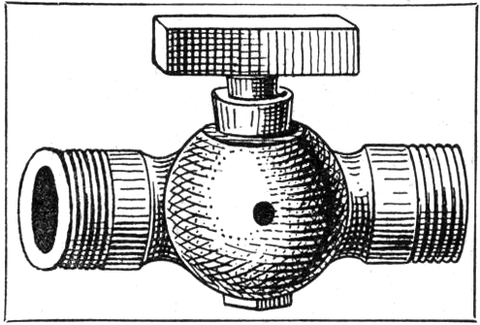
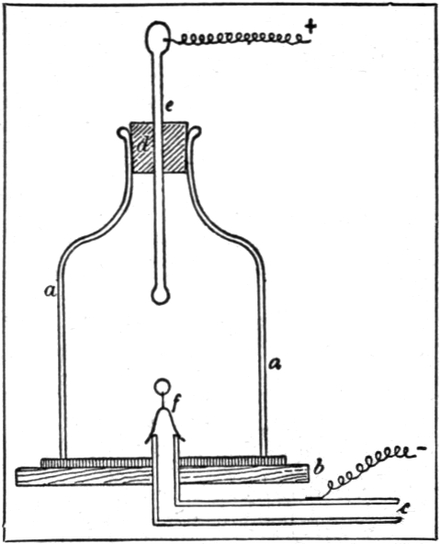
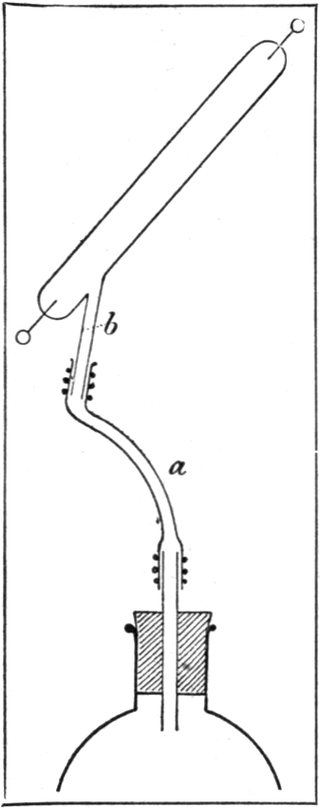
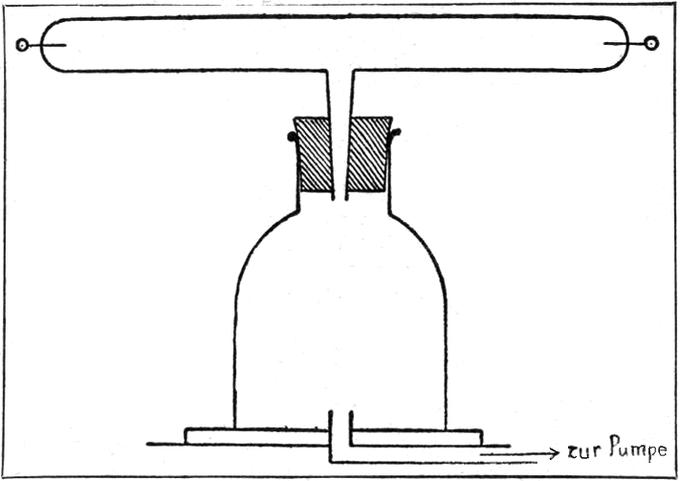
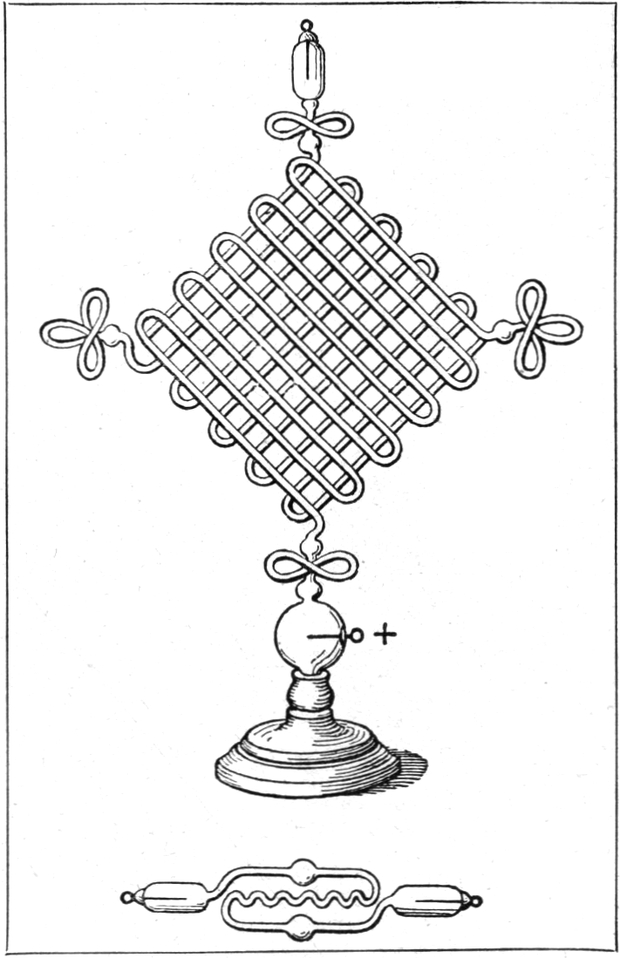
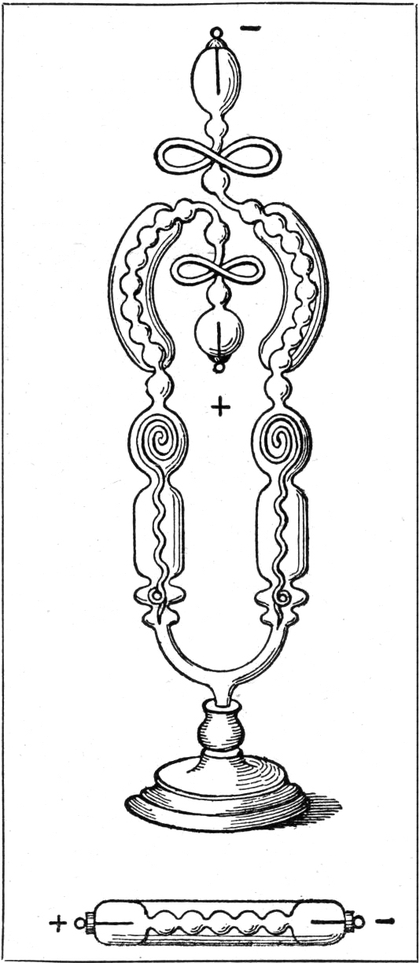
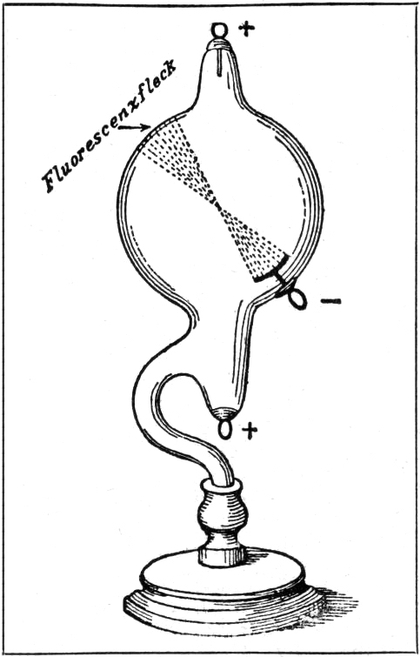
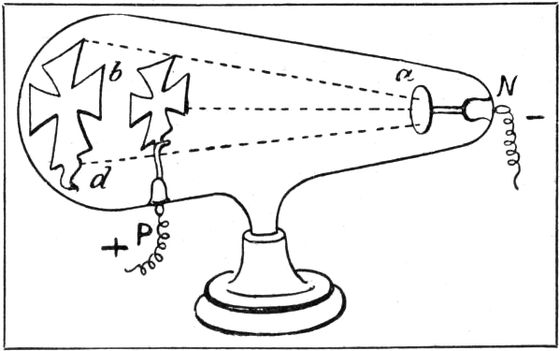
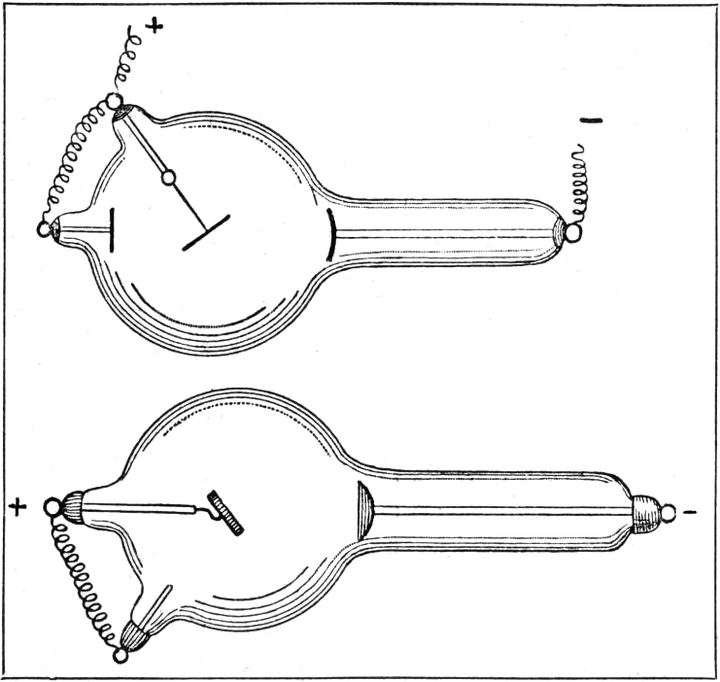
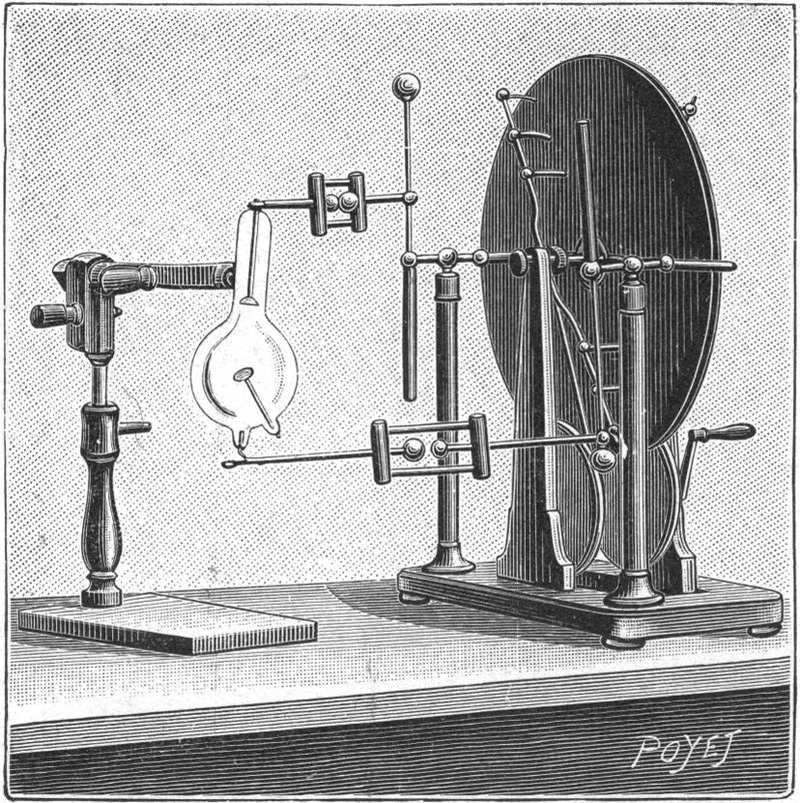
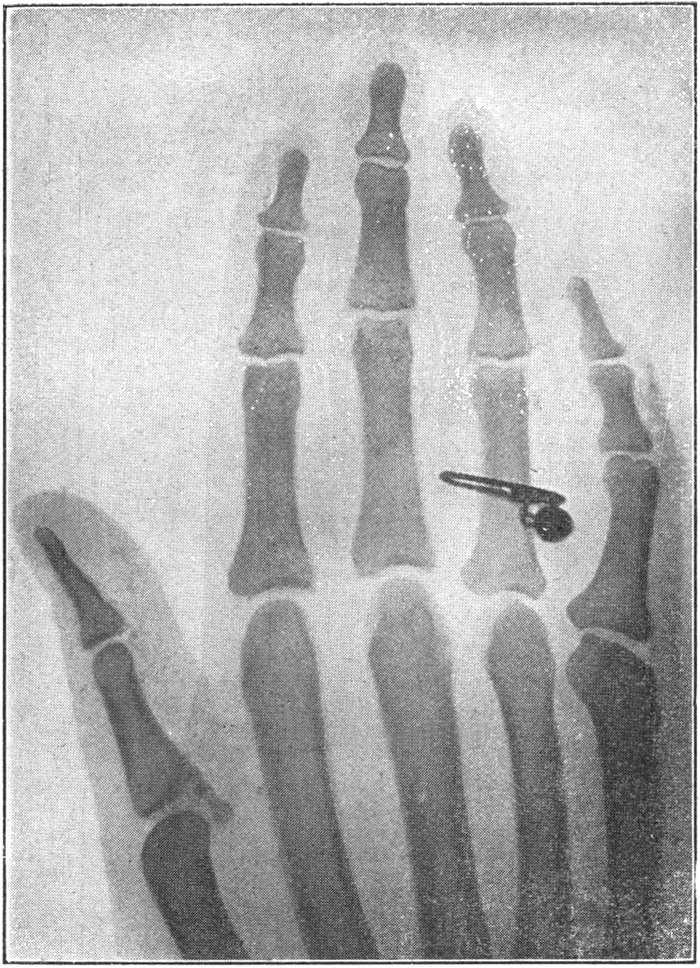
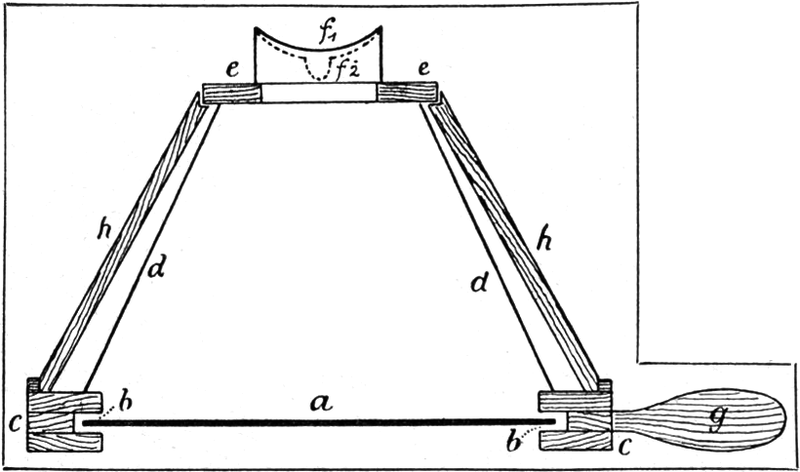


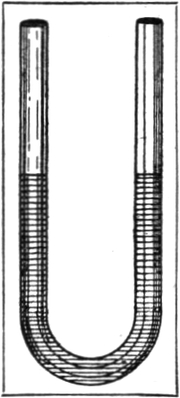
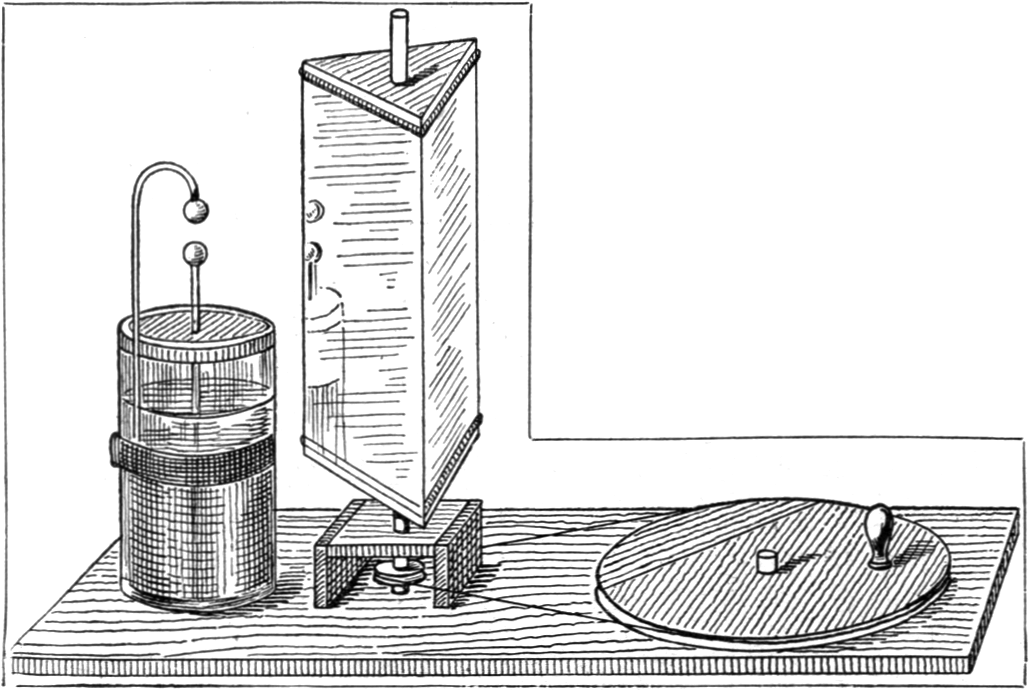
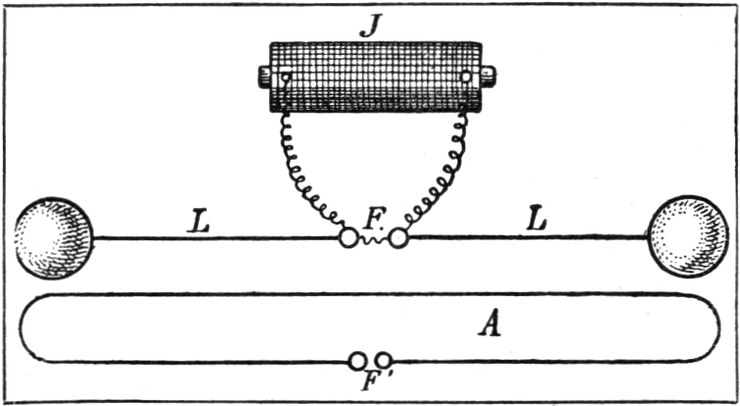
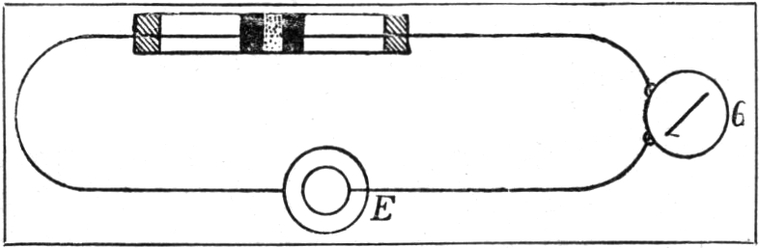
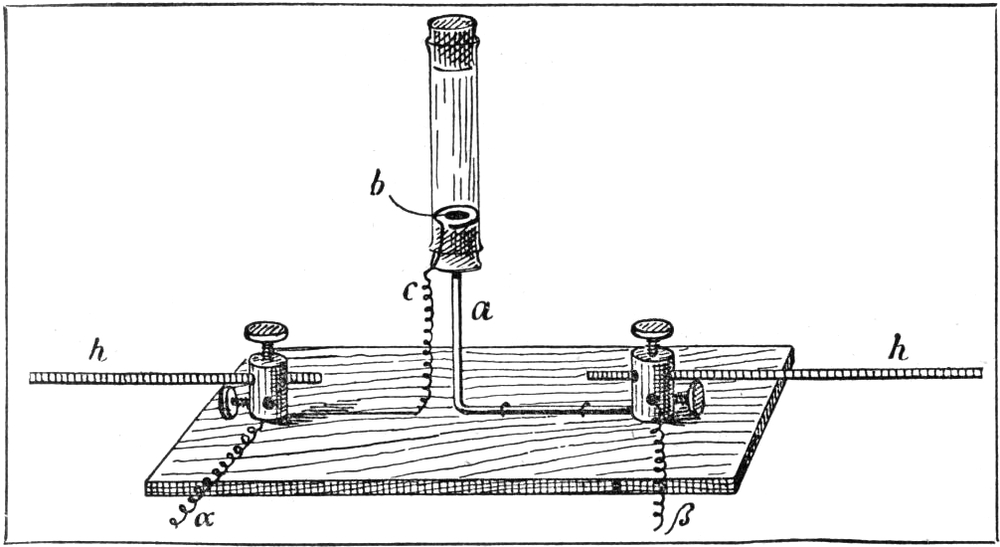
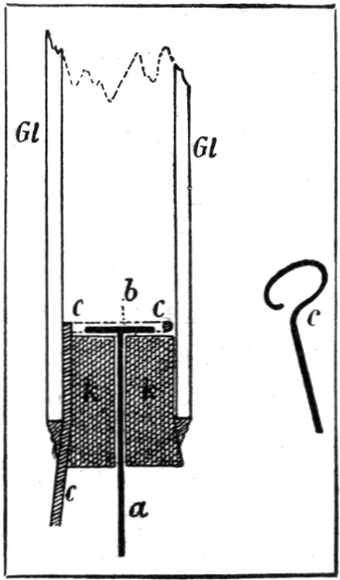
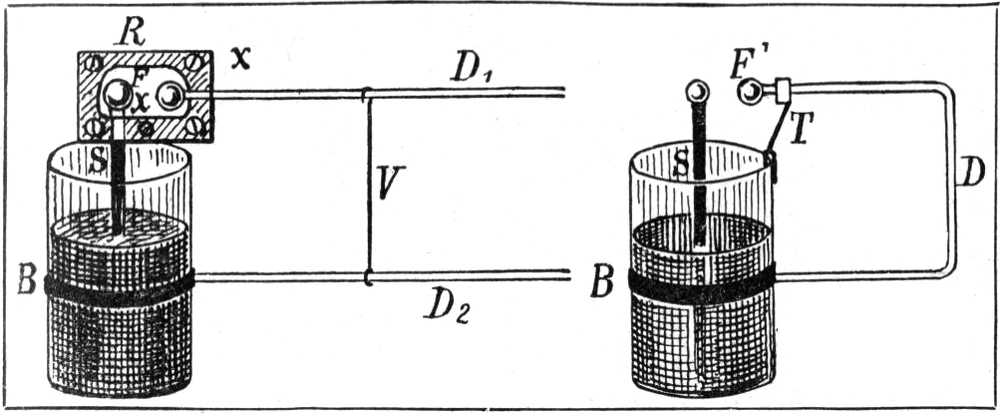
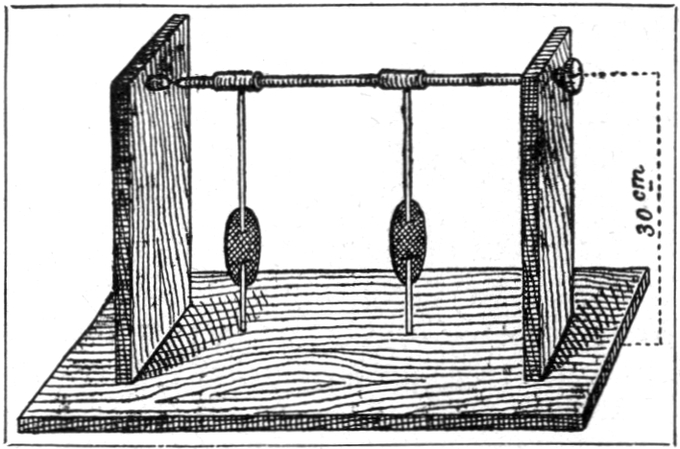
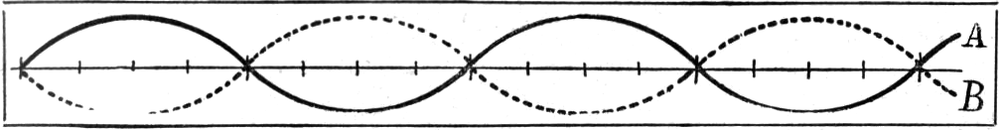
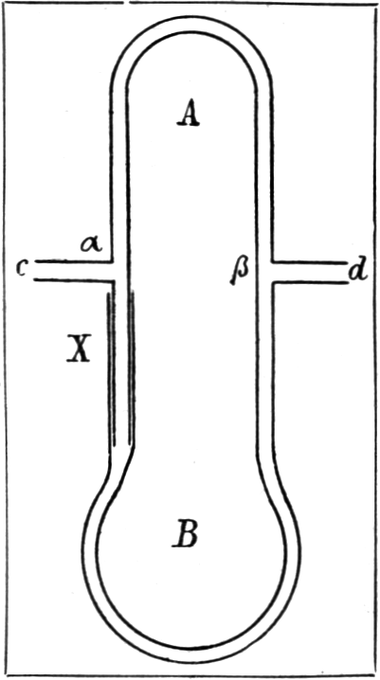
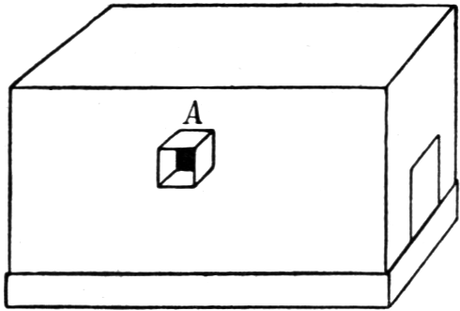
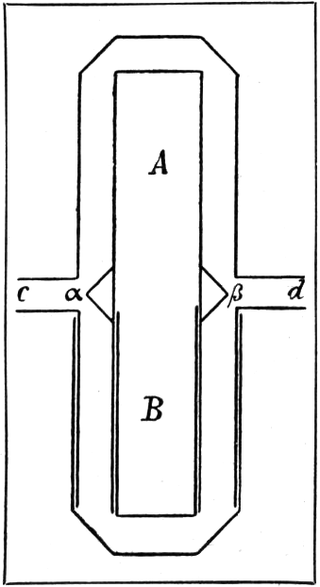
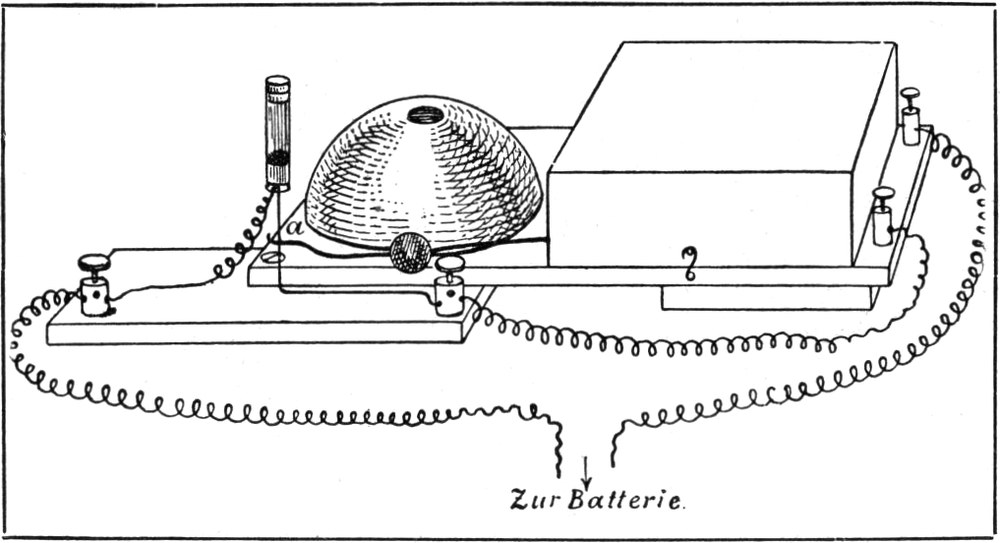
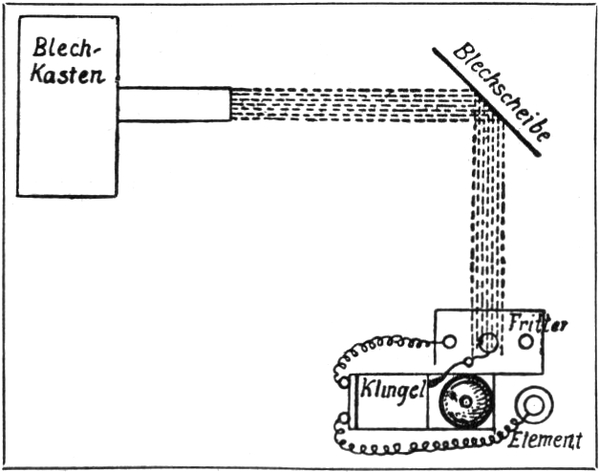
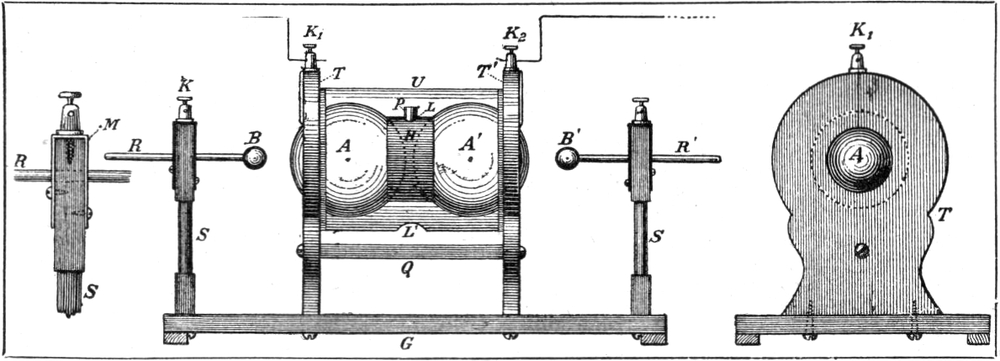
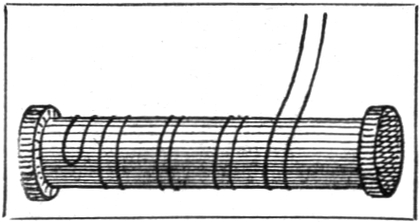
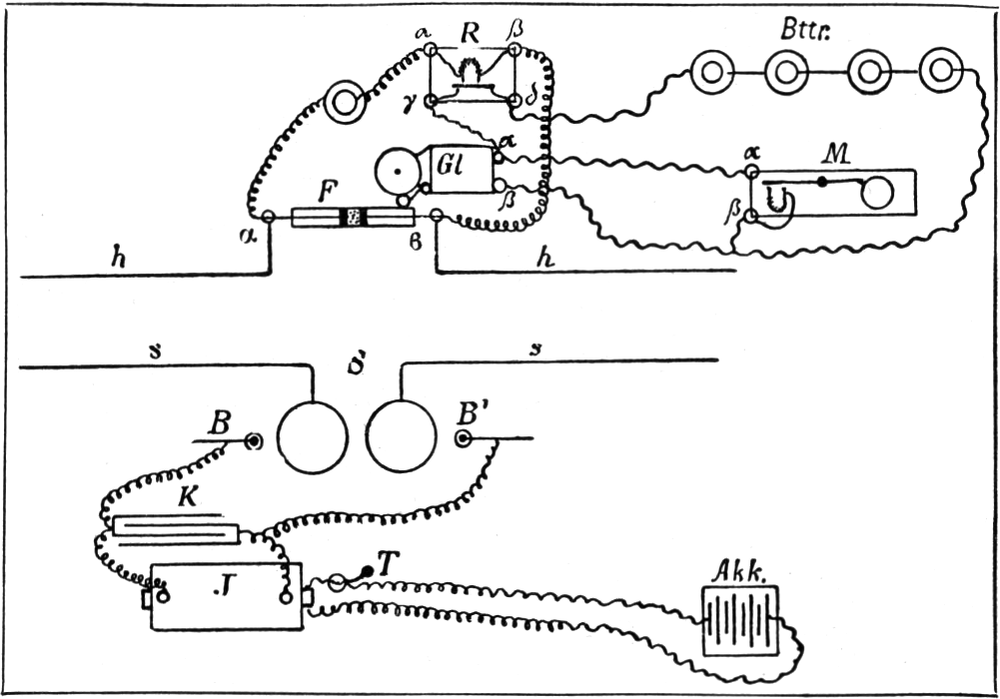
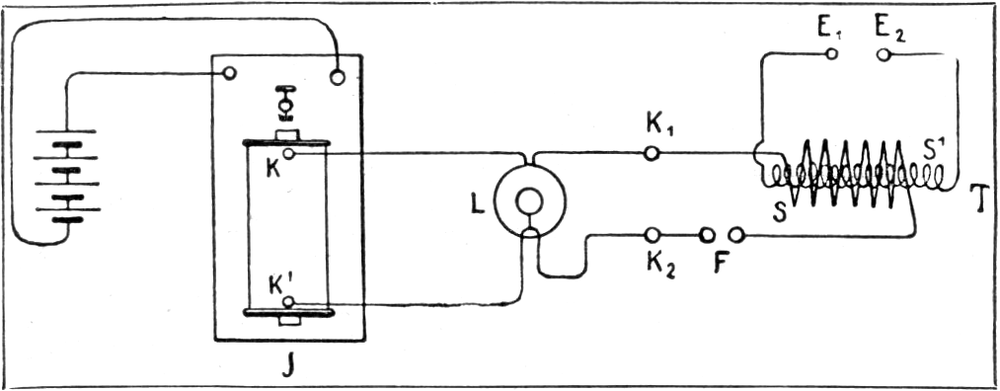
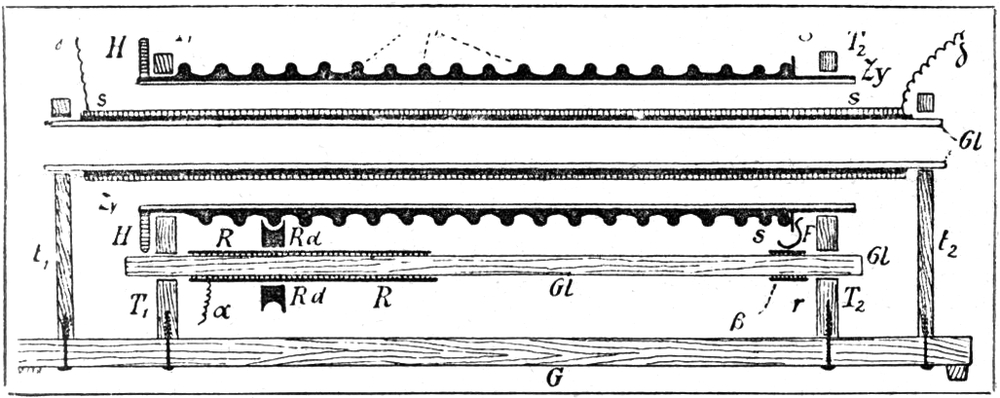
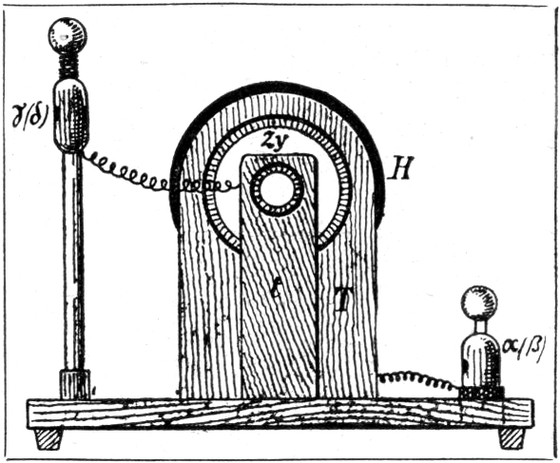
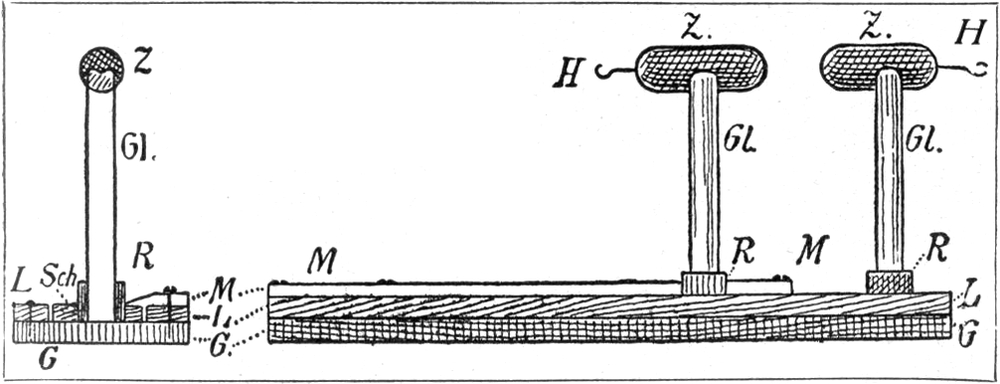
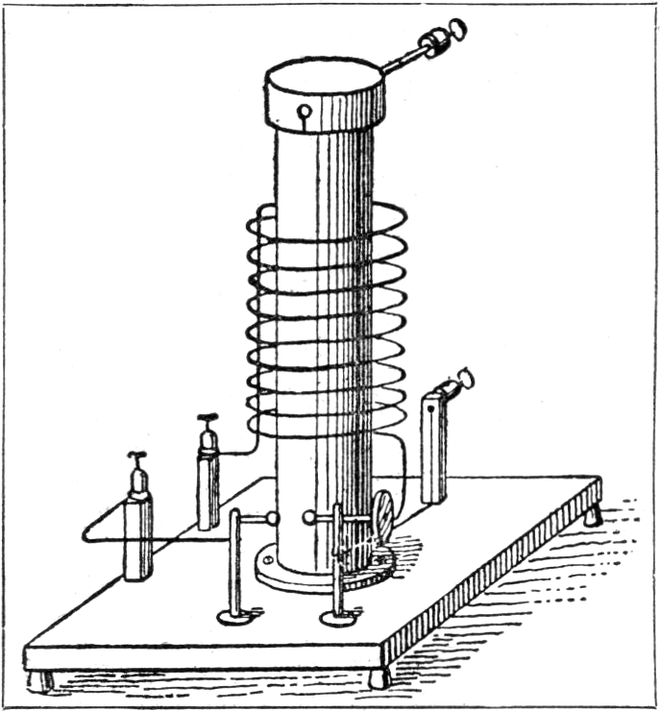
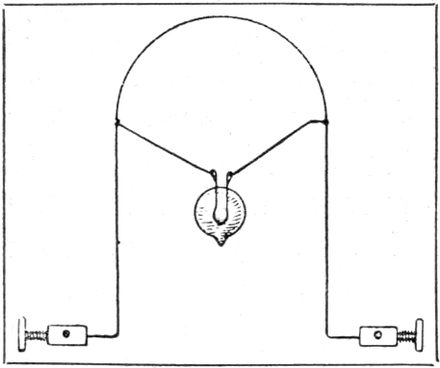
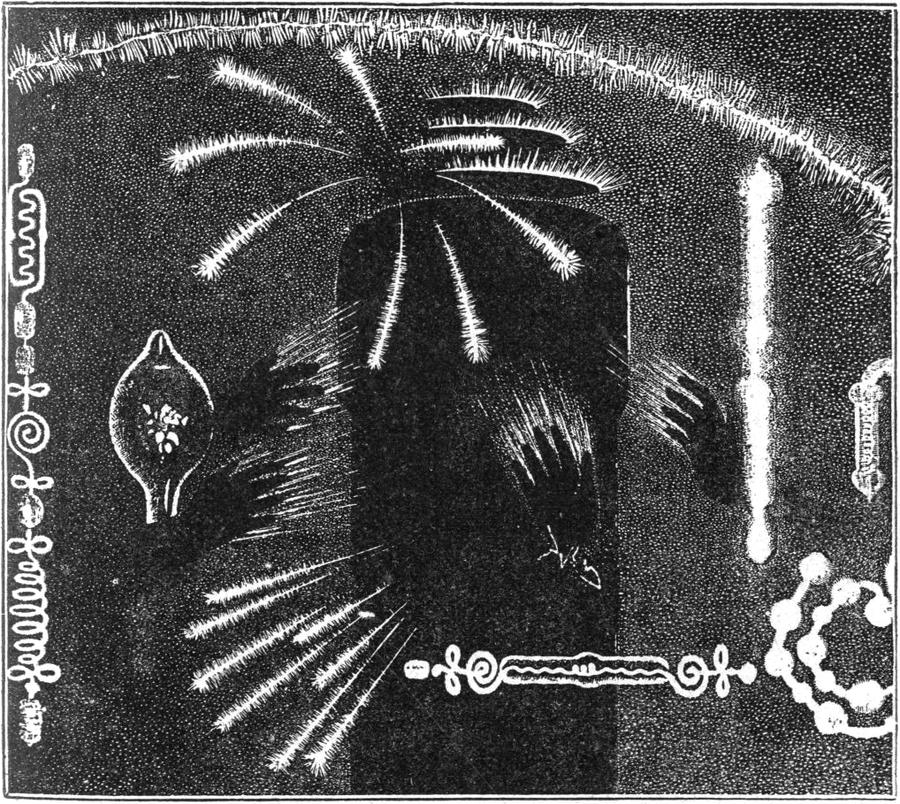
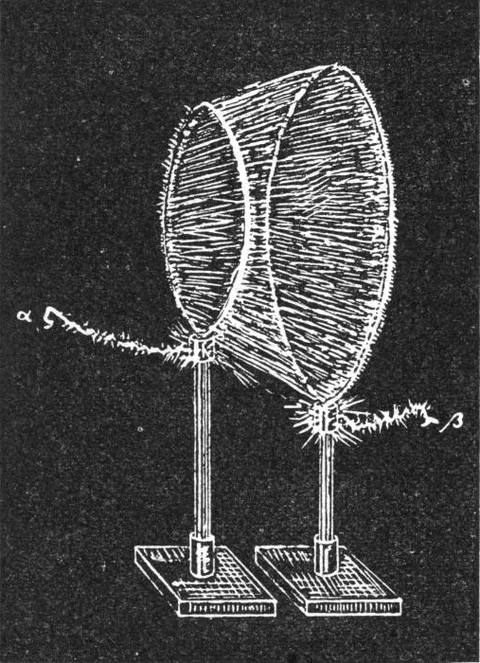
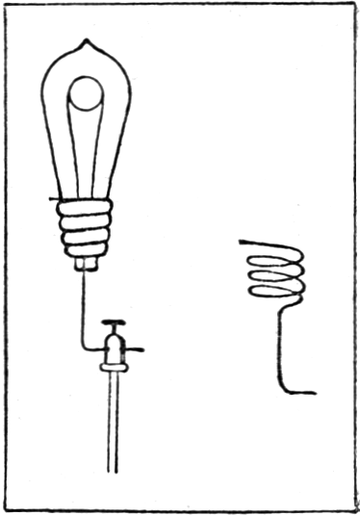
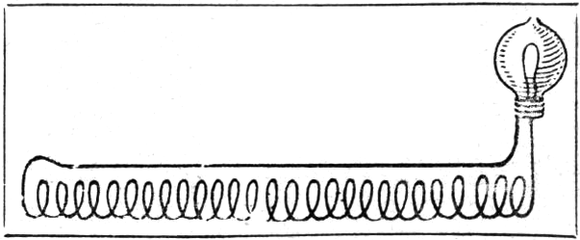
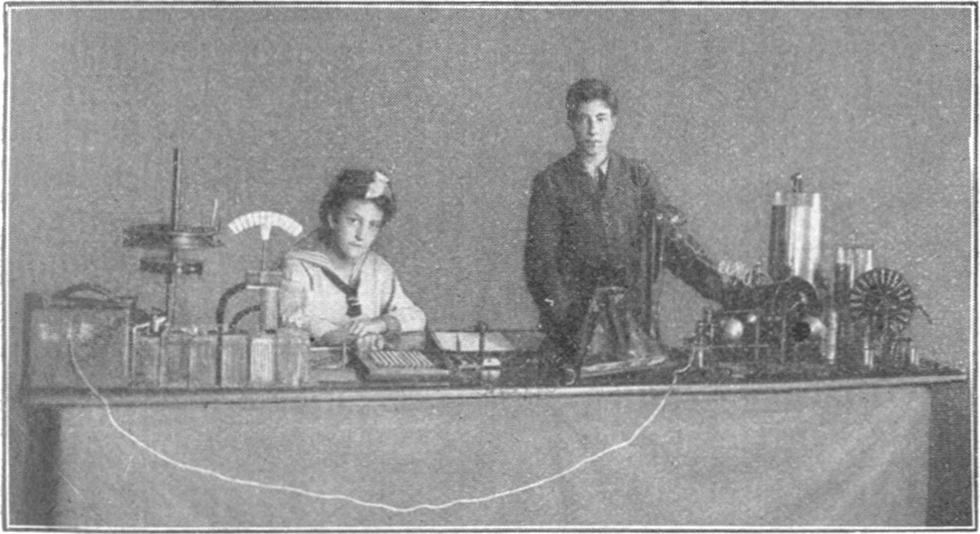

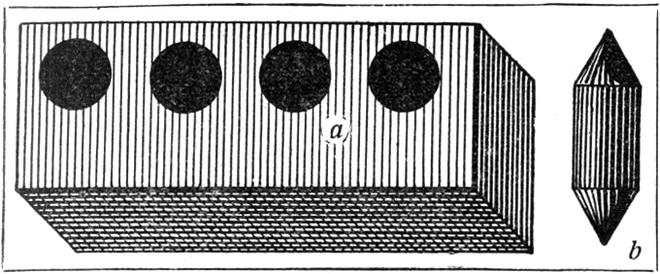
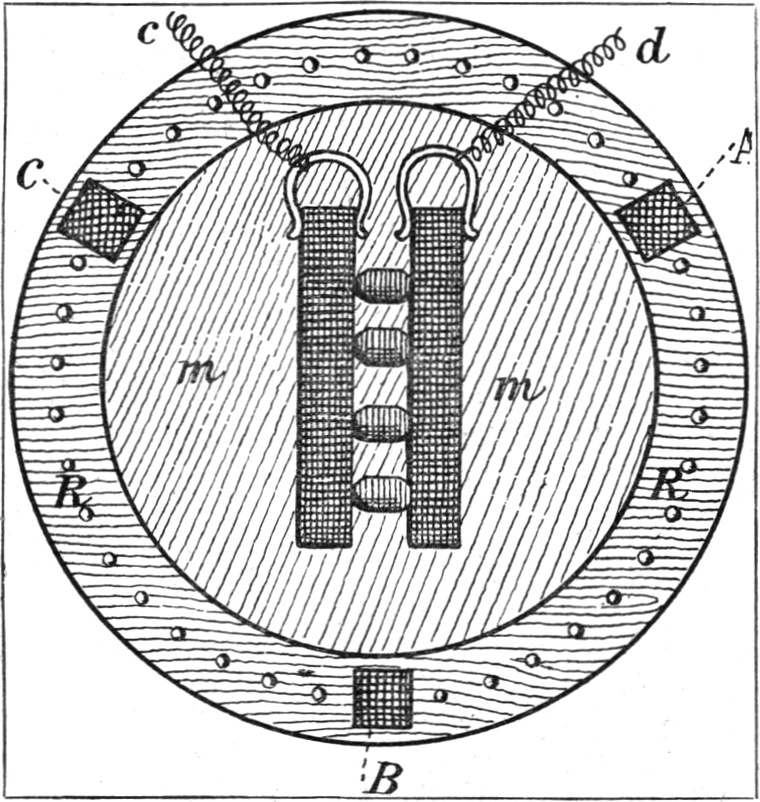
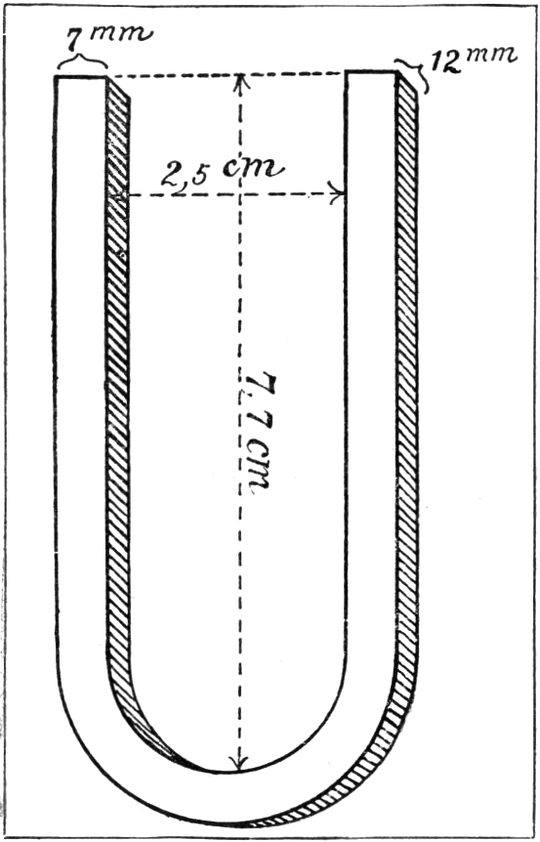
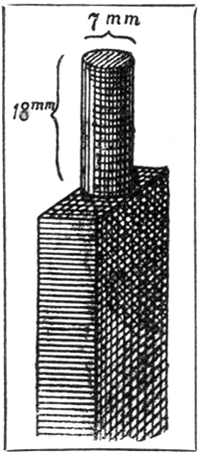
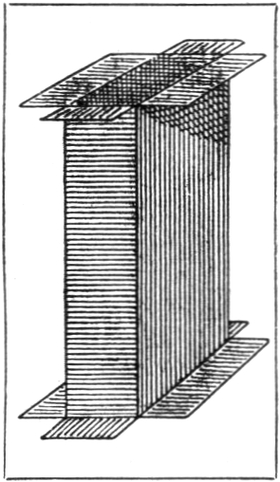
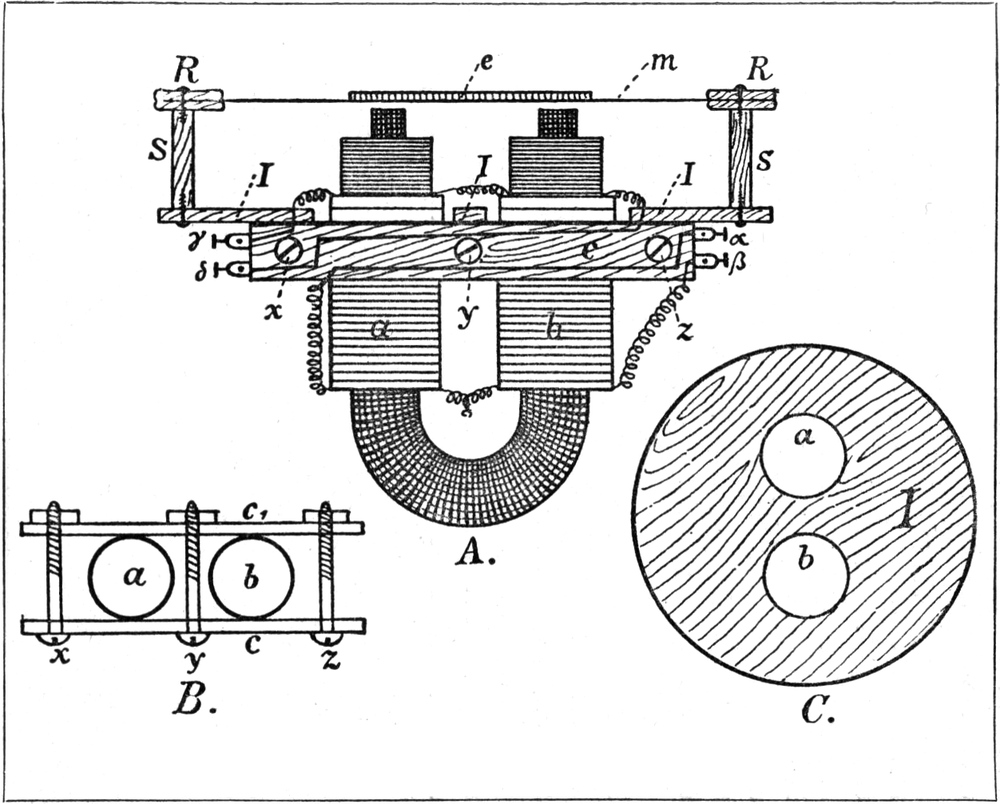
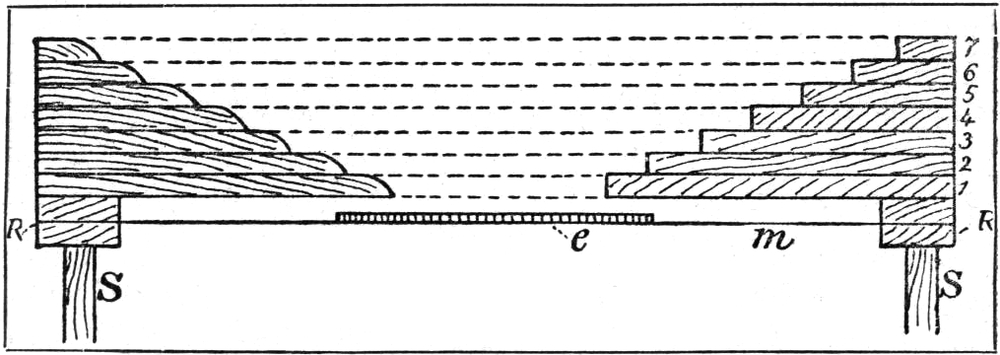
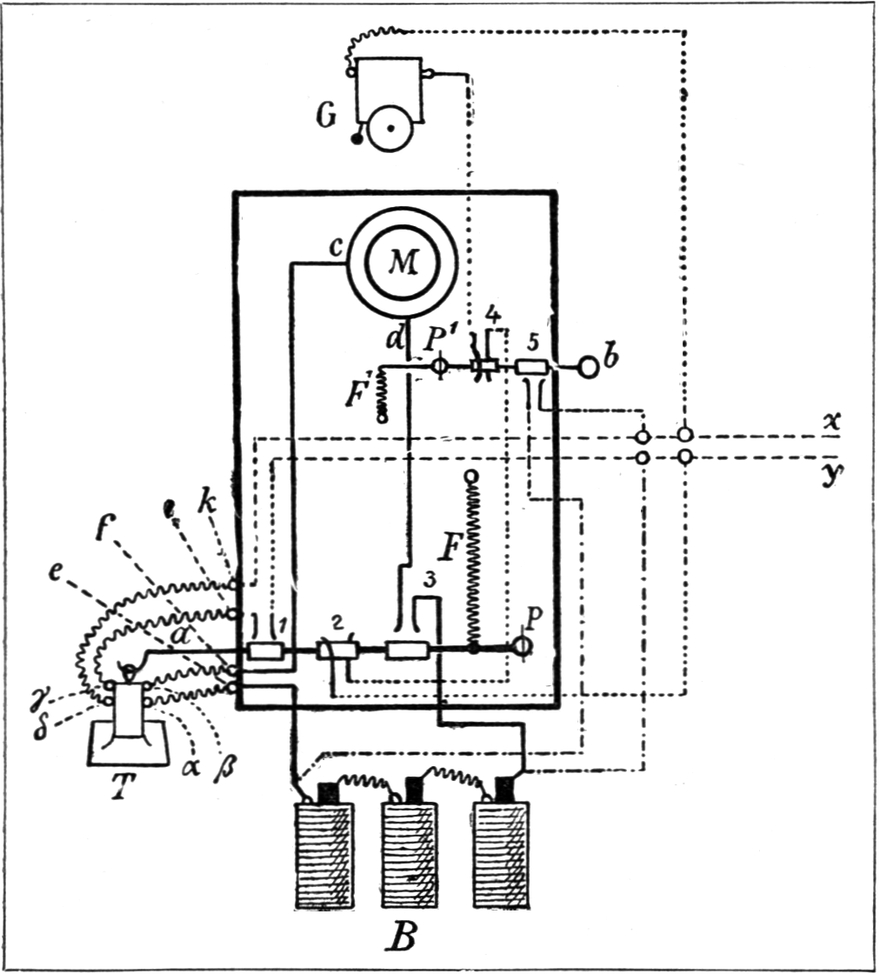
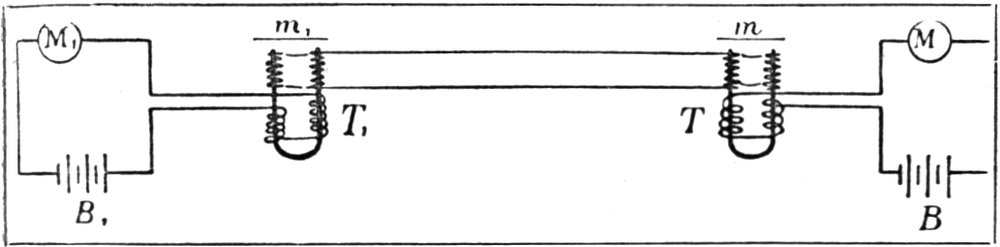
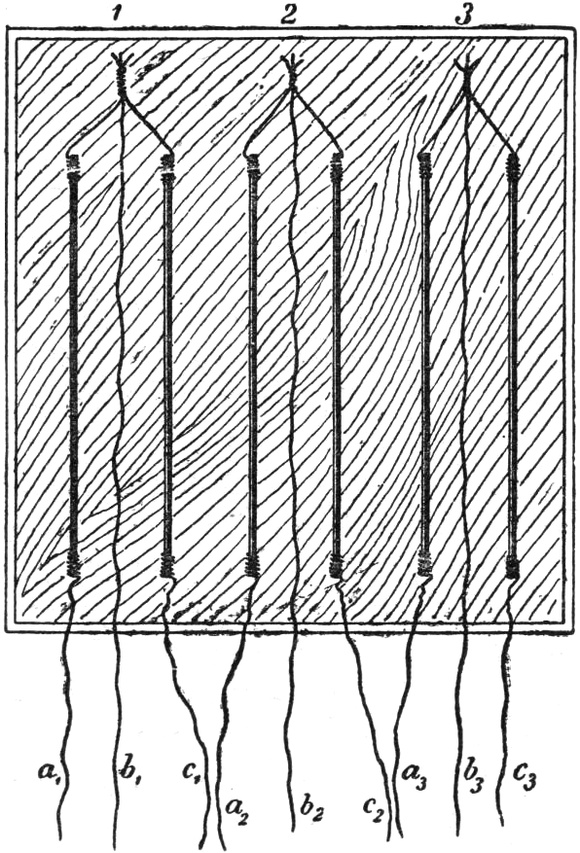
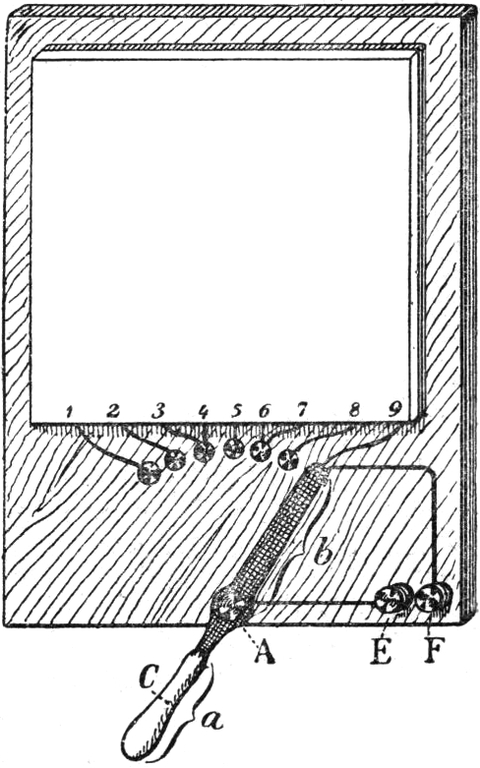
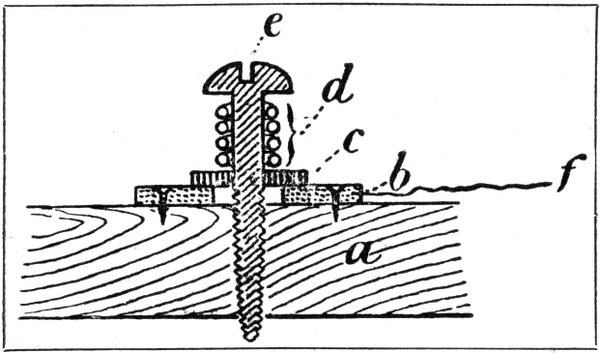
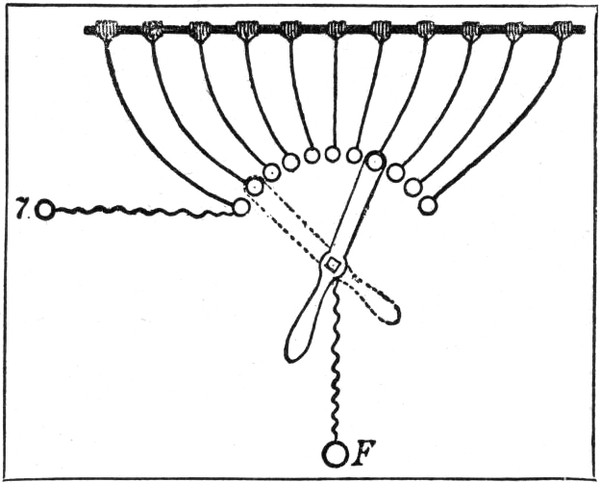
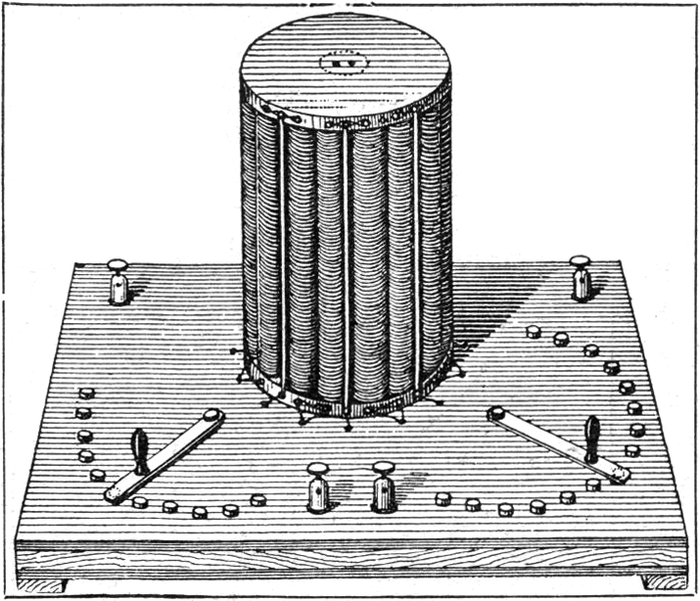
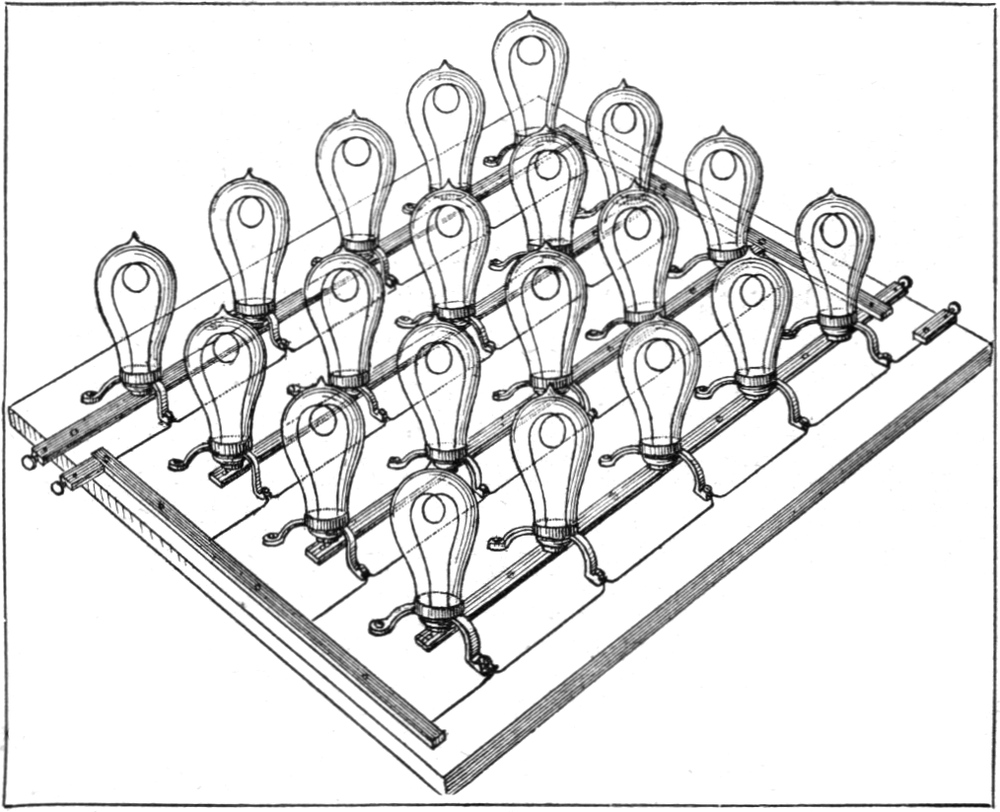
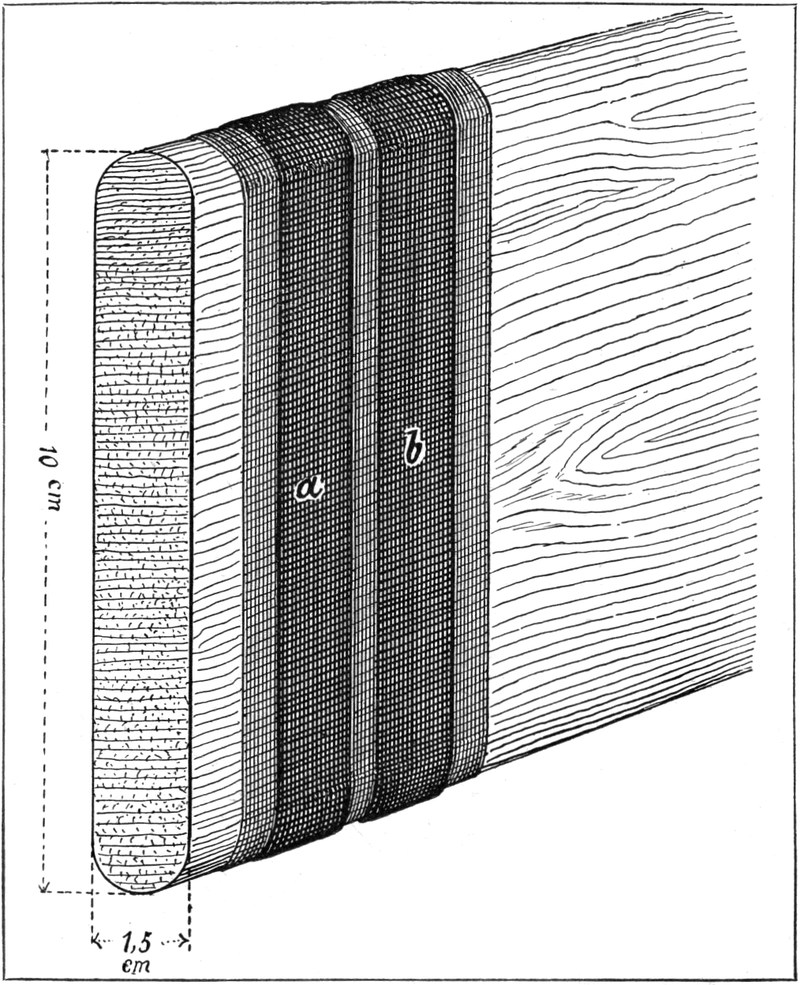
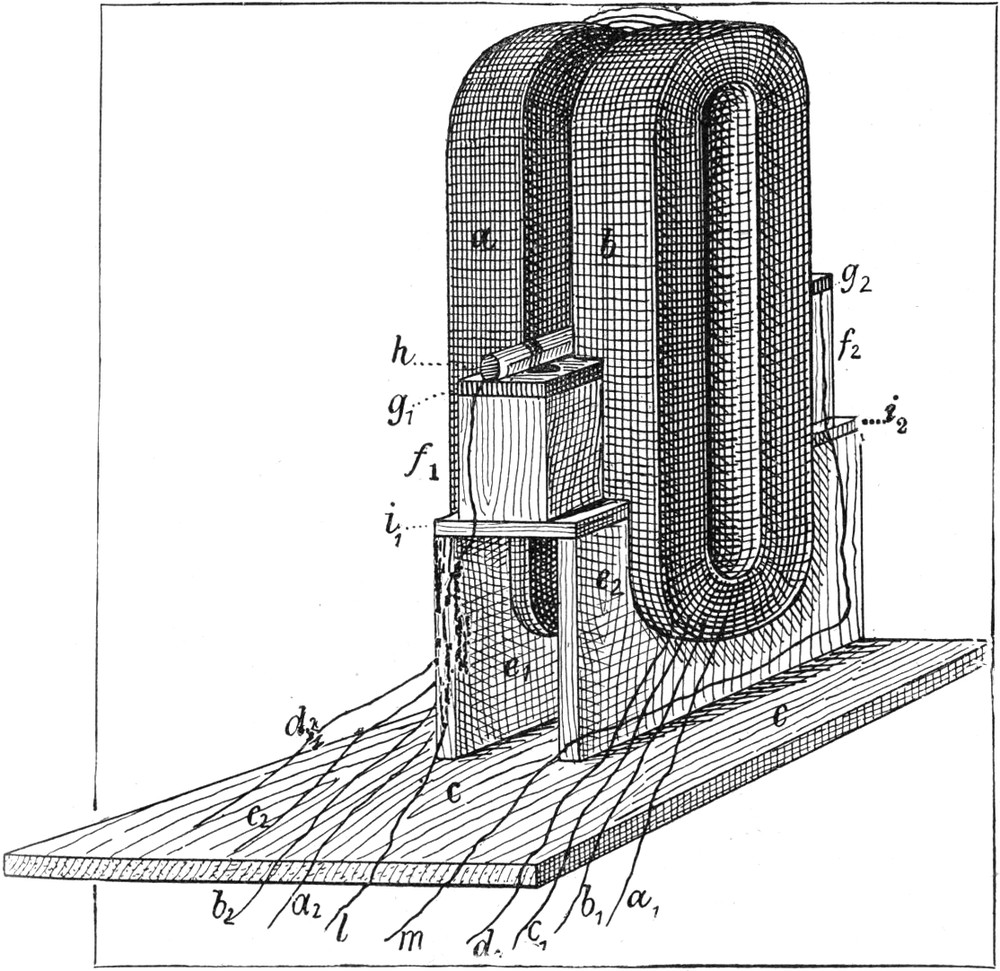
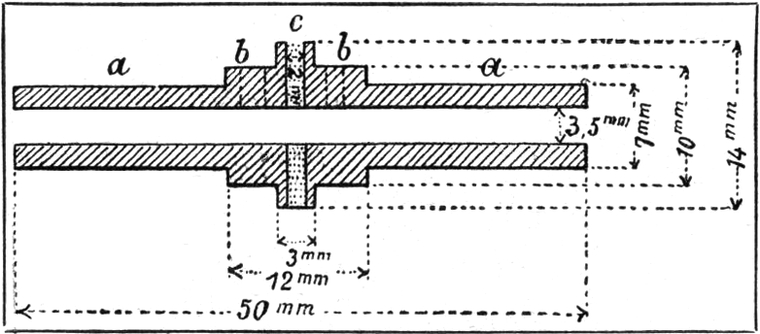
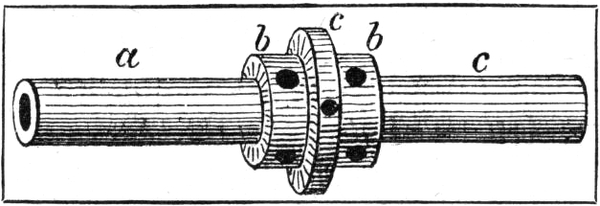
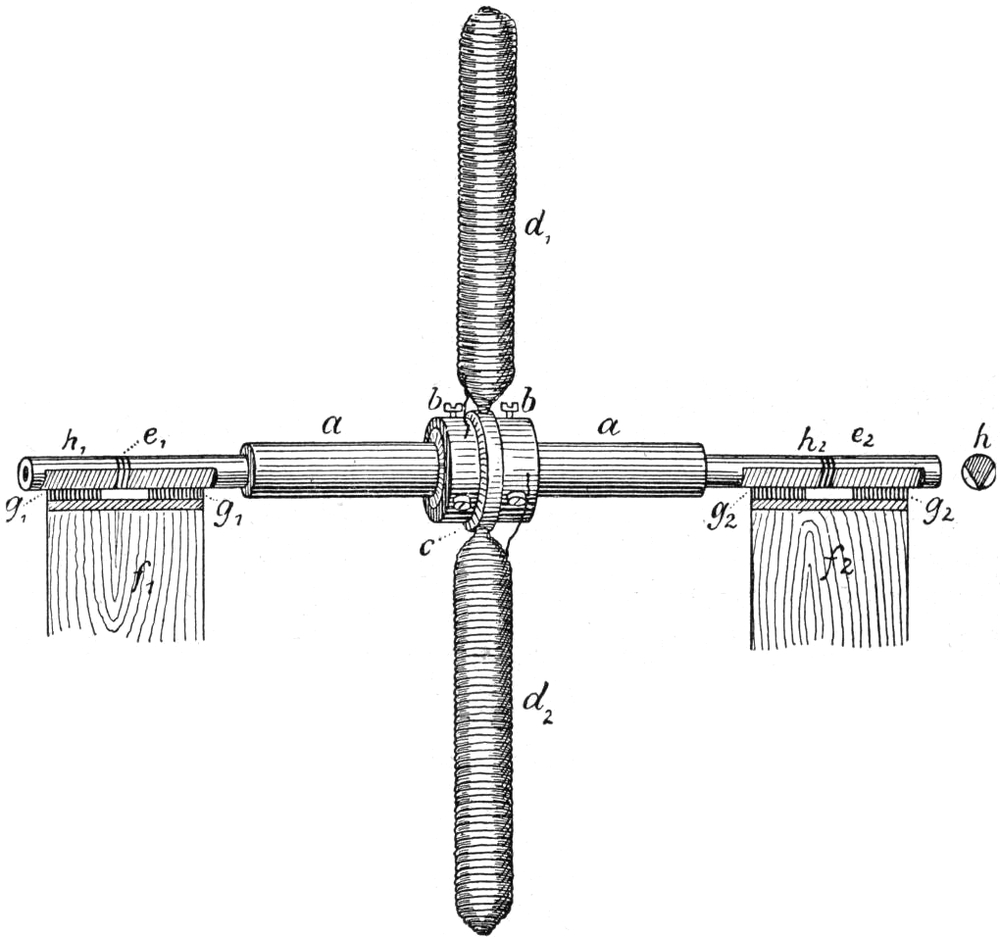
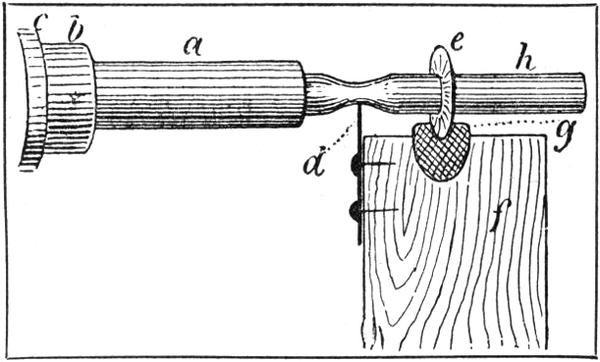
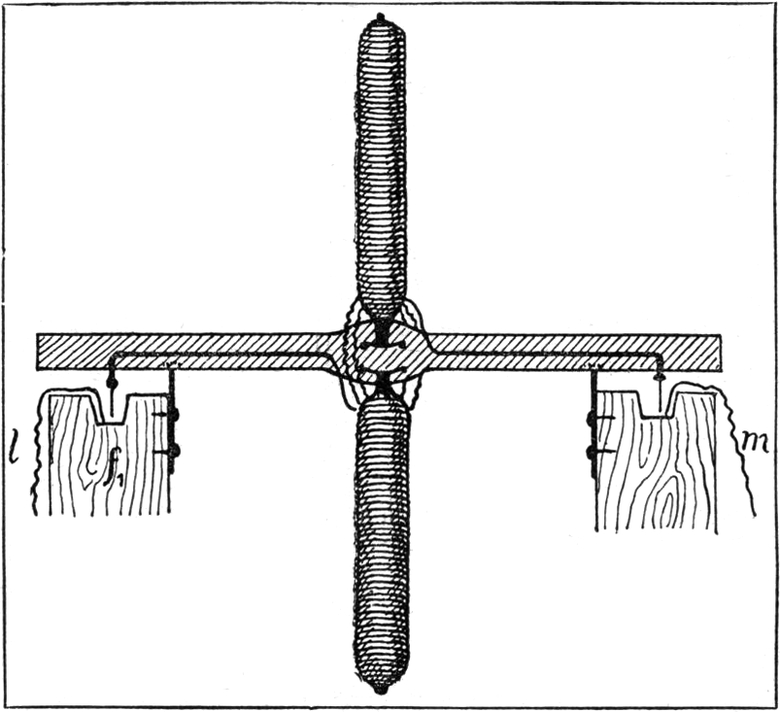
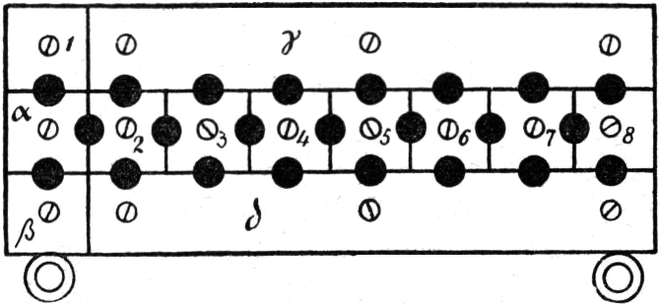
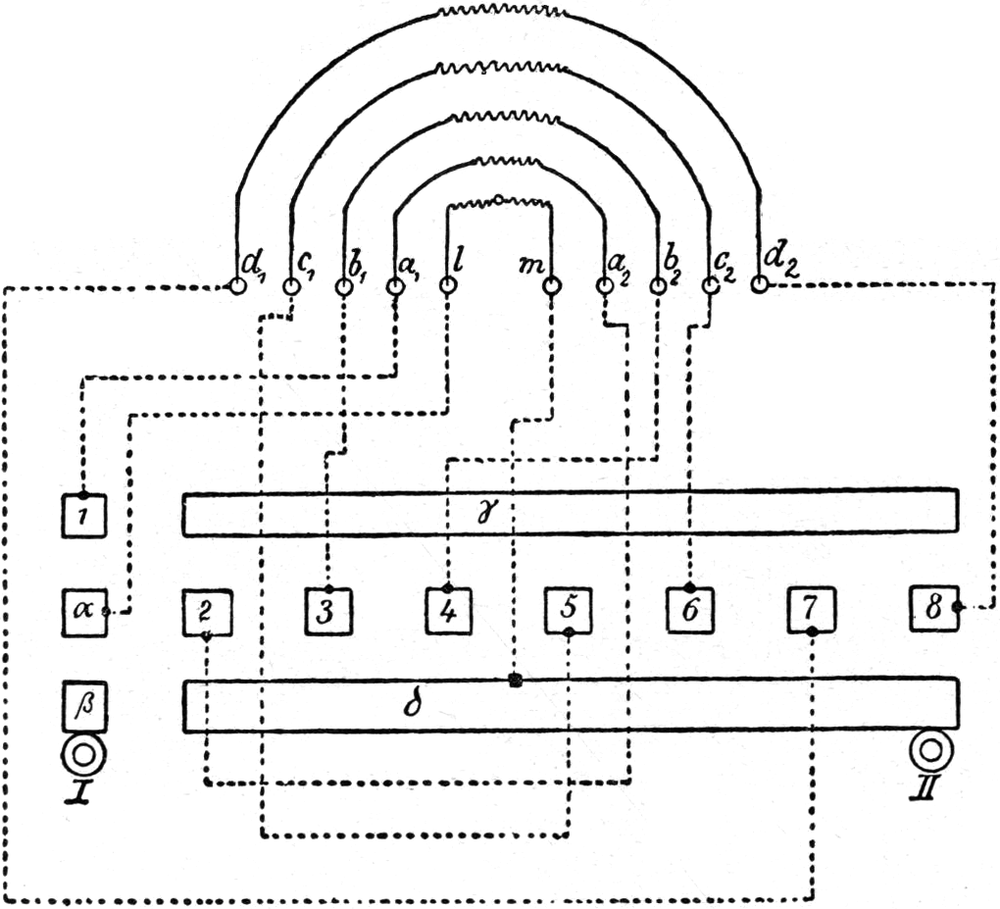
![[senkrecht durchgestrichener Kreis]](images/circled_vertical_bar.png) bezeichneten Stellen werden 2
bezeichneten Stellen werden 2 ![[schwarzer Punkt]](images/black_bullet.png) bezeichneten Stellen werden 3 bis 4
bezeichneten Stellen werden 3 bis 4